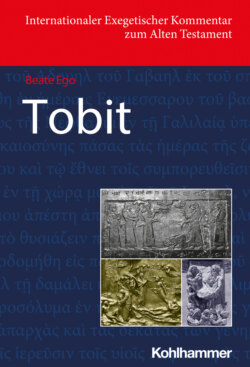Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diachrone Perspektiven der Tobiterzählung Zur Literarkritik
ОглавлениеTobits LobgesangDas Tobitbuch ist auch Gegenstand literarkritischer Reflexion geworden.83 Bereits die ältere Literatur wollte zumindest in Tobits Lobgesang (13,1–18) eine sekundäre Ergänzung sehen.84 Ein wichtiges Argument war in diesem Zusammenhang, dass sich an keiner Stelle dieses eschatologisch ausgerichteten Gebets direkte inhaltliche Beziehungen zur Handlung des Tobitbuches finden und das Lied sich auch in stilistischer Hinsicht von der restlichen Erzählung abhebt. Das Textstück zeigt zudem im Hinblick auf die Einbindung in den narrativen Kontext gewisse Unstimmigkeiten: Während Tobit und sein Sohn im Anschluss an die Selbstoffenbarung des Engels Rafaël Gott gemeinsam loben (12,22), verfasst Tobit sein Preislied anschließend in schriftlicher Form (13,1); Tobias dagegen wird in diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt. Zudem unterscheiden sich auch die eschatologischen Entwürfe am Ende des Buches bezüglich der Perspektive auf die Völker: Während Tobit in seinem Hymnus die Wallfahrt der Völker nach Jerusalem als integralen Bestandteil der Zukunftserwartung sieht (13,11b–d), spricht er in seinem Testament zwar explizit von der Umkehr der Völker, behält aber die Sammlung in Jerusalem und das Wohnen im Land den „Kindern Israel“ vor (14,6a–7c).85
Entwürfe für das GesamtbuchDezidiert literarkritische Entwürfe für das gesamte Buch, die von einem mehrstufigen Wachstum ausgehen, präsentierten Paul Deselaers (1982) und Marten Rabenau (1994). Nach Deselaers erfuhr die um die Mitte des 3. Jh.s v. Chr. in Ägypten entstandene, knapp fünfzig Prozent des Gesamtbestandes umfassende Urfassung des Buches (für Deselaers ist dies die Kurzfassung GI) ungefähr um 220 v. Chr. eine Überarbeitung in Jerusalem, wobei die Bedeutung des Gesetzes und der Propheten in den Vordergrund getreten sei. Eine weitere Überarbeitung soll zwei Jahrzehnte später vermutlich in Alexandria unter dem Einfluss der dortigen Pogrome vorgenommen worden sein und die Achikargestalt in die Erzählung eingeführt haben. Eine dritte und letzte Bearbeitung, die vornehmlich eschatologische Akzente setzte, soll schließlich um 185 v. Chr. in Jerusalem erfolgt sein.86 Rabenau wiederum möchte annehmen, dass das Buch in seiner Gesamtheit in Palästina entstand und dort auch in einem relativ kurzen Zeitraum mehrere Erweiterungen, die sich durch das gesamte Buch ziehen, erfuhr. „Die 1. Erweiterungsschicht, wahrscheinlich zwischen 147 und 141 v. Chr. in Palästina erstanden [sic!], spiegelt mit der Pflicht zur Totenbestattung die unruhigen Zeiten und verpflichtet besonders zur Solidarität mit den mittellosen, bedürftigen Brüdern. Die 2. Redaktion verarbeitet verstärkt die innerjüdischen Spannungen und wird in Palästina nach 140 v. Chr. erfolgt sein. Auch die 3. Erweiterung mit ihrer Betonung der Gesetzesfrömmigkeit erfolgte im letzten Drittel des 2. Jh.s v. Chr. in Palästina.“87
Beide literarkritischen Vorschläge hat die Forschung allerdings sehr zurückhaltend aufgenommen. Deselaers’ Ansatz ist insofern problematisch, weil er von der Priorität von GI ausgeht. Bei Rabenau bilden – abgesehen von der Einbindung des Lobliedes Tobits (13,1) – nicht auffallende Widersprüche, sondern vielmehr meist stilistische Kriterien wie Dubletten oder redundante Formulierungen die Grundlage für eine Quellenscheidung, sodass er von bestimmten Themen auf eigenständige Schichten schließt. Dieses Vorgehen wirft insofern methodologische Probleme auf, da all diese Kriterien keineswegs zwingend und notwendig für eine Quellenscheidung sprechen.88 So plädiert auch die Mehrzahl der Ausleger für die literarische Einheitlichkeit des Buches.89
Einen neuen Vorstoß im Hinblick auf die Diachronizität der Erzählung unternahm Lawrence M. Wills in seiner Arbeit über den griechischen Roman. Danach bilden Tob 2–12 den Kern, der sich am besten als eine volkstümliche Erzählung mit komischen Elementen beschreiben lässt. Tob 1, das einen viel strengeren Ton aufweist und das nur durch das Motiv der Bestattung und der Rede vom Erinnern mit Tob 2 verbunden ist, stamme – so Wills – von einer anderen Hand. Es erinnere mehr an Erzählungen von der Verfolgung einer gerechten und weisen Person, die in einem höfischen Kontext auftritt, und damit an die Josefsgeschichte, die Daniellegenden oder das Esterbuch. Auch Tob 13 und 14 stammten, so Wills, von einer anderen Hand als die Kernerzählung; auch hier verweist er wieder auf den unterschiedlichen Ton der Erzählung. Ein inhaltlicher Widerspruch zum Kern der Geschichte liege zudem in Tob 14,10 vor, wo Nadab, der Neffe Achikars, im Einklang mit der Achikarlegende pejorativ beschrieben wird, wohingegen er in Tob 11,19 einfach als Cousin bei den Hochzeitsfeierlichkeiten erscheine.90 In eine ganz ähnliche Richtung votierte auch John J. Collins: Zwar sei es schwierig, eine detaillierte literarkritische Analyse vorzulegen, die einzelne Schichten unterscheide und sogar zwischen einzelnen Versen trenne; die Diversität des Materials lege jedoch die Vermutung nahe, dass zumindest der Abschnitt über Tobits Jerusalemfrömmigkeit in Kap. 1 sowie die eschatologischen Passagen in Tob 13 und 14 sekundäre Erweiterungen seien. Dabei formuliert Collins ohne Rekurs auf Wills’ Ergebnisse:
„The core story of Tobit concerns the adventures and misadventures of a family. Only in the opening and concluding chapters is that story placed in the broader context of the history of Israel. The concern for Jerusalem and for the reunification of Israel in these passages is extraneous to the core story, and not required for its completion. There is reason to suspect, then, that the beginning and the ending of the story have been expanded to provide a theological and historical frame, from a Judean, Jerusalemite perspective, that was no integral to the original story of Tobit.“91
Dies bedeute jedoch nicht, dass die gesamten Kapitel 1, 13 und 14 sekundär seien, da das Buch mit einer Einleitung begonnen und mit Tobits Tod geendet haben müsse; auch seien sekundäre Zusätze im „Kern“ des Buches Tob 2–12 nicht auszuschließen; eine Unterscheidung zwischen dem Rahmenteil und dem Kern des Buches könne aber genügen.92
Interessant und weiterführend im Hinblick auf die Thematik der Literarkritik ist ein Ansatz der neueren Forschung, wie er von Naomi Jacobs in einem Aufsatz mit dem Titel „Scribal Innovation and the Book of Tobit: A long Overdue Discussion“ eingebracht wurde. Sie unterscheidet sich in der Herangehensweise insofern von der klassischen Literarkritik, als dass hier nicht nach der Schichtung des Textes gefragt, sondern vielmehr mit punktuellen Bearbeitungen desselben im Kontext der Schreibertätigkeit gerechnet wird. Jacobs stellt fest, dass sich in der Erzählung eine ganz auffällige Verteilung in der Verwendung der Gottesbezeichnungen findet: Während im Rahmen vom „König des Himmels“ (1,18; 13,7.11.16) die Rede ist, spricht die Kernerzählung vom „Herrn / Gott des Himmels“ (6,18; 7,11.12.17; 8,15; 10,11.13; siehe auch 5,17: „der Gott, der im Himmel ist“). Dieser Befund bestätigt – so Jacobs – Collins’ und Wills’ These, wonach die Kapitel Tob 1; 13 und 14 von Tob 2–12 zu trennen sind. Weitere Hinweise auf die Aktivität von Schreibern, die partiell in den Text eingegriffen haben, finden sich insbesondere im Kontext der Regelungen zur Verheiratung von Tobias und Sara (7,11–13).93 Weiterführende Überlegungen zur Literarkritik des Buches präsentiert Jacobs in ihrer Monographie „Delicious Prose“. Auch hier argumentiert sie mit der Aktivität von einzelnen Schreibern, aber nun sind es z. T. auch größere Abschnitte, für die eine spätere Bearbeiterhand erwogen wird (so z. B. für 1,6–8; 1,10f.; 2,6; 2,11–14; einzelne Weisungen in der Abschiedsrede 4,3–19 [ohne genauere Spezifizierung], bei den Ausführungen zum Umgang mit der Galle 6,9; 11,8 und 11,12 oder bei den Angaben zu den verschiedenen Hochzeitsfeierlichkeiten in 7,9–14; 8,1; 8,19–20, 9,16; 12,7b–10; 12,12–14 oder 12,19).94 Kriterien zur Auffindung des sekundären Materials ähneln dabei denen aus der traditionellen Literarkritik, so inhaltliche Widersprüche oder stilistische Brüche, allerdings sind diese Fortschreibungen nun nicht mehr konkreten Schichten zuzuordnen. Die Vorschläge Jacobs’ haben unterschiedliche Plausibilität; insgesamt liegt es aber in der Tat nahe, mit einem längeren Wachstumsprozess und mit einzelnen Fortschreibungen zu rechnen.
MinimalkonsensAls Minimalkonsens soll hier festgehalten werden, dass der älteste Teil der Erzählung in der Geschichte von der Heilung des frommen Tobit und der Vertreibung des Dämons zu finden ist (also im Wesentlichen in Tob 2–12). Zu überlegen wäre, inwiefern Tob 1,1–3 und Tob 1,10–22 in einer Grundschicht bereits zu diesem ältesten Teil der Erzählung gehörten. Der Protagonist muss zumindest kurz eingeführt werden, und die eigentliche Handlung setzt sowohl Tobits Reisen mit der Hinterlegung des Geldes (1,14) als auch sein Wirken bei der Bestattung der Landsleute (1,16–22) voraus. Vielleicht enthielt diese ursprüngliche Erzählung auch eine kurze Notiz über das Lebensende Tobits (ähnlich wie 14,1b–2).
Der Rahmen mit dem Jerusalembezug scheint dagegen später hinzugefügt worden zu sein. Hierzu gehört wahrscheinlich Tob 1,1–3 in seiner jetzigen Gestalt (vielleicht mit einem älteren Substrat), Tob 1,4–8; 13 und 14 (vielleicht auch mit älteren Teilen).
Die konkreten Angaben zu Tobits Herkunft aus Galiläa und deren Implikationen für die Vorstellung eines „Groß-Israel“ (1,1f.), die Jerusalemwallfahrt (1,4–8), die Verweigerung der Bestattung der Landsleute (1,17f.) und die Erwartung eines neuen Tempels (13,11; 14,6–7) lassen sich – wenn auch nicht zwingend – gut in zeitlicher Nähe zur Makkabäer- bzw. Hasmonäerzeit erklären.95
Zudem erscheint eine literarkritische Unterscheidung von Tob 13 und Tob 14 plausibel. Dafür spricht die Tatsache, dass diese Passagen Differenzen im Hinblick auf die künftige Rolle der Völker aufweisen. Während der Hymnus das Motiv der Völkerwallfahrt kennt (13,11–18), hat Tobits Testament lediglich eine universale Gotteserkenntnis der Völker im Blick (14,4b–7). Im Hymnus wird zudem das Motiv der Umkehr viel stärker in den Vordergrund gestellt. Nimmt man an, dass der Hymnus in Tob 13 jünger ist als das Kapitel mit der Geschichtsschau in Tob 14, so wäre die Kernerzählung von der Heilung des frommen Tobit und der unschuldigen Sara durch das Interesse einer geschichtstheologischen und eschatologischen Durchdringung des Stoffes in mehreren Stufen fortgeschrieben worden.