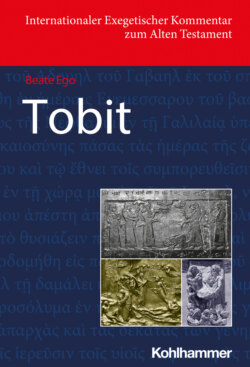Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Datierung und Entstehungsort
ОглавлениеDatierungIn der Forschung zeichnet sich der Konsens ab, die ursprüngliche Version des Tobitbuchs zwischen der Mitte des 3. Jh.s und 175 v. Chr. zu datieren.96 Als Terminus a quo gilt die Kanonisierung der Propheten als Heilige Schrift (vgl. 14,4) sowie aufgrund der Wendung „nach der Bestimmung des Buches des Mose“ (vgl. 6,13; 7,11.12.13) die Abfassung der Chronik. Als Terminus ad quem wird in der Regel die Makkabäerzeit genannt, da man annimmt, dass die Erzählung im Wesentlichen keine expliziten Hinweise auf die Religionsnot enthält.97 Eine solche Datierung passt zum Thema „Magie und Medizin“ sowie zu Tobits Weisheitslehre mit den zahlreichen Bezügen zu Jesus Sirach (siehe auch die anderen inhaltlichen und sprachlichen Verbindungen mit den Apokryphen und dem Corpus der aramäischsprachigen Literatur aus der Zeit des Zweiten Tempels; dazu unten unter „Biblische Referenzen“ sowie „Außerbiblische Traditionen“). Wenn man die Rahmenteile im Wesentlichen als spätere Fortschreibungen versteht (siehe zur Literarkritik), so ist eine Endredaktion in der Hasmonäerzeit nicht unwahrscheinlich.
EntstehungsortÜber den Entstehungsort der Erzählung liegt kein Forschungskonsens vor. Die einzelnen Motive ergeben ein buntes Bild, da sowohl babylonische als auch griechische Elemente vorhanden sind. Viele der Ausleger votieren für die östliche Diaspora als Ursprungsort, aber es gibt auch Stimmen, die für Jerusalem bzw. einen anderen Ort im Land Israel plädieren; zudem hat man an Ägypten gedacht.98 Eine Entscheidung ist nicht einfach zu fällen. Der bereits für die Grunderzählung gegebene Diasporabezug sowie die Häufung von Motiven, die in die östliche Diaspora verweisen (so v. a. Asmodäus, viele medizinische Vorstellungen und das Exorzismusritual, das Bestattungsmotiv, die positive Rolle des Hundes, die spezifische Ehekonzeption) können zwar durch die Annahme eines Motivtransfers erklärt werden; wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die östliche Diaspora, vermutlich Persien, tatsächlich als Herkunftsort des Stoffes zu gelten hat.99 Der Hinweis auf die fehlende Ortskenntnis des Autors100 oder die Motivverbindungen mit anderen aramäischen Texten aus der Zeit des Zweiten Tempels, die im Land Israel entstanden sind (so ein wichtiges Argument bei Devorah Dimant und Andrew B. Perrin), sprechen zumindest nicht eindeutig gegen eine Lokalisierung im Osten. Zum einen sind bei den antiken Autoren, die noch keine Atlanten u. ä. besaßen, keine exakten geographischen Kenntnisse als selbstverständlich vorauszusetzen; zum anderen erzwingen auch die Motivverbindungen mit den anderen aramäischen Texten nicht notwendigerweise eine Lokalisierung im Land. So empfiehlt es sich hier, eher die Argumente auszuloten, denn eine konkrete Festlegung zu machen.101 Die griechischen Versionen deuten durch die Verwendung von Spezialvokabular auf Alexandria als Ort der Übersetzung, zumindest aber auf einen hellenistisch gebildeten Autor (siehe zu 1,21f.; TA 11,12.13a-a).
MilieuDas Ethos des Buches passt sehr gut in das Jerusalemer Milieu der Weisheitslehre, wie sie durch den Siraziden vertreten ist. Wer weiß, vielleicht hat ein solcher Weisheitslehrer den Stoff auch von einer seiner Reisen mitgebracht (vgl. Sir 39,4) und dann mit einem starken Akzent auf der ethischen Unterweisung bearbeitet? Die Erzählung ist in jedem Fall in einem prosperierenden Milieu entstanden, in dem man sowohl mit den biblischen Traditionen, und zwar der Weisheit ebenso wie der Prophetie, aufs Engste vertraut war, als auch mit babylonischen und persischen Vorstellungen und der griechisch-hellenistischen Kultur im Kontakt stand.102 Eine Beziehung zur Familie der Tobiaden ist nicht auszuschließen, lässt sich aber nur schwerlich im Gesamtkontext der Überlieferung konkreter fassen (zu 1,1).