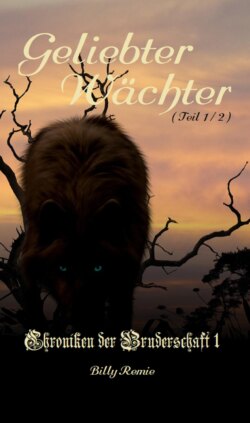Читать книгу Geliebter Wächter - Billy Remie - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9
ОглавлениеNach dem Essen schlug Xaith die Zeit bis zum Zubettgehen mit Malen tot.
Er malte wirklich sehr gerne, ob mit Kohle in sein Buch, das er immer unter seinem Mantel verbarg, oder mit Pinsel und Farbe auf einer schneeweisen Leinwand, die er mit düsteren Schattierungen bedeckte – der Spiegel seiner Seele, wie Wexmell einmal besorgt zu dem König geflüstert hatte, als Xaith gerade an ihrer Tür vorbei gegangen war. Vielleicht stimmte das, aber es ärgerte Xaith immer, wenn Wexmell versuchte, in ihn hineinzusehen.
Xaith mochte einfach das Malen, konnte Wexmell sich nicht damit abfinden? Musste er immer eine tiefe Bedeutung in allem sehen, was Xaith tat? Xaith wollte nicht reden, er wollte nur malen.
Jede Art, die sowohl seinem Verstand und Händen eine Beschäftigung gab, zelebrierte Xaith mit Leib und Seele. Beim Malen war er mit dem Herzen dabei, konnte alles ausblenden oder tiefe Gedanken ausdrücken.
Wer brauchte schon Worte, wenn er Bilder malen konnte.
Er zog zwei weitere Striche mit dem Pinsel und trat dann zurück. Ihm war warm, obwohl er den Mantel ausgezogen hatte und kein Feuer brannte. Mit dem Handrücken fuhr er sich über die Stirn, die unter seinen schwarzen Haaren schwitzte, und hinterließ eine rote Spur frischer Farbe auf seiner blassen Haut. Die wenigen Kerzen im Raum warfen flackerndes Licht auf seine lange, schlanke Kehle. Der Widerschein inspirierte ihn und ebenso sein verdammtes Verlangen.
In letzter Zeit hatten sich seine Bilder verändert. Er malte gern das, was ihm vor die Augen trat und er festhalten wollte. Seine Raben, wie sie sich gegenseitig mit den Schnäbeln das Federkleid putzten. Den Mond vor seinem Fenster, die Erinnerung an Galia, goldene Getreidefelder im Mondschein, ein düsterer Wald, nachts, erhellt durch frisch gefallenen Schnee. Dunkle und kalte Farben. Doch seit kurzer Zeit hatten seine Bilder keine klaren Linien mehr, zeigten keine Szenerien. Striche, Kratzer, viel Rot und Beige, wie Blut auf Haut. Viel Haut. Hände, Arme, Kurven, Augen, Lippen, Fänge – blutige Fänge. Purpurne Laken, ein nackter, sich räkelnder Leib, über den in filigranen Linien Blut floss und ihn schmückte.
Das frustrierte ihn, er hatte sich ablenken wollen, aber ganz gleich, was er anfing, alles lief auf denselben Gedanken hinaus. Auf die Ruhelosigkeit, die Hitze in ihm. Und erwachte erst der eine Hunger, wurde auch der andere in ihm laut.
Und nun war er nicht zufrieden mit seinem Bild, ihm fehlte die Leidenschaft, die er seit Wochen versuchte, aus seinem Inneren auf die Leinwand zu bringen. Dieses leise Summen in seinem Leib, das seine Eingeweide heftig vibrieren ließ und in den Venen brannte. Dieses unaufhörliche Summen, das langsam, aber stetig anschwoll, mal schlimmer, mal leiser, aber niemals verklang. Ein Hornissennest, das sich in seiner Selbstkontrolle eingenistet hatte, und jeder Einfluss von außen kam einem Stock gleich, der hineinstach. Ein Druck, eine Unruhe, ein Drängeln, das ihm jederzeit die Kontrolle über sich selbst kosten konnte. Und es war schwierig, sich davon abzulenken, denn sein Verstand schien wie besessen von diesem Prickeln in seinem Körper. Es war, als hätte er Hunger, großen Hunger, richtigen Heißhunger … aber ganz gleich was er aß und wie viel davon, nichts stillte diesen Hunger, nichts verschaffte ihm Befriedigung. Es würde schmerzen, er kannte es aus Erfahrung, wenn er sich nicht irgendwie davon ablenkte. Irgendwann wurde jeder Hunger zu Schmerz, wenn man ihn nicht stillen konnte. Und darauf war er gewiss nicht erpicht.
An jenem Abend war es wieder besonders schlimm, die Hitze stieg, er konnte keinen Augenblick ruhig sitzen, der Pinsel flog nur so über die Leinwand, verteilte rote Farbe ohne Sinn oder Verstand, nur Linien, die sich irgendwie fanden und verbanden, bis die Andeutung eines Rückens zu erkennen war, der Schwung eines wohlgeformten, kräftigen Hinterteils…
Als Xaith sich bewusstwurde, was er da malte, ging ein starkes Beben durch seinen Leib, woraufhin alles in seinem Inneren zu krampfen schien. Er keuchte, aber nicht vor Schmerz. Noch nicht.
Fluchend warf Xaith den Pinsel gegen die Leinwand und trat gegen die Staffelei, woraufhin alles polternd zu Boden fiel. Er wandte sich ab und lief unruhig in seinem Zimmer auf und ab, während er an seinem Hemd zerrte, als wollte er es sich vom Leib reißen. Er fächerte auf diese Weise Luft auf die glühende Haut und versuchte, zu atmen. Aber seine Gedanken schweiften ab, hefteten sich auf das Gefühl in seinem Körper, dem brüllenden Hunger in Brust und Lenden. Er hätte diesen Druck gerne herausgebrüllt, konnte sich mit tiefen Ein- und wieder Ausatmen jedoch langsam wieder beruhigen.
Er eilte zum Fenster und riss es auf, milde Luft strömte herein, brachte die Süße des Obstgartens mit ins Zimmer.
Xaith blieb im Luftzug stehen und drehte dem Raum das Gesicht zu. Seine Gemächer waren nichts Besonderes. Sie waren kleiner als die seiner Geschwister, ein winziger Raum, der mit Möbeln aus schwarzem Holz vollgestopft war. Das große Bett dominierte den Raum, es stand mit dem schwarzen Kopfteil mittig an der Wand gegenüber dem Kamin. Neben dem Kamin drängten sich Kommode, Schreibtisch und Staffelei an die Wand. Auf dem Bett lagen purpurne Samtdecken und -kissen. Er hasste das Gefühl von Seide auf der Haut.
Aber so klein der Raum auch sein mochte im Vergleich zu den anderen, liebte er ihn. Das hier war sein Heiligtum. Und es behagte ihm nicht, daran zu denken, morgen aufzubrechen und diesen sicheren Hafen zu verlassen. Ohne seine Leinwände und Farben.
Was, wenn ihn der Hunger überkam, während sie unterwegs waren? Sicher, es gab Kräutertees und Weine, die den Drang lindern konnten. Bei Riath war der Trieb ein Jahr zuvor erwacht und er hatte sich mit Kräutertees und, oder viel Wein betäuben können. Mittlerweile gab es genug willige Leiber, bei denen er seinen Hunger stillte.
Auf Letzteres konnte Xaith nicht zurückgreifen, nicht einmal ein Troll würde freiwillig in sein Bett steigen, und das nicht einmal deshalb, weil er mächtig und unberechenbar war. Nein, sondern allein wegen seinem Gesicht. Er war nicht hübsch genug. Davon mal gesehen hatte Riath ohnehin alles Willige bereits für sich beansprucht. Jeder wollte Riath. Jeder.
Xaith blieben nur die Alternativen, um seinen Hunger zu kontrollieren. Aber Wein und die Kräuteraufgüsse der Hexen halfen bei ihm nicht so gut wie sie Riath halfen. Er litt trotzdem unter dem Trieb. Dem Verlangen, Blut zu trinken, und dem Verlangen, sich zu paaren. Denn das eine ging mit dem anderen einher. Wollte er Blut, schwoll auch gleichzeitig das Summen seines Triebes an, der Druck in seinen Lenden, das Prickeln in seiner Eichel. Und war er erregt, erwachte auch gleichzeitig der Hunger in seiner Brust.
Und diese Hitze! Er hatte sich bereits zwei große, dunkle Flecke unter die Achseln geschwitzt. Es schien keine Linderung zu geben. Manchmal, wenn das Summen laut wurde und sein verräterischer Verstand sich nur darauf konzentrierte, als lechzte er danach, ihn in eine wahnsinnig gewordene triebgesteuerte Bestie zu verwandeln, war Xaith danach, den Kopf gegen die Wand zu schlagen, bis er ohnmächtig wurde und jegliches Gefühl in ihm verstummte.
Seit Tagen schlief er wieder nicht, weil ihn die Unruhe sich umherwälzen ließ, mit einer gierigen Kehle, die nach Blut verlangte, und einem steinharten Schwanz, den niemand wollte. Auch jetzt pochte seine Härte in der Hose, und mit jedem Pochen schien sie schreiend zu verlangen, dass eine Hand sie berührte. Oder ein Mund. Oder … was auch immer. Ein Federstreich hätte wohl genügt. Aber aus Erfahrung wusste Xaith, dass es dadurch nicht besser wurde. Im Gegenteil, immer wenn er sich mit eigener Hand Erleichterung verschaffen wollte, war das Prickeln hinterher stärker, das Summen war zu einem Pulsieren geworden, und er wollte mehr, brauchte mehr, immer mehr.
Ihm war manchmal danach, sich mit den Fingernägeln die Haut abzuziehen, in der Hoffnung der Schmerz würde ihn von diesem Drängen nach Blut und Fleisch befreien.
Tatsächlich fing er an, sich die Kehle und die Leiste zu kratzen. Als er sich dessen bewusstwurde, zwang er seine Hände nieder und schritt entschlossen auf die Tür zu. Er konnte nicht mehr, er brauchte Linderung. Vielleicht würde ihm ein Bad in den unterirdischen Becken der Festung guttun. Er schnappte sich seinen Mantel vom Bett, bevor er sein Zimmer verließ.
Der Flur vor seinen Gemächern war breit und hoch, kahles Gemäuer, alle zehn Schritte eine Fackel an der Wand, massive Holztüren und ein blutroter Teppich.
Er schlüpfte in seinen Mantel, stellte den Kragen hoch und marschierte los, an Riaths Tür vorbei, die direkt neben seiner lag. Sie war geöffnet und Stimmen drangen daraus hervor.
»Was hast du dir dabei gedacht?«
Xaith trat einen Schritt zurück, lehnte sich an die Wand und lauschte, während sein Bruder Ärger von seiner Mutter bekam.
»Du Nichtsnutz!«, herrschte sie ihn mit ihrer melodischen Stimme an. Xaith sah sie im Geiste vor sich, groß, schlank und kurvig, ein echtes Vollweib mit dicken Lippen, verruchten Augen und leuchtend rotem Haar. Hexen waren schon immer sehr anziehende Wesen gewesen, aber Riaths Mutter war wirklich umwerfend schön. Zusammen mit den starken, männlichen Genen des Königs war daraus natürlich ein Kind entstanden, das ebenso gut ein Gott der Schönheit und Perfektion hätte sein können. Ein Gott purer Männlichkeit. Groß, kräftig, anmutig und strotzend vor Schönheit.
Es war so ungerecht.
»Ich tue nur, was du von mir verlangst, Mutter!«, antwortete Riath. Seine sonst charismatische, wohlklingende Stimme besaß einen rauen, müden Ton.
»Das tust du nicht!«, zischte Riaths Mutter ihn giftig an. »Du sollst ihn beeindrucken, Riath! Nicht enttäuschen! Du hast so großes Potential, sein Nachfolger zu werden. Du musst ihn davon überzeugen!«
»Ich tue mein Bestes, Mutter!«, rief Riath zurück, er klang aufgebracht, als würde sie ihm schon eine Weile Vorträge halten. »Was soll ich denn machen? Der Hengst ging mir durch!«
»Du hättest dich mehr anstrengen müssen! Jetzt ist er enttäuscht!«
»Er ist enttäuscht, gerade ja weil ich den Hengst wollte!«
»Du hättest beweisen müssen, dass du das Biest trotzdem reiten kannst, Riath! Bei den Göttern, wie schwer kann das sein? Einen Hengst reiten! Mehr solltest du nicht tun, nur einen Hengst reiten! Alles, was ich von dir verlange, ist, dass du dich vor dem König beweist. Du willst doch König werden, oder nicht? Oder nicht?« Letzteres sagte sie so drängend, als hätte Riath lange geschwiegen, obwohl sie ihm keine Gelegenheit gelassen hatte, etwas zu erwidern.
Kleinlaut antwortete Riath: »Ja, Mutter.«
»Dann streng dich gefälligst mehr an!« Es klatschte leise, als hätte sie ihm leicht ins Gesicht geschlagen. Nicht, um ihn zu ohrfeigen, sondern damit er zu ihr aufsah, wie sie es immer tat, wenn er ernüchtert zu Boden starrte. »Reiß dich zusammen, Riath! Du darfst nicht versagen! Du musst deine Geschwister ausstechen. Verstanden?«
»Ja, Mutter…«
Obwohl Riath nur noch willenlos zuzustimmen schien, war seine Mutter immer noch in Rage und hielt ihm weiter Vorträge. Dabei klang ihre Stimme mal weiter entfernt und mal näher, als wanderte sie Hände ringend vor ihm auf und ab.
»Was soll bloß aus dir werden? Wenn er dich nicht zu deinem Erben ernennt, was willst du dann tun? Liegt dir nichts an deiner Zukunft? Oder an meiner?«
»Doch, Mutter…«
»Wenn du die Krone nicht erbst, bist du ein Niemand, Riath. Du kannst ja nicht einmal zaubern. Obwohl ich deine Mutter bin!«
»Es tut mir leid, Mutter…« Dieses Mal klang er äußerst gekränkt.
Es war kein Geheimnis, dass Riaths Mutter äußerst enttäuscht darüber war, dass Riath nicht zaubern konnte, obwohl sie selbst eine mächtige Hexe war. Und sie ließ ihre Enttäuschung Riath ganz deutlich spüren.
Xaith hatte tatsächlich Mitleid mit seinem Bruder.
»Das Einzige, was dir bleibt, ist dein Aussehen und deine Stärke. Du taugst nur zum König, da dir die Magie fehlt. Also sorge dafür, dass du deinen Vater von dir überzeugst!«
»Ich gebe mein Bestes, Mutter.«
»Das ist nicht genug. Streng dich mehr an, das ist kein Spiel mehr, Riath!«
Kopfschüttelnd löste sich Xaith von der Wand und huschte an der Tür vorbei. Genau wie vermutet saß Riath auf der Bettkante, Schultern und Kopf hinabhängend und zutiefst beschämt, während seine werte Frau Mutter in einem prunkvollen schwarzen Kleid vor ihm auf und ab ging und ihm Vorträge hielt.
Armer Riath, er hatte es nicht leicht. Die Mutter striezte ihn, seit er laufen konnte, aber der König erwartete von ihm etwas gänzlich anderes. Charakterliche Größe. Das fehlte Xaiths Bruder allerdings, weil er sich nur darauf konzentrierte, jeden zu übertrumpfen und sich als der Beste in so ziemlich allem zu beweisen. Immerhin hatte ihm sein Ehrgeiz eine Menge Ruhm eingebracht, und natürlich lechzte er nach dieser Art von Aufmerksamkeit und bildete sich etwas darauf ein, dass das Volk ihn liebte, weil er jedes Turnier gewann, seit er Alt genug war, mitzumachen, und zudem auch noch dieses ätzende, strahlende Lächeln besaß, das es unter jedem Rock feucht und in so manchen Hosen hart werden ließ.
Doch auch wenn Xaith Riath verstehen konnte, war er von dessen Arroganz trotzdem mächtig genervt. Riath glaubte, er konnte jeden haben. Jeden. Wirklich absolut jeden. Und er nahm an, für ihn gäbe es keine Grenzen. Keine Regeln. Keine Gesetze.
Außerdem hatte er den größten Teil dazu beigetragen, dass Xaith sich am liebsten das Gesicht abgezogen hätte, weil er es so sehr verabscheute. Riaths liebste Bezeichnung für Xaith war »Beulenpestfresse«, aber er mochte auch die weniger kreative Beleidigungen »Höhlentroll« und »Kratergesicht«.
Xaith hörte schon gar nicht mehr hin. Zumindest redete er es sich ein. Sein Selbstvertrauen konnte er jedoch nicht belügen, Riath tötete es immer wieder, wenn er ihn derart betitelte. Was Xaith ihm natürlich nie zeigen würde, diese Genugtuung würde Riath nie von ihm bekommen.
Als Xaith endlich in den Gewölben ankam, riss er sich förmlich den Mantel vom Leib. Hätte er kein Hemd darunter getragen, hätte das Leder vermutlich an seiner schwitzigen Haut festgeklebt.
Die Becken waren von Säulen umringt, wasserspeiende Nachtschattenkatzen – in Nohva heimische Raubkatzen, die für Xaith wie schneeweiße, hundsgroße Füchse aussahen, mit giftigen Fängen – sorgten für frischen Wasserzufluss. Fackeln und Feuer erhellten den Raum, das klare Wasser warf wellenförmige Lichtspiele auf die kahlen Gesteinswände und die Decke.
Xaith riss das offene Hemd aus dem Hosenbund und wollte sich die Schuhe mit den Füßen abstreifen, als er es platschen hörte. Verwundert hielt er inne und lauschte.
Mehr Plätschern ertönte, ganz sacht und ruhig, als würde jemand mit den Füßen in das Wasser eintauchen. Immer und immer wieder.
Langsam, damit seine Schritte keine Geräusche verursachten, schlich er um eine der dicken Steinsäulen herum und spähte in das Mosaikbecken. Auf der anderen Seite des Gewölbes schwamm jemand im Wasser.
Vaaks.
Xaith erkannte ihn sofort, auch wenn er nur dessen Rückseite erblickte. Das dunkelbraune, lockige Haar, das sich in seinem feuchten, starken Nacken kräuselte. Seine breiten Schultern, deren Muskulatur unter der straffen, samtenen Haut während der Schwimmbewegungen spielte. Die Muskelberge seiner Arme, über die das klare Wasser schwappte. Die riesige Fläche seines V-Förmigen Rückens, die Grübchen in seiner Taille und sein wohlgeformtes, festes Gesäß, als er untertauchte und sich unter Wasser drehte, um die gleiche Strecke zurückzuschwimmen.
Xaith zog sich lautlos hinter die Säule zurück, als Vaaks in seine Richtung kam, und hielt die Luft an. Nicht, dass Vaaks` stumpfes Menschengehör ihn hätte atmen hören können, aber nun, da Xaith wusste, dass er im Raum war, konnte er auch dessen Duft überdeutlich wahrnehmen. So frisch, so kalt, mit einem leichten Hauch von Herbstlaub, wie ein Wald, der vom ersten Schnee erfasst wurde.
Und das brachte sein Innerstes wieder zum Summen.
Er lauschte auf die leisen Wasserbewegungen, die langsam immer näherkamen, und hoffte, dass Vaaks nicht den Schatten bemerkte, den die Fackeln hinter der Säule auf den Boden warfen.
Erst als er vernahm, wie Vaaks sich wieder entfernte, wagte er es, um die Säule herum zu linsen und erneut dessen kräftiger Rückenmuskulatur zuzusehen, wie sie sich unter der makellosen Haut bei jedem Armzug bewegte.
Erstaunlich wie Vaaks in den letzten sechs Monaten gewachsen war. Nicht nur in die Höhe, auch in die Breite. Das harte Kampftraining, das sie allesamt mit dem Orden des Königs absolvierten – den drei Elitesoldaten der Krone – zeigte bei Vaaks die deutlichsten Spuren. Seine Muskeln waren … beachtlich.
Hin und wieder fragte Xaith sich, ob dessen Vater, der legendäre Drachenreiter, ebenfalls solch eine Statur besessen hatte. So voller … Kraft! Diese eisenharte Muskelberge an Armen und Brust, die leichtschwingenden Hüften bei jeder Bewegung, diese gigantischen Ausmaße, ohne dabei unproportioniert auszusehen. So stark waren nur die Südländer Nohvas, so … begehrenswert.
Aber Xaith hatte schon eine krankhafte Obsession gegenüber Vaaks empfunden, als dieser noch ein schlaksiger Junge gewesen war. Er konnte sich nicht erinnern, sich jemals nicht nach Vaaks verzehrt zu haben.
Das machte das Sehnen nicht besser. Je mehr Zeit verging, je schlimmer wurde die Sehnsucht.
Doch er hatte sich trotz aller heimlicher Gefühle nie getraut, auf Vaaks zuzugehen. Es erschien ihm falsch, sie wuchsen wie Brüder auf. Vaaks sah ihn als Bruder. Davon abgesehen würde Vaaks ihn ohnehin nicht wollen. Sicherlich wäre er höflich, wenn er ihn abwies, Vaaks war ein guter Kerl, er würde niemals lachen. Trotzdem, auch eine nette Zurückweisung war eine Zurückweisung.
Xaith litt lieber im Stillen und Geheimen, damit niemand von seiner sinnlosen Besessenheit ahnte. Wüsste Vaaks, was er empfand, würde er sich vermutlich aus Scham die Klippen hinter der Festung runterstürzen.
Nein, es wäre ihm unheimlich peinlich, würde Vaaks wissen, dass er immerzu an ihn dachte, zärtlich an ihn dachte, wie er sonst an nichts dachte. Es war einfacher, sich hinter einer dicken Mauer aus Eis zu verstecken. Oder Stein. Stein war die bessere Metapher, Stein konnte nicht schmelzen.
Aber niemand konnte Xaith verbieten – vor allem er sich nicht selbst – vom Rande aus zuzusehen, immerzu Vaaks hinterher zu blicken, zu verfolgen, aus der Ferne zu begehren. So wie in diesem Moment, als er ihn »ganz für sich allein« hatte und seinen feuchten, kraftvollen Körper in sich aufsaugen konnte.
Dass er damit das Summen in seinem Inneren verstärkte war ihm einerlei. Lieber litt er Schmerzen als sich von dem Anblick des schwimmenden Vaaks abzuwenden. Wie seine dicken Locken sein Gesicht einrahmten, schwer von der Feuchtigkeit des Wassers. Zu gerne hätte er eine davon auf einen Finger gewickelt und sie ihm hinter das Ohr gestrichen.
Ein Wunsch, der immer ein Traum sein würde. Ein schöner, gewagter Traum, der all sein Leiden nur verschlimmerte, je öfter er ihn träumte.
Und er träumte ihn oft, wann immer eine dieser dunklen Locken in Vaaks` Gesicht fiel.
»Wie lange willst du dich noch in den Schatten verstecken?« Vaaks dunkle aber immerwährend ruhige, monotone Stimme ließ Xaiths Tagtraum zerplatzen.
Instinktiv zog Xaith sich wieder hinter die Säule zurück und versteckte sich. Sein Herz pochte aufgeregt in seiner schmalen Brust.
Vaaks` leises, amüsiertes Lachen hallte leise von den Wänden wider und schien Xaiths Innerstes zum Brummen zu bringen. »Hör auf, dich zu verstecken, zieh dich aus und komm ins Wasser.«
Xaiths Herz machte einige lange Aussetzer, ehe es vor Freude doppelt so schnell schlug. Alles, was er gehört hatte, war »zieh dich aus« und »komm ins Wasser«. Ein Teil von ihm – jener, zu dem auch das Summen gehörte – wollte sich die Kleider vom Leib reißen und zu Vaaks ins Wasser springen. Der andere Teil von ihm, der Vernünftige, traute sich nicht einmal hinter der Säule hervor, geschweige denn mit diesem Gesicht zu Vaaks in das Wasser zu steigen. Das Wasser würde das helle Puder abwaschen, das er immer auftrug, um wenigstens etwas von seiner katastrophalen Haut zu kaschieren. So wollte er sich niemandem zeigen.
Und doch, Vaaks` leises Lachen und seine Forderung waren zu verlockend, so offen hatte er Xaith noch nie angesprochen. Konnte es sein, dass Vaaks sich über seine Anwesenheit freute?
Xaiths Herz flatterte erregt. Er könnte sich ja die Stiefel ausziehen und die Beine ins Wasser hängen, während Vaaks weiter schwamm. Dann müsste er auch nicht mehr wie ein Irrer im Schatten stehen und so tun, als wäre er nicht aufgeflogen.
Ja! Genau! Das könnte er tun. Xaith lächelte und trat um die Säule herum, während er gerade kontern wollte: »Du hast mich erwischt.« Da ertönte jedoch ein anderes Lachen im Gewölbe. Sanfter und melodischer als sein eigenes je sein könnte.
»Du lässt einem aber auch keine Freude«, sagte der Eindringling eine Spur zu sehr verrucht, »es war solch ein Vergnügen, dir zuzusehen.«
Xaith zog sich wieder hinter die Säule zurück. Es war Fenjin, der an das Becken trat und sich das Hemd vom Kopf riss. Vaaks hatte ihn bemerkt und zu sich gerufen. Deshalb hatte seine Stimme so locker und freudig geklungen. Die Freude galt Fenjin, nicht Xaith.
Xaith kam sich wie der größte und dümmste Narr vor, weil er auch nur einen winzigen Augenblick geglaubt hatte, die Einladung könnte ihm gelten. Und am meisten schämte er sich dafür, dass sich sein verräterisches Herz danach sehnte, er könnte ein Teil von dem werden, was die beiden bereits hatten. Er wusste mit einer ernüchternden Gewissheit, dass er das nie sein würde. Nie.
*~*~*~*
»Gewonnen!« Vaaks klatschte die nasse Hand auf den kantigen Beckenrand und zog sich mit einem Arm heran.
Japsend holte Fenjin auf, das ahornrote Haar feucht im sanften Gesicht klebend. »Das ist nicht gerecht«, keuchte er, »mit diesen Armmuskeln bist du mir im Wasser deutlich überlegen.«
Vaaks grinste. »Was denkst du, woher diese Muskeln kommen? Du musst sie einfach öfter beanspruchen.« Er wandte sich ab, als Fenjin in seine Reichweite kam, und legte beide Arme auf den Beckenrand, während sein schwerer Körper im Wasser schwebte. Feuchtigkeit tropfte von seinem Gesicht auf seine breiten Unterarme, in seinen Muskeln spürte er das Wettschwimmen gegen Fenjin als leichtes Brennen.
»Verzeiht, mein Prinz, aber ich stamme nicht aus den Bergen und habe das Blut von Giganten in meinen Adern, das dafür sorgt, dass jede Bewegung meines Körpers meine Muskeln in Berge verwandelt«, scherzte Fenjin ohne jeden Hauch von Bitterkeit und zog sich dicht neben Vaaks an den Beckenrand. Sogar im Angesicht einer Niederlage grinste er noch breit und froh, als könnte nichts und niemand ihm den Frohsinn stehlen.
Deshalb war es so einfach und wohltuend, mit Fenjin Zeit zu verbringen, seine gute Laune war stets ansteckend und er lenkte Vaaks auch von den dunkelsten Gedanken ab.
Vaaks lächelte nachsichtig. »Ich bin kein Prinz.«
»Natürlich bist du das«, konterte Fenjin trocken und winkte ab, als wäre es eine unleugbare Tatsache, gegen die Vaaks nichts unternehmen konnte. »Im Übrigen schleppe ich jeden Tag Kisten, von morgens bis abends, im Lager meines Vaters, und ich habe nicht ansatzweise solche Arme wie du!«
»Was ist in den Kisten? Federn?« Vaaks grinste seinen Freund neckend an.
Dieser brauchte einen Moment, bis er begriff. Dann runzelte er gespielt verärgert seine Stirn und stieß Vaaks den spitzen Ellenbogen in die Rippen.
Er spürte es kaum, seine Muskeln beherrschten auch diesen Bereich und boten für jeden Rippenstoß eine hervorragende Rüstung.
»Was sind wir heute wieder lustig.« Doch Fenjins Spott klang plötzlich leer und trostlos.
Verwundert betrachtete Vaaks das sanfte Profil seines besten Freundes, der plötzlich nachdenklich geworden war. Eine Seltenheit bei ihm, es plagten ihn beinahe nie Sorgen. Zumindest ließ er sie sich nie anmerken.
»Was ist los?«, wollte Vaaks wissen und wappnete sich innerlich gegen alles von »wir können uns nicht mehr sehen« bis hin zu »mein Vater und ich verlassen Nohva für immer«.
Doch Fenjin schüttelte den Kopf, sah ihn an und setzte ein Lächeln auf. »Ach, nichts … nicht so wichtig.«
»Fenjin«, tadelte Vaaks liebevoll seinen alten Freund, »du kannst vielleicht deinem Vater etwas vormachen, aber nicht mir!«
»Ich habe nicht gesagt, es wäre nichts«, hielt Fenjin altklug dagegen, »nur, dass es nicht so wichtig ist.«
Vaaks runzelte mitfühlend die Stirn. »Es beschäftigt dich offensichtlich, also ist es mir wichtig. Kann ich dir helfen?«
»Ach nein…« Fenjin rang offensichtlich mit sich selbst, er bewegte den Kopf hin und her, dann seufzte er schwer. Er zog sich auf den Beckenrand, triefend nass, und setzte sich neben Vaaks, mit den Beinen im Wasser. Seine Unterhose, die er anbehalten hatte, klebte wie eine zweite, faltige Haut an ihm. Mit einer Hand strich er sich das feuchte, rote Haar aus der Stirn, in seinen zimtbraunen Augen konnte Vaaks die Spiegelung der Fackeln im Wasser beobachten.
Fenjin grinste ihn an. »Willst du nicht wissen, wie ich es immer an den Wachen vorbeischaffe?«, fragte er, offensichtlich um das Thema zu wechseln.
Vaaks konterte trocken: »Du belädst den Wagen für die Vorräte des Königs mit ein oder zwei Weinfässern zu viel, wenn sie die Bestellung bei deinem Vater abholen, dafür sehen sie dich nicht, wenn du unbeholfen an ihnen vorbei schleichst.«
Fenjin ließ enttäuscht die schmalen Schultern hängen. »Habe ich dir das mal erzählt?«
»Der König hat die Wachen beim Saufen erwischt, und sie haben keinen Augenblick gezögert, dich zu verpetzen.«
Fenjin fluchte verhalten. »Waschweiber, diese…«
Aber Vaaks lachte nur leise. »Ach, Vater ist es ohnehin lieber, wenn du dich reinschleichst, statt dass ich mich rausschleiche. Genau genommen müsstest du dich gar nicht hineinschleichen.«
Mit leicht offenstehenden Lippen sah Fenjin auf ihn hinab. »Und du sagst mir nichts davon? Ich bezahle diese Wachen seit Jahren mit Weinfässern! Ich muss immer die Bücher fälschen, damit mein Vater nichts spitzbekommt!«
»Na ja«, Vaaks zuckte schmunzelnd mit den Schultern, »aber was sollen dann die Wachen trinken?«
Fenjin verengte die warmen Augen zu schmalen Schlitzen und bedachte Vaaks mit einem halbernstgemeinten giftigen Blick.
Dann wurde sein Ausdruck weicher und er lächelte beinahe liebevoll, als er die Hand ausstreckte und eine dicke Locke aus Vaaks` Gesicht zupfte, um sie ihm sacht nach hinten zu streichen. »Dein Vater ist ein guter Mann, weißt du das eigentlich?«
»Er ist ein guter König«, stimmte Vaaks zu.
»Nachdem meine Mutter an einer Lungenentzündung starb, musste ich mit meinem Vater gemeinsam auf Reisen gehen, um Waren zu verkaufen. Mein Vater war damals ein Nichts«, Fenjin sagte dies mit einem leisen, freundlichen Lachen, »wir hatten nichts und hatten auch nichts Besonderes anzubieten, wir waren Nomaden, selbst das Haus mussten wir verkaufen. Bis eines Tages der König an unserem winzigen Stand hielt und einen Schluck von dem wohl schlechtesten Wein ganz Nohvas – ach was, ganz Bleyquinnts, kosten wollte. Der Wein war so schlecht, der König hatte sich daran verschluckt. Meinem Vater war es unsäglich peinlich, aber der König lachte nur und wollte das Fass wirklich kaufen. Er sagte, jeder König hätte den besten Wein, somit wäre er der einzige König, der den schlechtesten hätte. Und damit hätte er auch etwas, was er seinen Feinden vorsetzen könnte. Er kaufte das Fass, wollte mehr als üblich zahlen, doch mein Vater war zu stolz, dies anzunehmen. Also blieb es bei diesem Fass. Doch der König kam wieder, kaufte immer wieder ein Fass, und lud uns irgendwann auf die Festung ein. Mein Vater konnte sich durch die Einnahmen immer bessere Waren leisten, so wurde sein Geschäft größer und beliebter. Und heute ist er der persönliche Lieferant der Krone. Er ist so stolz darauf, obwohl es mehr der Gutmütigkeit deines Vaters zu verdanken war, und großem Glück, statt dem Verdienst meines Vaters.«
Vaaks nickte. »Ich kenne die Geschichte.«
Mit einem trostlosen Lächeln ließ Fenjin den Kopf hängen und blickte in das Wasser. »Ja… er ist so stolz auf das, was er erreicht hat… und jetzt will er, dass sein einziger Sohn …« Fenjin hielt kurz inne, schloss die Augen und atmete tief durch. »Er will, dass ich mich vermähle.«
Für einen Moment rührte sich nichts bis auf die leichten Wellen auf der Wasseroberfläche. Langsam atmete Vaaks ein und wieder aus, er wandte den Blick ab und starrte an die Wand.
»Hm«, war das einzige, was er hervorbrachte.
Er spürte Fenjins unsichere Augen auf seinem Profil.
»Er hat ein paar … Fräuleins aus guten Familien im Blick, und hat sich mit ihren Vätern zusammengesetzt…«
»Der König hat Zwangsehen verboten.« Es war das einzige Argument, das Vaaks in den Sinn kam. Noch immer starrte er an die Wand mit den Fackeln und ließ nicht erkennen, was er fühlte.
Er wünschte, er wüsste es selbst. Es war ihm unmöglich, in diesem Moment seine Gefühle zu ordnen.
Fenjin nickte. »Deswegen hat mein Vater ja auf mich eingeredet…« Er verstummte, wandte das Gesicht ab und nagte nervös an seiner Unterlippe.
»Wirst du es tun?«
Fenjin sah in die andere Richtung, als Vaaks nun wagte, ihn anzublicken. Statt einer Antwort platzte er leise heraus: »Ich mag Jungen, Vaaks.« Dieses Geständnis kam beinahe so schnell über seine Lippen, dass es sich wie ein einziges Wort anhörte. Ichmagjungenvaaks.
Für einen Moment, der beiden wie eine Ewigkeit erschien, lag Schweigen zwischen ihnen. Und Vaaks kam es vor, als täte sich zwischen ihnen ein Krater auf, der immer tiefer und breiter wurde, je länger er nichts dazu sagte.
Vaaks atmete tief durch und beruhigte sein aufgeregtes Herz. Dann stemmte er beide Hände auf den Beckenrand und hievte sich hoch. Er rückte nahe an Fenjin heran, ohne ihn zu berühren, aber nahe genug, dass es sich anfühlte, als würde seine Haut auf Fenjins liegen.
Fenjin sah verwundert und gleichwohl voller Befürchtungen auf.
Mit einem nachsichtigen Lächeln nahm Vaaks seinem Freund die Ängste. »Weiß ich doch«, erwiderte er und stieß ihn mit der Schulter an.
Fenjin erwiderte das Lächeln jedoch nur flüchtig und wandte dann den Blick wieder nachdenklich in das Wasser.
»Du solltest es ihm sagen«, ermutigte Vaaks seinen Freund. »Deinem Vater. Ich kenne ihn, er wird es verstehen. Er liebt dich. Du bist alles, was er noch an Familie hat. Für dich würde er alles tun. Wenn du ihm sagst, was du willst, wird er es verstehen.« Vaaks war sich sicher, dass Fenjins Vater alles akzeptieren würde, nur nicht, wenn sein Sohn das Geschäft nicht übernehmen würde wollen. Es war das Einzige, was er sich wirklich von Fenjin erhoffte.
Fenjin nickte langsam.
»Was ist mit dir?«, wollte er dann leise wissen, als hoffte er, Vaaks könnte die Frage nicht verstehen. »Haben deine Väter für dich …«
»Das überlassen sie uns selbst«, unterbrach Vaaks ihn und zuckte mit den massigen Schultern, als Fenjin ihn betrachtete. »Nun ja, ich bin ja auch kein Erbe von irgendwas.«
Fenjin musterte sein Gesicht und sein Blick wurde ganz warm. »Könntest du aber werden.«
Dafür hatte Vaaks nur ein Schnauben übrig. Erstens war er kein leibliches Kind des Königs. Zweitens wollte er gar nicht die Krone erben. Wenn es nach ihm ginge, durfte Riath sie gerne haben, aber am liebsten war es ihm ohnehin, wenn Desiderius sie behielt. Denn wenn der Tag kam, an dem die Krone einem seiner Kinder aufgesetzt wurde, war es auch der Tag, an dem er starb.
Und daran wollte Vaaks nicht denken. Außerdem war Vaaks ein Mensch unter Luzianern. Wenn der König in ein paar Jahrhunderten starb, war Vaaks schon längst tot. Was die Frage, ob er die Krone erben könnte, geradezu absurd werden ließ.
Fenjin wurde wieder still und bewegte langsam die Beine im Wasser, als wollte er paddeln, die Handballen auf die Kante des Beckenrandes gesetzt und die Schultern hängend. »Wie lange werdet ihr wohl unterwegs sein?«
»Keine Ahnung.« Vaaks überschlug die Dauer der Reise im Kopf. »Ein paar Monate, ein halbes Jahr?«
Fenjin zog traurig die Stirn kraus und fing an, seine Hände nervös zu reiben. »Es bereitet mir Sorgen, dass du so lange fort bist.«
Seufzend ließ Vaaks sich zurückfallen. Der Boden war klamm und kalt, als er mit dem Rücken darauf lag, er strich seine dunkelbraunen Locken aus der Stirn und ließ die Hand in seinem Haar stecken. »Ist doch nur eine Reise zu einem Friedenstreffen. Was soll schon passieren, außer, dass ich ohne dich vor Langeweile umkomme.«
»Jede Reise ist gefährlich.« Fenjin drehte sich zu ihm um, aber Vaaks hatte die Augen geschlossen, Erschöpfung legte sich über ihn, und die zimtbraunen Augen seines Freundes fuhren spürbar über sein Gesicht. »Aber das meinte ich gar nicht.«
»Was meintest du dann?«, murmelte Vaaks schläfrig. Er wollte gar nicht an den morgigen Tag denken, denn es fiel auch ihm schwer, sich die lange Zeit ohne Fenjin vorzustellen. Bei wem sollte er Zuflucht suchen, wenn er sie brauchte? Er kannte Fenjin mittlerweile besser und auf eine andere Art tiefer als seine Brüder und seine Schwester. Aber er würde es schon überstehen, so wie alles. Vaaks verzweifelte nie, er stellte sich den Problemen, wenn es soweit war.
Fenjin brauchte eine Weile, bis er antwortete, und Vaaks glaubte schon, er würde dazu überhaupt nichts mehr sagen, als er sich plötzlich neben ihn legte und ihm entschlossen gestand: »Ich bin verliebt, Vaaks. Du weißt, in wen.« Letzteres sagte er mit einer Spur Verzweiflung in der Stimme, als wäre Vaaks der einzige, der ihm jetzt noch helfen könnte.
Vielleicht war dem auch so.
Vaaks öffnete langsam die Augen, sein Herz hatte bei diesem Geständnis ein flüchtiges, aufregendes Gefühl verströmt, aber das ließ er sich nicht anmerken. Er starrte einfach nur in Fenjins Augen, die dicht über seinem Gesicht schwebten. Sehnsüchtig und gleichwohl ängstlich sah sein Freund ihn an.
Dann legte Fenjin ihm eine Hand auf die Brust, direkt über dem Herzen. »Denk bitte daran, wenn …«, er lächelte traurig, »…wenn du unterwegs bist. Denk daran, dass ich … dass es mir auch so geht.«
Vaaks runzelte die Stirn, aber Fenjin erläuterte nicht, was er damit insbesondere gemeint hatte. Doch Vaaks spürte, dass es ihm nicht nur darum ging, dass er während der Reise an ihn dachte. Nein, es ging nicht um die Reise.
Fenjin schien auf etwas zu warten, er blickte Vaaks eine Weile schweigend aber hoffnungsvoll an. Die Hoffnung sickerte jedoch Tropfen für Tropfen aus seinem Gesicht, wie Wasser aus einer offenen Hand, je mehr Augenblicke verstrichen.
Nichts geschah, niemand bewegte sich, keiner von ihnen sagte ein Wort.
»Ich fürchte mich nicht, es dir ehrlich zu sagen, aber ich hätte nie den Mut … du weißt schon«, flüsterte Fenjin, brach jedoch ab und senkte ernüchtert den Blick.
Vaaks unterdrückte ein Seufzen und den Drang, Fenjins rotes Haar von seiner nassen Stirn zu streichen.
Mit einem letzten sehnsuchtsvollen Blick wandte Fenjin sich ab, sammelte seine Kleider auf und tappte aus dem Gewölbe. Noch einmal sah er sich über die Schulter, Vaaks blieb liegen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Die Stelle, wo Fenjins Hand gelegen hatte, fühlte sich an, als ob dieser sie noch immer berührte. Warm und prickelnd.
Vaaks sah nachdenklich seinem Freund nach, während dieser in den Schatten des dunklen Flures verschwand.
Dessen Geständnis über seine Gefühle hatten Vaaks nicht überrascht, er war sich dessen bewusst. Vermutlich waren sich alle dessen bewusst, doch sie selbst hatten noch nicht darüber gesprochen. Den Grund für Vaaks` distanziertes Schweigen wollte er jedoch lieber nicht tiefer ergründen. Es gibt Türen in der Seele, die man besser nicht öffnete. Was Fenjin ersehnte, schien für Vaaks schlicht unmöglich, mochte er auch noch so oft selbst davon träumen. Denn auch ihm fehlte in dieser Sache der nötige Mut, um es beim Namen zu nennen.
*~*~*~*
Die Küche war leer und dunkel, nur das Feuer der Esse sorgte für flackerndes Licht in dem großen, länglichen Raum. Zwei Küchenmägde waren stets anwesend, falls die Königsfamilie etwas aus der Küche brauchte, doch Xaith hatte sie rausgeschickt. Zunächst wollten sie darauf bestehen, ihm etwas zuzubereiten und auf seinem Gemach oder wo auch immer er essen wollte zu servieren, doch er hatte den beiden jungen, dummen Gänsen ihr Unbehagen ihm gegenüber ansehen können. Er hatte den Schweiß auf ihrer Haut gerochen, der nach Abscheu gestunken hatte, weil sie ihn abstoßend fanden. Trotzdem wollten sie ihm freundlich in den Arsch kriechen, nur weil er der Sohn des Blutdrachen und Königs war.
Darauf konnte er verzichten, er hatte sie regelrecht rausgeknurrt. Sie hatten eilig vor ihm die Flucht ergriffen. Kein Wunder, jeder Diensthabende in der Festung wusste, was er seiner Mutter angetan hatte. Deshalb fürchteten sie ihn. Und im Moment war ihm das nur recht.
Ungestüm durchstöberte er Schränke, Tongefäße und Vorratskammern, getrieben von einem unstillbaren Heißhunger nach so ziemlich allem, was ihm in die Hände fiel. Abwechselnd schaufelte er sich den Kartoffeleintopf und frisches Obst in den Mund, biss von der Keule ab, die vom Abendmahl übrig war, machte sich über rohes Gemüse von Karotten bis Mais her. Die Mischung aus Süß und Herzhaft ließ ihn mit vollem Mund stöhnen. Unruhig wanderte er von einer zur nächsten Ecke, löffelte den kalten Reisbrei seines Vaters und den Haferbrei seines Bruders Sarsar.
Sein Hunger war nicht zu stillen, er hatte nichts mit Essen zu tun. Er litt unter schrecklichem Blutdurst und dem lauten Summen in seinen Eingeweiden, das von seinem überwältigendem Paarungstrieb stammte.
Er hätte Vaaks nicht zusehen sollen, hätte nicht beobachten sollen, wie Fenjin zu ihm stieg, wie sie rumalberten und ein Wettschwimmen veranstalteten, wie sie dicht zusammen waren und leise, vertraut zueinander sprachen, so innig, so selbstverständlich. Während er wie erbärmlich im Schatten lauerte und ihnen diese Zweisamkeit neidisch missgönnte. Wie er sich wünschte, er könnte den Platz – ach was, den Körper mit Fenjin tauschen.
Nun hatte er den Schlamassel, seine Sehnsucht war zu einer lodernden Begierde ausgewachsen, mit jener er nicht umgehen, geschweige denn ausleben konnte. Obwohl sie sich mächtig aufbäumte und laut in seinem Körper brüllte, weil sie gelöscht werden wollte.
Es gab nichts, rein gar nichts, was er hätte tun können. Der Druck und die Unruhe in seinem Inneren kosteten ihm beinahe den Verstand. Er wollte sich wehtun. Oh ja, er wollte den Kopf gegen die Wand schlagen, seine Hand langsam über einer offenen Flamme verbrennen, sich mit dem Dolch tief ins Fleisch schneiden und mit dem Blut und dem Schmerz auch die Gier in sich loszuwerden, die er nicht zu kontrollieren wusste.
Die Hitze in seinem Körper brachte ihn um, ebenso wie das ständige, starke Pochen und Zucken zwischen seinen Beinen. Stillstehen konnte er nicht, er musste laufen, immer wieder vor den Arbeitstischen in der dunklen Küche auf und ab, während er sich Unmengen an Speisen in den Mund stopfte und schluckte.
Immerhin schien das Fressen – anders konnte man das, was er tat, nicht bezeichnen – ein wenig zu beruhigen. Es war nicht ideal, aber besser als nichts, um einen Teil seiner Gier zu befriedigen.
Essen statt Paarung. Und Wexmell meinte, er könnte seine Gefühle nicht austricksen. Ha!
Es war nur eine schwache Alternative, aber besser als im Bett zu liegen und sich wieder stundenlang selbst mit der Hand Erleichterung zu verschaffen, ohne je befriedigt zu sein.
Seinen Verstand konnte er überlisten, aber nicht seinen Schwanz.
Xaith spülte das Gemisch aus Essenresten mit viel kaltem Wein runter, der oberflächlich dazu beitrug, seinen Trieb zu beruhigen.
Ein leises, dunkles Lachen ertönte hinter ihm und er fuhr erschrocken herum.
»Ich muss nicht fragen, was du da tust, ich kenne es selbst.« Leicht schlurfend trat Riath in den Schein der Esse, seine gebräunte Haut wirkte matt und samten im fackelnden Widerschein, sein blondes Haar sah zerstreut aus, als hätte er es sich gerauft, sein Umhang hing schief und sein Hemd stand offen, unsauber hing sein Gürtel auf seiner Hüfte und hielt nur mit Not seine Hose oben. Er schwankte und das linke Auge hing tiefer als das rechte, er hatte einen Krug Wein in der Hand und nahm einen gierigen Schluck daraus, sodass ihm der Wein über die Lippen tropfte.
Xaith stellte die Schüssel mit Sarsars Haferbrei ab, alles in seinem Mund verwandelte sich in Staub. »Du hast gesoffen«, stellte er leise fest. Es war keine Frage.
Eigentlich überraschte es ihn nicht, immerhin soff Riath immer, wenn er Tadel statt Lob erhielt. Nein, überrascht war Xaith wirklich nicht, aber aus gutem Grund beunruhigt.
»Es ist der Trieb, oder?« Riath schlenderte näher, erstaunlich standfest für einen Besoffenen, was zeigte, dass er Übung hatte. Geradezu anpirschend bewegte er sich um Xaith herum, der auf der Hut war wie ein rivalisierender Wolf. »Der Hunger nach Blut und Fleisch, er singt und pulsiert in dir, brennt und verlangt, kitzelt dein Innerstes mit sanften Federn, bis du vor Gier fast hecheln musst und dein ganzer Leib sich so sehr danach verzehrt, berührt zu werden und in etwas hinein zu stoßen, mit Fängen und Glied gleichermaßen, dass du zitterst vor Verlangen.« Er sagte das absichtlich mit einer aalglatten, verführerischen Stimme, als würde er Xaiths Fantasie anregen und sein Leiden verschlimmern wollen.
Und es gelang ihm.
»Ich verstehe, warum du nicht trinkst, aber warum auf den Beischlaf verzichten?«, wollte er dann wissen. Er stand nun hinter Xaith, ganze drei Schritte Luft war zwischen ihnen, aber Xaith spürte ihn im Nacken, als stünde er so dicht hinter ihm, dass sie sich berühren würden, wenn auch nur einer von ihnen leicht einatmete.
»Mir liegen die Verehrerinnen nicht so zu Füßen wie dir«, konterte er zähneknirschend.
Riath lachte wieder leise, mit einem Hauch von arrogantem Hohn. »So kannst du es auch bezeichnen. Soll ich dir helfen?« Er näherte sich einer lauernden Raubkatze gleich Xaiths Rücken und senkte verheißungsvoll die samtweiche Stimme. »Lass uns ein paar Mägde finden. Oder eine, die gut genug ist, unser Verlangen zu stillen, hm? Ich zeig dir, wie es geht, Bruder…«
Riath war nun ganz nah, seine Worte und sein heißer Atem streiften Xaiths Hals. Eine Gänsehaut breitete sich auf seiner Haut aus und ließ das Summen in seinen Eingeweiden zu einem Brüllen anschwellen. Sein Körper schrie danach, Riaths Angebot anzunehmen.
»Ich verführe sie, dann kommst du dazu«, schlug Riath vor, und wieder strich sein Atem über Xaiths Haut, deutlicher dieses Mal, als hätte er ihm leicht in den Nacken gepustet.
Eine Hitzewelle prasselte Xaith den Rücken hinunter. Er zuckte zusammen und fuhr zu seinem Bruder herum, während er gleichzeitig Abstand nahm.
Riaths grüne Augen leuchteten wie grünes Feuer in der Dunkelheit. Er grinste selbstgefällig und zwei dolchförmige, lange Fänge blitzten auf. »Doch lieber einen Stallbuschen?«
Xaith verzog wütend das Gesicht, und im Gegensatz zu Riath, sah er damit hässlich aus. Nun ja, noch hässlicher als sonst. »Leck mich«, knurrte er und wandte sich ab, um die Küche zu verlassen.
Riath lachte vergnügt mit zurückgelegtem Kopf. Dann rief er Xaith amüsiert nach: »Ach komm schon, ich bin dein Bruder, nicht dein Feind! Lass mich dir helfen. Ich musste da auch durch, nächstes Jahr wird es besser.«
Xaith konnte sich das im Moment noch nicht vorstellen. Der Drang, sich mit warmem, lebendigem Fleisch zu vereinen, das nicht seinem eigenen Körper entsprang, war so übermächtig, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass es jemals vergehen würde.
Aber so sehr sein Leib auch nach Befriedigung schrie, er war zu stolz, als zuzulassen, dass sein Bruder eine junge Dame verführte, ihr falsche Hoffnungen machte, damit sie sich seinem hässlichen Bruder annahm.
Nein, da litt er lieber.
Trotzdem … wurde … er … langsamer…
Riaths Stimme nahm etwas ungewohnt Sanftes, beinahe Mitfühlendes an. »Komm wieder her, ich weiß, was dir jetzt hilft.«
Wütend fuhr er herum und funkelte Riath mit schmalen Augen an.
Sein Bruder gluckste. »Es ist ganz harmlos, versprochen! Und sittlich.« Er winkte ihn näher, während er sich zur Speisekammer wandte und den Krug ansetzte, um ihn leer zu trinken.
Xaith zögerte, doch Riath hatte das erste Jahr seines Paarungstriebs bereits hinter sich und wusste vielleicht Abhilfe, und er war ja nicht immer ein widerliches Scheusal.
Langsam und argwöhnisch trat Xaith wieder näher, als Riath mit einem Arm voller Obst und kleinen Leinensäcken wieder hervorkam, ein breites Lächeln auf dem Gesicht, wie früher, wenn er sich einen genialen Streich ausgedacht hatte – der immer schief ging. Aber niemand konnte Riath vorhalten, er wäre nicht begeistert. Ganz gleich was er sich vornahm, er ging alles mit freudigem Eifer an.
»Setz dich!«, forderte Riath ihn auf.
Sie nahmen an einem kleinen Tisch platz, der viele Kerben vom Hacken diverser Kräuter aufwies. Das Holz roch noch nach Thymian und Rosmarin.
Riath schob mit seiner großen Hand die gehackten Kräuter zur Seite und ließ die Waren, die auf seinen anderen Arm lagen, auf den Tisch fallen. Dicke, große Erdbeeren, grüne, saftige Trauben und Mandeln aus den Säckchen rollten vor Xaiths Nase. Dann machte Riath sich mit einem frohen, betrunkenen Lächeln ans Werk. Mit einem Dolch schnitt er die dicken Erdbeeren klein und warf sie in eine große Holzschüssel, die eigentlich für Kräuter vorgesehen war. Mit dem Ellenbogen schob er Xaith das Säckchen mit den Mandeln entgegen.
»Iss die schon mal.«
Er musste nicht erläutern, weshalb. Xaith warf sich eine ganze Handvoll in den Mund und kaute auf den harten Nüssen herum. Seine Kiefer hatten einiges zu tun, um die Mandeln klein zu beißen. Seltsamerweise linderten die starken Kaubewegungen seine Gier. Deshalb hatte er immer Kerne in den Taschen, um auf etwas herumkauen zu können. Die Mandeln waren jedoch deutlich härter zu kauen. Er würde zukünftig Nüsse mit sich herumtragen.
»Was hat dich so in Wallung gebracht?«, fragte Riath mit einem Funkeln in den Augen.
Xaith schwieg dazu, er ignorierte die Frage. Er log nicht, zumindest selten, Lügen waren etwas für Schwächlinge und Feiglinge.
Aber niemand konnte ihn zu einem Geständnis zwingen.
Riath grinste anzüglich, während er die Erdbeeren halbierte, mit den Ellenbogen auf den Tisch gestützt und den Dolch und die Früchte dicht vor die Nase gehalten, sodass er beinahe schielte.
»Weißt du, was bei mir oft den Trieb weckt?«, fragte Riath und bohrte seine lodernden Augen tief in Xaiths Gesicht. »Deine Beine«, sagte er plötzlich tief knurrend. »Diese ellenlangen, schlanken, unberührten Beine …«
Xaith verspannte sich und schielte zur Tür. Der Ausgang war nicht weit entfernt, aber er musste an Riath vorbei…
Riath wandte gelassen den Blick ab, warf die Trauben zu den Erdbeeren, hackte ein paar Mandeln und vermengte alles zusammen, dann schob er Xaith die Schüssel zu.
»Hier«, lockte er verführerisch, »die Süße der Früchte stillt den Heißhunger, glaub mir, je süßer, desto besser. Und die Mandeln geben den richtigen Biss.« Er zwinkerte.
Xaith seufzte, zog die Schüssel unter seine Nase, hob einen Holzlöffel vom Tisch, der nach irgendeinem nussigen Öl duftete, und begann zu schaufeln. Jedoch nicht ohne argwöhnisch seinen Bruder im Auge zu behalten, der wie gebannt auf seinen Mund starrte.
»Deine Fänge sind unglaublich lang«, raunte Riath mit verklärtem Blick, als stellte er sich allerlei unaussprechliche Dinge damit vor.
Das Unbehagen bescherte Xaith eine Gänsehaut. Er hatte genug und stand so unerwartet auf, dass er annahm, Riath würde nicht damit rechnen. Er sah sich nicht nach diesem um, er eilte auf den nächstgelegenen Ausgang zu und …
»Moment!« Riath war verdammt schnell. Er hatte ihn am Arm gepackt und herumgewirbelt, ehe er sich wehren konnte.
Hart krachte Xaiths Rücken gegen die Wand neben dem Ausgang, Riaths Unterarm lag dicht unter seinem Hals auf seiner Brust und drückte ihn aufrecht gegen den Stein, während sein muskulöserer Leib sich anschmiegte. »Wo will Vatis Liebling denn so schnell hin, hmmm?«
Xaith drehte den Kopf zur Seite und presste die Lippen aufeinander.
Schnurrend rieb Riath das Gesicht an seinem Profil und strich genüsslich mit der Nase über Xaiths Hals, saugte den Duft seiner Haut in sich ein. »Warum so eilig, Bruder? Ich könnte deine Gier stillen, deinen Schmerz lindern. Das tut uns beiden gut«, raunte er ihm verheißungsvoll mit dunkler Stimme ins Ohr.
»Lass. Mich. Los.« Xaith biss die Zähne zusammen.
Riath lachte leise in sich hinein. So musste sich ein übler Schurke anhören, dachte Xaith. »Komm schon!«, drängte ihn sein Bruder und umfasste fest seine Oberarme, drückte zu, wanderte mit massierenden Bewegungen tiefer und rieb sich an ihm.
Xiath bäumte sich gegen ihn auf, doch Riath stieß ihn fordernd zurück an die Wand.
»Wie deine Fänge das Fleisch der Erdbeere durchbohren…«, seine Stimme zitterte heiser, »…wie der rote Fruchtsaft von ihnen tropft … Sei mir nicht böse, aber wie könnte ich da nicht an das hier denken?«
Xaith blieb starr wie eine Marmorstatue, als sein Bruder mit dem Daumen über seine Lippen strich, als wollte er ihn dazu verführen, ihm die Fänge zu zeigen und etwas anderes dazwischen zu nehmen.
»Ich kann dir helfen«, versprach Riath ihm verlockend und mit einem Hauch von Triumph in dem Lächeln, das plötzlich auf seinem Gesicht lag. »Es wird dir hinterher besser gehen, vertrau mir.«
Sein Daumen übte Druck auf Xaiths Lippen aus und versuchte, sich in seinen Mund zu drängen. Als ein Zittern durch Riaths Leib fuhr, schubste Xaith ihn grob von sich.
Riath war zwar muskulöser, aber dennoch taumelte er drei sehr große Schritte zurück, weil ihn sein erregtes Beben geschüttelt und schwach gemacht hatte.
»Du sollst mich nicht anfassen!«, zischte Xaith ihn an, seine Knie zitterten, doch das ließ er sich nicht anmerken. Vor Riath durfte man keine Schwächen zeigen.
Riaths Gesicht verzog sich ärgerlich, er schnaubte zynisch. »Du solltest dich geehrt fühlen, dass ich dich will. Zumal dich sonst niemand anfassen würde!« Er sagte das derart provokant und hasserfüllt in Xaiths Gesicht, dass es bis ins Herz schmerzte, weil es die Wahrheit war.
Xaith schüttelte den Kopf. »Du bist mein Bruder, verdammt noch mal! Schlaf deinen Rausch aus und besinne dich!« Damit löste er sich von der Wand und ging mit eiligen Schritten den Gang hinunter.
Riath rief ihm verärgert hinterher: »Du verpasst was, Bruder!«