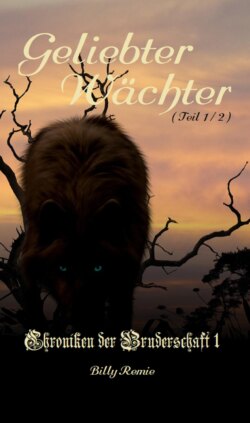Читать книгу Geliebter Wächter - Billy Remie - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеDrei pechschwarze Raben sammelten sich auf dem Ast eines knorrigen Sperberbaumes, dessen saftig grüne Blätter schwer vor Feuchte hinabhingen. Gierig drehten die unheimlichen Vögel ihre Köpfe und wetzten die langen, kohlschwarzen Schnäbel an der Rinde. Sie warteten darauf, dass Blut vergossen und Leichen hinterlassen wurden.
Die Klugheit in ihren schwarzen Augen konnte einem gestandenen Mann eine Gänsehaut einbringen. Es war, als läge alles Wissen aller Welten in den Augen eines Raben. Als gäbe es nichts, weder in der Vergangenheit, Gegenwart noch in der Zukunft, was diese Vögel nicht wussten. Sie schienen wie Boten zwischen den Welten umherreisen zu können und sich über Dinge klar zu sein, die kein Sterblicher je begreifen könnte.
Es musste schließlich einen Grund geben, warum diese Tiere überall vertreten waren, es gab kein Schlachtfeld, das vor ihnen sicher gewesen wäre. Sie saßen am Rande und sahen dem Geschehen zu, in Erwartung eines Festmahls.
»Ragon!«
Doragon riss den Blick von den drei Raben los, als Fen`zume ihn rief. Er suchte mit seinem scharfen Blick die überwucherte Straße nach seinem Weggefährten ab. Sein Freund stand inmitten der Trümmer einstmaliger Planwagen. Sie hatten die Karawane hinter einer Kreuzung gestoppt, indem sie eine Palisade errichtet und aus den Baumkronen und dem Unterholz heraus Pfeile zwischen die Radachsen geschossen hatten, um sie zu brechen. Dabei waren einige Wagen umgekippt. Lederplanen wehten nun über den Weg, Holzsplitter lagen verstreut umher, am Rand der Straße saßen die gefangen genommenen Wächter der Karawane in einer Reihe im Dreck und starrten mit grimmigen, entschlossenen Gesichtern zu ihren Angreifern empor, während sie darauf warteten, dass über ihr Schicksal entschieden wurde. Ihre Herkunft war deutlich an ihrer dunklen Haut, den leicht angespitzten Ohren und den seltsamen weiß glühenden Schlangenlinien unter ihrer Haut zu erkennen, die sich wie eine Krankheit über ihre freien Arme, Hände, Hälse und Schläfen ausbreiteten. Genau wie Wurzeln eines Baumes streckte das weiße Glühen seine Fühler in ihren Nervenbahnen aus.
Fen winkte Doragon zu dem Wagen in der Mitte. Es waren insgesamt fünf Karren voll mit Vorräten, gezogen von Maultieren, die sie bereits losgebunden und beladen hatten. Sie würden sie mitnehmen. Eine gute Ausbeute, viel Essen für das Lager. In den nächsten Wochen würden sie sich nicht um den anhaltenden Hunger kümmern müssen. Selbst Heilkräuter waren säckeweise unter den Vorräten vorhanden. Offensichtlich hatten sie eine Lieferung an die Herrin selbst erwischt. Sie hatten nur das Beste vom Besten erbeutet.
Doragon trat neben Fen und sah ihn fragend an. Dieser nickte auf das, was er und zwei weitere Kameraden entdeckt hatten. Der Wagen in der Mitte war hinten leicht eingesunken, da ein Rad gebrochen war, ansonsten schien er unversehrt. Jemand hatte die Plane runtergerissen und einen Käfig freigelegt. Er war nicht einsehbar, die Wände bestanden aus massivem Eisen und ließen das Gebilde mehr wie eine übergroße Metalltruhe wirken.
»Das solltest du dir ansehen«, sagte Fen mit belegter Stimme und deutete mit seiner dunklen Hand zur Tür des Käfigs. Seine gelben Augen wirkten erschüttert, beinahe ratlos. Das kannte Doragon nicht von ihm, Fen hatte stets einen frechen Kommentar auf den Lippen, ganz gleich mit wem er sprach und wovon er sprach, und ob sie am Lagerfeuer saßen oder in die Enge getrieben ihrem Tod entgegenblickten. Er fand immer eine alberne Bemerkung.
Heute war er still. Zu still. Seine spitzen Ohren zuckten nervös unter seinem langen haselnussbraunen Haar. Etwas hatte ihn tief getroffen.
Doragon erwartete nichts Gutes, noch nie hatte etwas oder jemand Fen zum Schweigen gebracht.
Er reichte wortlos seinen Bogen an Fen weiter und stieg auf das Trittbrett des Wagens. Durch eine kleine Öffnung konnte er in den Käfig spähen. Er hielt sich an den dicken Eisenstäben einer winzigen Fensteröffnung fest und verengte die Augen, um etwas erkennen zu können. Sein Gesicht schwitzte unter seiner ledernen Maske, die stets sein Antlitz verhüllte.
Es war dunkel in dem eisernen Kasten, aber er hatte die Augen eines Raubvogels. So sagte man über ihn. In Wahrheit konnte er vermutlich einfach gut sehen. Seine Pupillen gewöhnten sich an das wenige Licht hinter der Tür, stickige Luft schlug ihm entgegen, es roch nach Unrat, Schweiß und Verzweiflung. Der Raum war innen wie außen aus kaltem Eisen, drinnen war er rostrot verfärbt. In der hintersten Ecke schlängelten sich dicke Ketten über den Boden, wie man sie von Ankern für große Segelschiffe kannte. Sie begannen in der Dunkelheit und endeten an einem dicken Eisenring, der um ein beunruhigend knochiges Fußgelenk lag. Die Kette samt Ring mussten zu schwer für das dünne Bein sein, das sie festketteten. Die Haut des Gefangenen erinnerte an das Wachs einer Kerze, zerlaufen und blass. Der Eisenring, der ihn ankettete, hatte Blutergüsse auf dem Gelenk hinterlassen, die wegen der ansonsten weißen Haut geradezu leuchteten.
Doch mehr als Beine und Füße gab die Dunkelheit nicht preis. Doragon erwartete bei diesem Anblick nichts als eine Leiche vorzufinden.
So mager, so blass, so … leblos. Nur dünne Haut über leicht zerbrechlichen Knochen. Wie ein Kind, das in einem Brunnen verhungert ist und dessen Überreste man nach einem oder zwei Jahren aus dem Schacht zog.
Doragon packte den Türgriff und riss daran. Die Tür bewegte sich nicht, schwere Schlösser sicherten den Kasten.
Er sprang vom Trittbrett und ging einige Schritte zurück. »Tsuri. Haru. Brecht den Käfig auf!«
Die beiden vermummten Kameraden setzten sich sofort in Bewegung, gingen an Doragon vorbei und machten sich an die Arbeit.
Doragon rückte seine Maske zurecht und nahm dann seinen Bogen wieder an sich, den Fen ihm entgegenhielt. Er schlang ihn sich um den muskulösen Oberkörper. Tsuri und Haru zogen kleine Ledersäckchen hervor und schütteten schwarzes Pulver in die Öffnungen der Schlösser.
»Ist es noch am Leben?«, fragte Fen Doragon mit gesenkter Stimme.
Doragon musterte seinen Freund. Er war dünn, auf den ersten Blick nicht mehr als ein Bursche, und das schmutzige Hemd und die braune Lederhose saßen so locker um seinen Leib, dass sie seine drahtige Gestalt noch unterstrichen.
Doragon wandte den Blick wieder ab, die Maske gab nur seine Augen preis, nicht seine mahlenden, angespannten Kiefer. »Die Frage ist, warum sie es in einem Käfig transportieren«, antwortete er nachdenklich, seine Stimme klang wegen seiner Maske leicht gedämpft.
Etwas zischte in der Luft, wie Wasser auf heißer Glut. Das Pulver wurde entzündet, mit einem lauten Knall sprang das erste der drei Schlösser auf.
Hinter der Tür erklang ein Schaben, wie von Ketten, die über den Boden schliffen, als hätte sich das Geschöpf im Inneren weiter zurückgezogen. Ein ängstliches Wimmern erklang.
Doragon drehte sich der Magen um, ließ es sich aber nicht anmerken.
Bei allen Geistern … was hatten sie mit ihm gemacht?
Fen sah zum Käfig, dann richtete er die buttergelben Augen wieder auf Doragon. »Scheint, als steckt noch Leben in den Gebeinen.«
Doragon wandte sich wortlos ab, um eine Fackel zu entzünden.
Er hockte sich zwischen die Trümmer und schlug zwei Feuersteine aufeinander, um den in Pech getränkten Stoff in Flammen zu hüllen, als jemand vor ihn trat und das Licht unter dem Blätterdach verdunkelte.
Er blinzelte zu dem jungen Mann auf, der mit geballten Fäusten vor ihm stand. »Wir sollten sie töten!«, forderte er verbissen.
Doragon folgte seinem energischen Nicken und leckte sich unter der Maske die Lippen. Er betrachtete die entschlossenen Gesichter der gefangengenommenen Wächter und ihre vor Zorn glühenden Augen. Das Leuchten der weißen Linien unter ihrer dunklen Haut zeugte davon, dass sie nicht Herr ihrer Selbst waren. Sie wussten nicht, was sie taten. Niemand konnte ihnen noch helfen, niemand würde sie von ihrem Weg abbringen. Sie waren befallen.
»Nein«, sagte er dennoch und zündete die Fackel an.
Der junge Bursche, dessen Namen er nicht kannte, stampfte wütend auf. »Aber … sie sind nicht mehr zu retten. Sie sind eine Gefahr! Wir müssen …«
»Ich sagte, nein!« Doragon brauchte die Stimme nicht zu erheben, er blieb stets ruhig. Wer schreien musste, um Gehör zu finden, dem schenkte man keinen Respekt. Das hatte der Mann ihm beigebracht, der ihn großgezogen hatte.
Doragon stand auf und trug seinen Kameraden auf, die die Gefangenen bewachten: »Verbindet ihnen die Augen und treibt sie gefesselt in den Wald hinein. Sorgt dafür, dass sie nicht wissen, wohin ihr sie bringt. Sie können sich dann gegenseitig aus den Fesseln helfen, wenn ihr verschwunden seid. Hinterlasst ihnen keine Spuren, die sie verfolgen könnten. Mögen die Geister des Waldes ihnen gnädig sein – oder sie in die Irre führen.«
Die drei Männer nickten und zogen Stofffetzen hervor, um seinem Befehl Folge zu leisten.
Das zweite Schloss wurde gesprengt, und er wandte sich mit der Fackel in der Hand zum Käfig.
Da packte ihn der Bursche am Arm und zerrte ihn herum. »Das ist nicht Recht! Nach allem was sie uns angetan haben, verdienen sie den Tod durch unsere Klingen! Sie würden uns auch keine Gnade erweisen. Haben sie nie und werden sie nie …«
»Wir werden kein Blut vergießen!«, zischte Doragon den Burschen an, wobei er sich dicht zu ihm beugte, dass er auch wirklich verstand. Sein Blick brannte sich in die braunen Augen des Jüngeren, der widerwillig aber eingeschüchtert das Gesicht wegdrehte. »Sie wissen nicht mehr, was sie tun, sie sind auch nur Sklaven. Und selbst wenn nicht, so sind wir nicht wie sie. Wir werden niemanden töten, wenn es nicht sein muss. Deshalb sind wir nicht hier! Wir sind keine Schlächter und wir ermorden auch keine gefesselten Gefangenen! Lassen wir sie ziehen, sollen sie ruhig der Herrin Bericht erstatten. Lassen wir sie Gerüchte über uns verbreiten.«
Erst der letzte Satz schien den Burschen milde zu stimmen. Er wirkte noch immer unglücklich darüber, dass er seine Wut nicht an seinen Feinden auslassen durfte, doch er nickte immerhin ergeben.
Doragon atmete ruhig unter der Maske aus und legte dem Jüngeren versöhnlich eine Hand auf die Schulter, die sich unter dem leichten Hemd erschreckend knochig anfühlte. Er war noch nicht lange bei ihnen, sein Körper und Geist zeigten noch die Spuren seines Sklavenlebens.
»Rache bringt uns nicht zum Ziel«, sagte Doragon mitfühlend zu ihm, »noch bringt sie uns Seelenfrieden. Was wir wollen, wird größer sein, befriedigender. Ich gebe dir mein Wort. Und nun geh und sammle alle Waffen und Pfeile ein, die du finden kannst.« Er verstummte einen Augenblick lang nachdenklich und blickte empor zu den drei Raben auf dem Ast, die ebenso enttäuscht über seine Entscheidung schienen wie der Bursche. »Wir werden Waffen brauchen. Aber nur, um uns zu verteidigen. Die blutigen Gräueltaten überlassen wir unseren Feinden, denn wir sind nicht wie sie!«
Als das dritte Schloss gesprengt wurde, drückte Doragon dem Burschen noch einmal die Schulter, dann wandte er sich ab und ging zu Fen und dem Käfig zurück.
Der Jüngere zog ab, der Ärger verrauchte langsam, er war froh, eine Aufgabe zugeteilt zu bekommen und ging dieser gewissenhaft nach.
»Ich gehe allein rein«, sagte Doragon zu seinem Gefährten.
Fen nickte. »Aye, natürlich.«
Tsuri und Haru zogen die schwere Tür für ihn auf. Sie war so dick wie der Arm eines ausgewachsenen Mannes.
Doragon schwang sich auf das Trittbrett und ging mit der Fackel voran geduckt in den eisernen Käfig. Der widerliche Geruch nach Unrat und kaltem Schweiß lag so schwer im Inneren, dass er befürchtete, die offenen Flammen könnten ihn entzünden und eine Feuerflut auslösen.
Er war froh um die Maske.
Langsam ging er weiter, das Licht vertrieb die Dunkelheit wie Ebbe die Flut. Pechschwarze Schatten glitten über die dürren Beine nach oben. Es waren kurze Beine, doch so dünn, dass sie wieder lang wirkten. Nicht mehr als dünne Äste, die bei der schwächsten Windbriese brechen würden. Schwach wie zwei Seile.
Das Geschöpf wich vor dem Licht zurück. Doragon schluckte seine Übelkeit hinunter, eigentlich wollte er gar nicht sehen, was ihn erwartete. Und doch trieb ihn etwas in seinem Inneren weiter an.
Die Fackel leuchtete dem Gefangenen ins Gesicht. Es war ein Junge. Ein Junge aus dem Westen, seine helle, blanke Haut und die runden Ohren gaben seine Herkunft preis. Er war nackt, kränklich, verdreckt von Kopf bis Fuß, unterernährt und offensichtlich ausgemerzt, als hätte ihm jemand die Lebenskraft aus dem Leib gesaugt. Als das Licht ihn traf, riss er sofort die knochigen Ärmchen hoch und verbarg das Gesicht dahinter, er kauerte erbärmlich in der dunklen Ecke, die Knie an die Brust gezogen, Arme und Beine mit Eisenringen versehen und an die Wand gekettet.
Doragon unterdrückte einen Fluch. Er ging noch weiter in die Hocke, versuchte nicht an den Schock zu denken, der seinen Magen krampfen ließ.
»Hallo.« Sehr geistreich, dachte er und verdrehte über sich selbst die Augen, aber wie sollte er den Burschen sonst ansprechen? »Was haben sie …« Er brach ab. Was für eine dumme Frage. Und so unpassend. Die Befragung musste warten, dies war der schlechtmöglichste Zeitpunkt.
Doragon streckte die behandschuhte Hand aus, wollte dem Burschen zur Beruhigung berühren. Doch dieser zuckte heftig zusammen, rutschte von ihm davon in die andere Ecke, wie ein verschrecktes Wildtier, das nicht mehr fliehen konnte. Die Ketten rasselten unheilvoll.
»Nein, schon gut, ich will dir helfen!« Er hob seine Hand, um seine gute Absicht zu signalisieren. »Ich bin hier, um dir zu helfen.«
Der Junge sah ihn nicht an, wimmerte nur ängstlich.
»Ist gut, ich will dir nichts Böses. Fürchte dich nicht!« Ihm war übel, und nicht wegen des beißenden Geruchs. »Du musst keine Angst vor mir haben, ich bin hier, um dir zu helfen.«
Der Junge rührte sich nicht, doch er floh auch nicht, als Doragon langsam auf ihn zu kroch.
Gute Geister…was in aller Welt haben sie ihm angetan? Doragon konnte es nicht begreifen, er versuchte, den aufkommenden Unglauben runter zu schlucken.
»Mein Name ist Doragon. Du kannst mich Ragon nennen.«
Keine Antwort.
»Wie heißt du?«
Immer noch keine Rührung.
»Ich werde jetzt näherkommen, du musst dich nicht fürchten«, sprach er unbeirrt weiter, aber seine Hände zitterten, er konnte nicht glauben, was er sah.
Er hatte schon viele Sklaven befreit, aber niemals waren sie in solch einem schlechten Zustand gewesen. Mehr tot als lebendig.
Wieso taten sie so etwas einem Jungen an? Warum? Wozu? Er konnte es nicht begreifen.
»Keine Angst.« Er sprach nun leise, mehr zu sich selbst. »Hab keine Angst vor mir, ich will dir helfen. Ich werde dir helfen.«
Doragon streckte seine Hand aus und berührte eine der gelockten Haarsträhnen, sie waren matt, und die helle Farbe sah stumpf im Dunkeln aus, wie verblasste Bronze. Das Haar wirkte wie ein Nest aus sich kringelnden Schlangen auf seinem Kopf, es hing ihm über den Ohren und verdeckte die Stirn.
Der Junge zuckte leicht unter der Berührung zusammen, aber er flüchtete nicht mehr. Vielleicht hatte er ihn verstanden, vielleicht hatte er auch einfach keine Kraft mehr, um vor ihm zu fliehen.
Vorsichtig legte er die Haarsträhne beiseite und betrachtete die mit Schmutz bedeckte Stirn. Er zog die Augenbrauen verwundert zusammen, als er einen Kreis auf der hellen Haut erkannte.
Ein Brandmal.
Zögerlich hob der Sklave den Kopf und blinzelte aus rotunterlaufenen Augen zu ihm auf.
Ein helles Blau schlug Doragon entgegen, schimmernd wie das türkise Meer, das er aus seiner Kindheit kannte.
»Fürchte dich nicht«, flüsterte er mit rauer Stimme, »du bist jetzt frei. Ich bringe dich in Sicherheit.«
Hoffnung, aber auch Skepsis blitzten in dem stummen Gesicht auf.
So zart, so jung wirkte der Sklave, dass es Doragon wütend machte, was ihm widerfahren war. Wer tat einem so wehrlosen, zartem Geschöpf solche Grausamkeit an?
»Dürfen meine Freunde reinkommen?«, fragte Doragon behutsam. »Sie werden deine Ketten lösen.«
Der Sklave schien zu überlegen, spähte vorsichtig an ihm vorbei und blinzelte des Tageslicht wegen, das in den Käfig fiel. Er schnupperte, als würde er seit einer Ewigkeit wieder frische Luft wittern.
»Es wird alles gut«, sagte Doragon heiser. Er berührte den Kleinen am Arm, dieser zuckte zusammen, ließ es aber geschehen und beruhigte sich.
Dann sah er Doragon an und nickte ängstlich.
»Tsuri. Haru. Die Ketten: löst sie!«
Als die beiden vermummten Gestalten eintraten, löste Doragon seinen Umhang. Er legte die Fackel auf den Boden, um den nackten Sklaven in die braune Wolle zu hüllen.
Der Sklave wich ängstlich vor den beiden Männern zurück, die mit Meißel und Hammer die Verankerung an der Wand bearbeiteten. Man hörte sie fluchen.
Doragon zog den Kleinen an sich, wickelte ihn in seinen Umhang und erschrak darüber, wie dünn und kalt sich der Leib des Sklaven anfühlte. Er fragte sich, wie dieses wandelnde Skelett überhaupt noch atmen konnte.
Er unterdrückte ein Zittern und war froh um seine Maske, die seine Erschütterung verbarg. Sicher war er leichenblass und sah so ratlos aus, wie er sich fühlte.
Er war kein Druide, aber er war sich sicher, dass der Kleine bereits auf der Schwelle zur anderen Seite stand. Ob er überleben würde war fraglich.
Als die Verankerungen gelöst waren, hob Doragon den geschwächten Sklaven aus dem Käfig. Das Tageslicht blendete diesen so sehr, dass er das Gesicht drehte und es an Doragons Brust verbarg. Seine langen, dürren Finger krallten sich an Doragons Hemd fest.
Es bereitete ihm Übelkeit und Zorn, wie leicht der Kleine war. Er wog nicht mehr als ein Sack voll Lumpen. Die Ketten, die noch um seine Gelenke lagen, rasselten bei jedem Schritt. Sie waren das einzige, spürbare Gewicht an ihm. Doragon hatte die unbestimmte Angst, der Kleine könnte ihm davonfliegen, wenn sie die Ketten von seinen Gelenken lösten.
Fen stellte sich Doragon draußen in den Weg und musterte den Sklaven mit fliegenden Augen. »Ist er ein Mensch?«
»Sieht so aus.«
»Siehst du das Mal auf seiner Stirn?«, fragte Fen schmallippig. »Ist er…?«
Doragon bugsierte den Sklaven an Fen vorbei und ging weiter. »Wir müssen ihn zum Lager bringen, er braucht Hilfe. Schnell.«
Fen murmelte hinter seinem Rücken etwas wie: »Mutter, steh uns bei, er ist ein Magier.«
Und ein Mensch. Doragon und Fen mussten es nicht aussprechen, sie wussten, wen sie befreit hatten. Das Schicksal hatte ihnen heute in die Hände gespielt.
Doch Doragon wusste ebenfalls, dass die Konsequenzen schrecklich sein würden. Der Feind würde alle Mittel aufbringen, um sein Hab und Gut zurückzufordern.
Und die drei Raben krächzten ein höhnisches Gelächter.