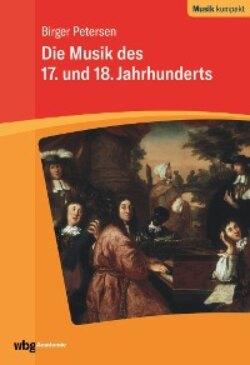Читать книгу Die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts - Birger Petersen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Affekt: Von Descartes zu Mattheson
ОглавлениеLes Passions de l’âme
Während Descartes einen großen Teil seines Musicæ Compendium der rationalistischen Begründung der Musik widmet, verweist er auf die Zusammenhänge von Musik und Affekt nur sehr knapp. Dabei äußert sich der Rationalismus auch hier, nämlich in einer mechanistischen Auffassung der affektiven Wirkung von Musik: Bestimmte Affekte werden spezifischen musikalischen Mitteln bis hin zur Theorie der korrespondierenden Taktordnung zugeordnet. Das richtungsweisende ‚Hauptwerk‘ ist in diesem Zusammenhang Descartes’ Traktat De passionibus animae oder Les Passions de l’âme von 1649, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert äußerst intensiv rezipiert wurde und eine enorme Wirkung auf die Entwicklung von Philosophie und Musiktheorie hatte. Descartes unternimmt annähernd zeitgleich mit dem Erscheinen der Musurgia universalis Kirchers in Rom (wenngleich vollkommen unabhängig) den Versuch einer groß angelegten, systematisch ausgebauten Abhandlung von sechs Grundaffekten. So beschreibt er als einer der ersten die physischen Fundamente der Emotionen, entwirft eine „Theorie der Leidenschaften“ bzw. eine „Lehre de Affectibus“ – oder eben „Affektenlehre“, zu der dann schließlich Johann Mattheson vordringen sollte.
Bereits Gioseffo Zarlino forderte in seinen Istitutioni harmoniche 1558, also über ein Dreivierteljahrhundert vor Descartes, die Bewegung der menschlichen Seele durch die Musik. Seitdem steht im Mittelpunkt des musiktheoretischen Diskurses der differenzierte Einsatz musikalischer Mittel zur Hervorbringung von Gemütsregungen. Descartes entwickelte in Les Passions de l’âme einen auf Liebe, Hass, Freude, Traurigkeit, Begehren und Bewunderung reduzierten Katalog der Leidenschaften. Seine Reduktion erklärt sich aus dem Descartes’ Überlegungen zugrundeliegenden Rationalismus: Bereits in den Prinzipien der Philosophie (1644) hatte er die Funktion der Seele als Steuerung der Emotionalität wie des Denkvermögens ausgemacht und ihren Sitz im Gehirn, mithin also den Verstand als Regulativ für die Leidenschaften verortet. Descartes’ Katalog wird von Athanasius Kircher in der Musurgia universalis (Schwäbisch Hall 1650) auf acht, von Friedrich Wilhelm Marpurg (in den Kritischen Briefen über die Tonkunst mit kleinen Klavierstücken und Singoden von 1759/1760) schließlich auf sogar 27 Affekte erweitert (vgl. WISSMANN 2010, S. 24). Die Musik spielt in Les passions de l’âme nur ganz am Rande eine Rolle; auch die im Musicæ Compendium entwickelten Überlegungen werden nicht noch einmal aufgegriffen.
Affekt und Tugend
Johann Mattheson bezieht sich schon im zweiten Teil der Critica musica von 1725 besonders deutlich auf Descartes’ Lehre mit dem Ausdruck „Lehre de Affectibus“ im Zusammenhang mit der Kritik an Benedetto Marcellos Psalmkompositionen (vgl. BUELOW 1983, S. 399); von Bedeutung ist in diesem Kontext bereits Mathesons Forschendes Orchestre von 1717 mit erweiterten Bemerkungen zur philosophischen Basis eines rationalen Systems von Emotionen (vgl. CANNON 1947, S. 84). Mattheson beruft sich schließlich selbst in seinem musiktheoretischen Hauptwerk, dem Vollkommenen Capellmeister von 1739, ausdrücklich auf Descartes (MATTHESON 1739, S. 15, vgl. PETERSEN 2002, S. 42–77). Eine Systematik in den auf eine Affektenlehre abzielenden Passagen ist aber trotz des enzyklopädischen Anspruchs des Capellmeisters nicht erkennbar. Für Mattheson verbinden sich „Affect“ und „Tugend“ miteinander (vgl. FEES 1991, S. 110–111): „Wo keine Leidenschafft, kein Affect zu finden, da ist auch keine Tugend. Sind unsere Passiones kranck, so muss man sie heilen, nicht ermorden“ (MATTHESON 1739, S. 15) – die Affekte erhalten eine kathartische Funktion. Tugend wird bei Mattheson definiert als „eine wol-eingerichtete und klüglich-gemäßigte Gemüths-Neigung“ (ebd.). Wer keine Leidenschaften in sich trage, könne keine Tugend erwerben.
Stichwort
Johann Mattheson
Der 1681 als Sohn eines reichen Kaufmanns in Hamburg geborene Mattheson erhielt eine umfassende Ausbildung, unter anderem beim Gottorfer Hofkapellmeister Johann Nicolaus Hanff (1663–1711). Er sang früh als Solist an der neugegründeten Hamburger Oper und komponierte 1699 sein erstes eigenes Musiktheaterwerk. Ab 1704 übte er eine Position als Hofmeister, Sekretär und Korrespondent des englischen Gesandten aus, den er zunächst (bis 1709) neben seiner Tätigkeit als Opernsänger und -komponist sowie bis ins hohe Alter beibehielt; 1718–1728 wurde er darüber hinaus Musikdirektor am Hamburger Dom. Der Großteil seiner musiktheoretischen Schriften entstand in den zwanziger und dreißiger Jahren, darunter sowohl praktische Schriften wie die Generalbaßschule (1731), aber auch ein großer Umfang an Musikkritiken, zum Teil in selbst herausgegebenen Zeitschriften. Er komponierte sechs Opern sowie über 30 Oratorien und Kammermusik, übersetzte Romane und Fachliteratur ins Deutsche. Mattheson starb 1764 (vgl. BÖNING 2011).
In seinem Hauptwerk, dem Vollkommenen Capellmeister (1739), versucht Mattheson der Kontrapunktlehre auf der Basis mathematischer Erwägungen – der Substanz der traditionellen „musica poetica“ – eine ästhetisch begründete Melodielehre entgegenzusetzen und die ältere Disziplin zwar nicht außer Geltung zu setzen (ablesbar an einer Kompositionslehre im dritten Teil des Vollkommenen Capellmeisters), aber doch durch die neuere aus der Position einer Grundlehre der Musiktheorie oder der musikalischen Satzlehre zu verdrängen. Im Vollkommenen Capellmeister ist darüber hinaus eine intensive Beschäftigung mit der Historie zu konstatieren: Nicht nur durch die ständige Bezugnahme auf historische Autoritäten, sondern auch durch eine Betrachtung von Satzlehre vor dem Hintergrund eines entstehenden Geschichtsbewusstseins wird der Vollkommene Capellmeister zu einem ersten Scheitelpunkt in der Entwicklung der Musikgeschichte als Wissenschaft (vgl. PETERSEN 2017a, S. 321–323).
„Affektenlehre“
Die barocke Theorie kennt den Begriff „Affektenlehre“ nicht, er wird auch nicht von den zeitgenössischen Schreibern benutzt. Offensichtlich ist dieser Terminus unbekannt in der Musikliteratur des 17. Jahrhunderts, und noch im 19. Jahrhundert wird ihm keinerlei Stellenwert beigemessen (vgl. BUELOW 1983, S. 397). Er ist eine Erfindung der deutschen Musikwissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts: Erstmals erscheint der Begriff bei Arnold Schering 1907 und wird 1911 ausführlich von Herrmann Kretzschmar aufgegriffen (vgl. ebd., S. 403). Wenn aber der Terminus für die zeitgenössische musikalische Praxis demnach gar nicht existiert, ist einerseits zu fragen, inwieweit diese als Kompositionsprinzip für die schaffenden Musiker gelten konnte, andererseits aber vor allem, wie dieser Terminus in den Schriften Matthesons zu verstehen ist – insbesondere unter Berücksichtigung der von Mattheson selbst hergestellten Beziehung zu Descartes’ Arbeiten. Der Begriff „Affektenlehre“ erscheint insgesamt dreimal in den Schriften Matthesons, erstmals im zweiten Teil der Critica musica von 1725 im Zusammenhang mit der Erörterung von zu vertonenden Texten.
Abb. 2.3 Johann Mattheson (Kupferstich von Johann Jakob Haid)
Quelle
Johann Mattheson,
Critica Musica. D.i. Grundrichtige Untersuch- und Beurtheilung/Vieler/theils vorgefassten/theils einfältigen Meinungen/Argumenten und Einwürffe/so in alten und neuen/gedruckten und ungedruckten/Musicalischen Schriften zu finden. Zur müglichsten Ausräutung aller groben Irrthümer/und zur Beförderung eines bessern Wachsthums der reinen harmonischen Wissenschaft/in verschiedene Theile abgefasset/Und Stück-weise heraus gegeben Von Mattheson […], Hamburg/im May 1722. (Band II:) CRITICAE MUSICAE Tomus Secundus. d.i. Zweyter Band der grund-richtigen Untersuch- und Beurtheilung vieler, theils guten, theils bösen, Meynungen, Argumenten, und Einwürffe, so in alten und neuen, gedruckten und ungedruckten musikalischen Schriften befindlich: zur Ausräutung grober Irrthümer, und zur Beförderung bessern Wachsthums der reinen Harmonischen Wissenschaft, in verschiedene Theile verfasset, und Stückweise herausgegeben von Mattheson […], Hamburg 1725, Reprint beider Bände in einem Band Amsterdam 1964, hier: Band II, S. 324.
„Um Vergebung! Es kommen keine wiedrige Affecten zusammen in den Worten: Die Reichen müssen darben und hungern; aber die den HErrn suchen, haben keinen Mangel. Es ist eine blosse Betrachtung der Freundlichkeit Gottes, und eine Vergnügung über seiner Gerechtigkeit, dass er die Reichen hungern, und es den Gottesfürchtigen an nichts fehlen läßt. Diese antitheses geben gute Doppel-Fugen ab, weil sie, ob gleich mit verschiedenen Ausdrückungen, doch zu einerley Ende, concurriren. In der Affecten-Lehre muss also vorher eine viel grössere Insicht [sic] erhalten werden, wenn man hievon gesund urtheilen will.“
Der Terminus kann zunächst hier den Sinn eines „echten“ Kompositums haben – Affekten-Lehre als die Lehre von den Affekten, ganz ohne didaktische Bezüge oder (wie man bei Mattheson vermuten könnte) rhetorische Implikationen. Sachlich geht es hier um die Vertonung von Psalm 34,10 und um eine Auseinandersetzung mit Bokemeyers Schrift Der melodische Vorhoff – Bokemeyer hatte zu den Psalmversen bemerkt, hier stieße „wiedrige Affection“ zusammen.
Das zweite Auftreten dieses Begriffs findet sich in seinem Musicalischen Patrioten von 1728, ist aber nur verständlich im Zusammenhang mit der dritten Erscheinung des Terminus „Affektenlehre“. Am Ende des dritten Kapitels des Ersten Theils im Vollkommenen Capellmeister, „Vom Klange an sich selbst, und von der musicalischen Natur-Lehre“ überschrieben, heißt es:
Quelle
Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Das ist gründliche Anzeige aller derjeniger Sachen, die einer wissen, können, und vollkommen innehaben muss, der einer Capelle mit Ehren und Nutzen vorstehen will: zum Versuch entworfen von Mattheson, Hamburg 1739, Reprint Kassel 1954, 61995 (= Documenta Musicologica. Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles V, hg. von Margarete Reimann); Neusatz hg. von Friederike Ramm, Kassel 1999, S. 72
„Mein weniger Rath gehet zum Beschlusse dieses Haupt-Stückes, welches die Natur-Lehre des Klanges mit der Affecten-Lehre einiger und nöthiger Maassen verknüpfet, dahin: Man suche sich eine oder andre gute, recht gute poetische Arbeit aus, in welcher die Natur lebhafft abgemahlet ist, und trachte die darin enthaltene Leidenschafften zu unterscheiden. Denn es würden manchem Setzer und Klang-Richter seine Sachen ohne Zweifel besser gerathen, wenn er nur bisweilen selbst wüste, was er eigentlich haben wollte.“
Mattheson setzt diesen Passus hinter eine Zusammenstellung von Erklärungen, die die „Natur-Lehre“ und eben die Affekte betreffen. Offensichtlich meint er mit dem Terminus „Affecten-Lehre“ ein (Lehr-)Konzept, das der Natur-Lehre, der Physik, entspricht (vgl. BUELOW 1983, S. 399); die Passage aus dem Patrioten lässt in diesem Sinn eine komplementäre Zugehörigkeit der Affektenlehre zu ebendieser Natur-Lehre vermuten.
Descartes-Rezeption
In allen drei Fällen bezieht sich Mattheson auf die cartesische Theorie, menschliche Emotionen auf die Basis physischer bzw. physikalischer Gesetzmäßigkeiten zu stellen; So ist auch die Aufstellung einer Reihe von Affekten im Vollkommenen Capellmeister (S. 17–19) als Descartes-Rezeption zu verstehen: In De passionibus animae werden die Affekte in die den menschlichen Körpersäften (wo Descartes den Sitz der Leidenschaften vermutete) zugeordnete Klassen eingeteilt. Die Ausführungen Matthesons lesen sich dabei zum größten Teil wie eine Zusammenfassung des Traktats von Descartes – auch wenn dessen Definitionen sicherlich nicht als doktrinäre Affektenlehre verstanden werden können (vgl. BUELOW 1983, S. 402–403). Das Missverständnis, Mattheson eine endgültig ausformulierte Affektenlehre auf der Basis der Arbeiten etwa Descartes zuzuschreiben, basiert nicht zuletzt auf der 1713 im Neu-Eröffneten Orchestre veröffentlichten Tonartencharakteristik (MATTHESON 1713, S. 232–253), vermutlich die am häufigsten zitierte Stellungnahme Matthesons zu den Affekten: Mattheson beschreibt charakteristische Affekte für die siebzehn gebräuchlichsten Tonarten. Auch diese systematisch anmutende Reihung wird durch die sich anschließende Äußerung Matthesons konterkariert, wenn er – trotz eventueller Ergänzungsmöglichkeiten – bemerkt, dass „wir uns hierbey auch nicht länger auffhalten/sondern einem jeden nochmahls die Freyheit gerne lassen wollen/dass er einem oder andern Tohn solche Eigenschafften beylege/die mit seiner natürlichen Zueignung am besten übereinkommen/da man denn finden wird/dass der liebste Leib-Thon gar offte einer Abdanckung unterworffen seyn müsse“ (MATTHESON 1713, S. 253): Die Gemütsbewegung des Musikers gilt es zu vermitteln, und die Auflistung der Affekte in Hinsicht auf die siebzehn Tonarten korrespondieren ausschließlich mit Matthesons Temperament (vgl. CANNON 1947, S. 127)!
Die Vorstellung der Affektenlehre als ein didaktisches Modell neben der Natur-Lehre wird von Mattheson nicht wieder aufgegriffen; der Begriff erscheint auch nicht bei den Mattheson historisch nahestehenden Theoretikern wie Scheibe, Marpurg oder C. Ph. E. Bach (vgl. BUELOW 1983, S. 400). So ist es Matthesons Ziel, mit der Einbindung der Affekte als notwendiges Element seiner Lehre der Frage nach der Natur des musikalischen Ausdrucks nachzugehen; seine Hinweise, inwieweit der Komponist sich die Qualitäten der Affekte zunutze machen kann, sind elementare Bestandteile der späteren Inventionslehre (vgl. wbd., S. 404). Vor allem aber entscheidend ist Matthesons Haltung, dass ein musikalischer Gedanke sowohl syntaktisch als auch semantisch einen Affekt verkörpert – ablesbar aus der oben zitierten Bestimmung insbesondere mit der Melodie als Affektträger.
Mattheson versucht mit seinem Entwurf einer Melodielehre im Vollkommenen Capellmeister nichts Geringeres, als der Kontrapunktlehre auf der Basis mathematischer Erwägungen – der Substanz der traditionellen ‚musica poetica‘ – eine ästhetisch begründete Melodielehre entgegenzusetzen und die ältere Disziplin zwar nicht außer Geltung zu setzen, aber doch weitgehend zu verdrängen. Matthesons Perspektive stützt sich allerdings notwendigerweise auf die Arbeiten René Descartes’ – explizit oder implizit, auch vermittelt über die Philosophie John Lockes (vgl. GJERDINGEN 2002, S. 958).
Descartes hatte vermutlich schon 1646 seine Passions de l’âme abgeschlossen, allerdings wurde das Werk erst 1649 in Amsterdam und Paris veröffentlicht; Athanasius Kircher beendete 1647 seine monumentale Musurgia universalis in Rom – ohne Kenntnis der Schrift Descartes’, mit dem er offenbar auch keine Korrespondenz pflegte. Die voneinander unabhängig entstandenen Schriften Descartes’ und Kirchers stellen gleichermaßen die Bewegung der Gemüter als primäres Ziel der Musik heraus – wie Descartes schon zu Beginn seines Musicæ Compendium von 1618 (vgl. PALISCA 2006, S. 193): „Hujus objectum est Sonus. Finis ut delectet, variosque in nobis moveat affectus“ – „Der Zweck des Tones ist letzten Endes, zu erfreuen und in uns verschiedene Gemütsbewegungen hervorzurufen“. Heinrich Besseler hat bereits 1959 unter Verweis auf Martin HEIDEGGER (1950, S. 80–82) hervorgehoben, dass Descartes später ergänzend in den Meditationes de prima philosophia durch methodischen Zweifel die Erkenntnis »cogito, ergo sum« als das einzig Sichere herausstellt: „Wenn Descartes das Sichere ‚Subjekt‘ nennt, so bedeutet dieses Wort […] zugleich das Zugrundeliegende im Sinne der Metaphysik. So wird nun philosophisch der Mensch zur Bezugsmitte alles Seienden“ (BESSELER 1959, S. 41; vgl. LOHMANN 1979, S. 85–86) – in der Philosophie wie in der Musiktheorie: Hier beginnt die Neuzeit.
Wissens-Check
– Welche Rolle spielt die Empirie in Descartes’ Musicæ Compendium?
– Welches Ziel haben die acht Leitsätze Descartes’?
– Wie bestimmt Descartes die diatonischen Intervalle?
– Wie stellt Marin Mersenne das Phänomen der Obertöne dar – und welchen Zusammenhang mit der Darstellung bei Descartes gibt es?
– Inwiefern bezieht sich Johann Mattheson noch 1739 auf Descartes?