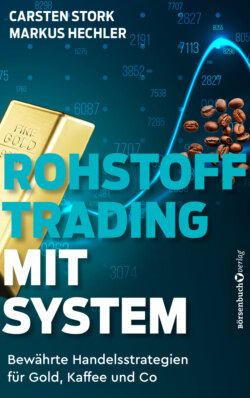Читать книгу Rohstoff-Trading mit System - Carsten Stork - Страница 23
ОглавлениеKAPITEL 5
RISIKO- UND MONEY-MANAGEMENT
Der vermeintlich trockene und für manche Trader auch langweilige Teil in diesem Buch ist aber gleichzeitig ein sehr wichtiger: das Risiko- und Money-Management beim Handeln an den Finanzmärkten. Gutes Risikomanagement wird eine verlustbringende Strategie nicht in eine profitable verwandeln, umgekehrt kann aber eine höchst erfolgreiche Handelsstrategie mit schlechtem Risikomanagement gegen die Wand gefahren werden. Stellen Sie sich vor, eine Handelsstrategie mit einer unglaublichen Gewinnwahrscheinlichkeit von 90 Prozent wird von einem unerfahrenen Händler umgesetzt, der stets alle angefallenen Gewinne, inklusive des ursprünglichen Kapitals, beim nächsten Trade einsetzt. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit ist er spätestens nach dem zehnten Trade pleite. Beim Traden können wir die Märkte nicht kontrollieren, aber wir können genau festlegen, wie viel wir riskieren möchten.
Ein erfolgreicher Händler kann auf lange Sicht nur überleben, wenn er sich an die strikten Regeln des Risiko- und Money-Managements konsequent hält. Die Fähigkeit, mit Verlusten umgehen und mit den daraus resultierenden emotionalen Schwankungen leben zu können, ist im Trading essenziell. Gewinnen kann schließlich jeder, doch in schwierigen und verlustreichen Zeiten emotional stabil zu bleiben muss erst gelernt werden. Hier kommt das Management des Trading-Risikos sowie des eingesetzten Kapitals ins Spiel.
Gibt es Trading-Set-ups, die einen Gewinn zu 100 Prozent garantieren? Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Frage mit Nein beantwortet werden muss – es sei denn, der Trader verfügt über Insiderinformationen, die ihm einen Informationsvorsprung gegenüber dem Rest der Marktteilnehmer verschaffen. Doch selbst wenn man als Anleger über Informationen verfügt, die eine gewisse Kursreaktion vermuten lassen, ist das noch keine 100-prozentige Garantie, dass sich der Markt dann auch genauso entwickelt. Nehmen wir beispielsweise an, dass der Insider Informationen über eine bestehende Kapitalerhöhung oder eine Gewinnwarnung hat und sich dementsprechend positioniert. Davon abgesehen, dass sich der Anleger strafbar macht, hat er auch mit diesem Informationsvorsprung keine 100-prozentige Garantie, dass sich die Aktie in die gewünschte Richtung bewegt und er einen Gewinn erzielt. Leider gibt es auch keine (uns bekannten) Trading-Ansätze, weder systematische noch diskretionäre, die eine 100-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit besitzen. Das oberste Gebot beim Trading ist der Schutz des Kapitals und die Vermeidung eines Totalverlusts, deshalb ist es wichtig, die geeignete Positionsgröße zu bestimmen. Ist die Positionsgröße zu groß, riskieren wir bei einer Verlustserie (Drawdown), pleitezugehen. Ist die Positionsgröße zu klein, begrenzen wir unser Gewinnpotenzial. Es gilt, die optimale Positionsgröße zu finden, die zum eingesetzten Kapital beziehungsweise zum Risikoprofil des Anlegers passt. Angenommen, man verfügt über ein Trading-Kapital von 50.000 Euro und begrenzt das Risiko pro Trade auf fünf Prozent des Trading-Kapitals:
Festgelegter Prozentsatz x Trading-Kapital = Risiko pro Trade
5 % x 50.000 Euro= 2.500 Euro pro Trade
Beim Handel mit Optionsscheinen, Aktien oder Mini-Futures ist die Bestimmung der Zahl der Kontrakte einfach:
2.500 Euro/Kurs des Instruments. Somit kann durch Auf- und Abrunden relativ genau die zu kaufende Stückzahl ermittelt werden.
Beim Handel mit Futures stellt sich die Umsetzung komplizierter dar. Definiert man den mit einem Future einzusetzenden Betrag (2.500 Euro), kann es durchaus vorkommen, dass je nachdem, wie hoch der Stop-Loss gewählt wurde, entweder eine zu große oder eine zu kleine Position eingegangen wird. Im seltensten Falle wird es möglich sein, den Stop-Loss so zu definieren, dass genau 2.500 Euro eingesetzt werden können. Die aggressive Variante wäre es, jede Trade-Größe über 1,5 Kontrakte auf 2 aufzurunden, die defensive Variante, auf 1 abzurunden. Die Problematik hat der Scheinehändler nicht, er kann bei jedem Trade immer den gleichen Betrag einsetzen (siehe Kapitel 6.14: Die Umsetzung mit Futures oder Optionsscheinen).
Wenn ein systematischer Trading-Ansatz gehandelt wird, kann mithilfe von Backtests herausgefunden werden, wie hoch der maximale Verlust (Drawdown) in der Vergangenheit war. Verfolgt der Händler einen diskretionären Ansatz, sollte er ein Trading-Journal führen, in dem alle Trades mit den dazugehörigen Gewinnen und Verlusten notiert werden. So ist es möglich, sich auf den schlimmsten Fall emotional vorzubereiten, denn wir wissen, der nächste Drawdown kommt bestimmt, und es ist unmöglich, immer nur zu gewinnen.
Es gibt keine Vollkommenheit und auch kein perfektes Modell zur richtigen Bestimmung der Positionsgröße, es sollte nur gewährleistet werden, den Totalverlust zu vermeiden und die Trading-Gewinne möglichst zu maximieren. Wenn ein Trading-Modell mit einem festgelegten Prozentsatz angewandt wird, das jedes Mal 50 Prozent des Kapitals riskiert, ist das Handelskonto nach zwei Verlusten hintereinander um 75 Prozent geschrumpft. Das ist selbstmörderisch. Wir setzen aktuell in unserem ALGOreport jeden Trade mit zehn Prozent des Depotwerts um und wählen normalerweise einen Stop-Loss, bei dem nicht mehr als 50 Prozent pro Trade verloren wird. Je nach Volatilität oder Set-up des Underlyings behalten wir uns auch vor, den Trade nur mit 50 Prozent einzugehen, sodass flexibel entweder billiger zugekauft wird oder nach einer Bestätigung die Position auf 100 Prozent vergrößert werden kann. Durch die Stop-Loss-Wahl ist unser Risikoansatz mit fünf Prozent als eher konservativ einzustufen. Diese Art von Risikomanagement wird auch als „Fixed Fractional Money Management“ bezeichnet. Die Grundannahme ist dabei folgende: Das Risiko wird größer oder kleiner, wenn sich das Depotvolumen verändert. Bei einem Anstieg des Depots werden die Positionen größer, in einer Verlustphase werden die Einsätze geringer.
Es gibt aber auch einige Trader, die die sogenannte „Martingale“-Strategie wählen, ein negatives Progressionssystem. Hierbei handelt es sich um eine extrem riskante Form des Risiko- und Money-Managements, die nur von erfahrenen Händlern angewandt werden sollte. Der Trader beginnt die Martingale-Strategie, indem er seinen Einsatz immer weiter erhöht, je länger eine Verlustserie andauert. Im Extremfall verdoppelt der Händler seine Positionsgröße, um die angefallenen Verluste wieder auszugleichen. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent ist es somit theoretisch nur eine Frage der Zeit, bis das verloren gegangene Kapital wieder zurückgewonnen wird. Das Problem bei dieser höchst riskanten Strategie ist, dass man im Extremfall riesige Summen einsetzen muss und wahrscheinlich nur einen kleinen Profit macht, nämlich den ursprünglichen Einsatz.
Gute Händler sind gute Risikomanager, denn man sollte sich immer im Klaren sein, was der Markt einem antun kann. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es wesentlich einfacher ist, erfolgreich zu handeln, wenn man einen Trading-Partner hat und nicht allein handelt. Der Trading-Partner hilft einem, rational und ehrlich zu bleiben und sich nicht selbst zu belügen. Nicht der Gewinner, sondern der beste Verlierer wird am Ende erfolgreich sein, denn die oberste Priorität ist, das Pleiterisiko zu minimieren!
5.1Extrembeispiel Immobilien- und Finanzkrise 2008/09: Ein Trading Floor wird vaporisiert
DER AKTIONÄR: Herr Stork, wie haben Sie damals die sogenannte Immobilienblase und die daraus resultierende Finanzkrise erlebt?
Stork: Wir Trader waren in der Zeit vor 2007 schon skeptisch, dass es an den weltweiten Märkten für längere Zeit ein „Goldilocks“-Szenario geben kann. Aber der Markt handelte anders, viele Marktteilnehmer hielten den amerikanischen Häusermarkt schon seit mehreren Jahren für überbewertet, dennoch wurden sämtliche Warnsignale in den Wind geschlagen. Erstmals persönlich wurde ich mit dem Thema im August 2007 konfrontiert, als ein Anteil an einem sogenannten Subprime-Fonds massiv unter die Räder kam. Man muss sich das so vorstellen: Die amerikanischen Banken vergaben gegen immer weniger Sicherheiten Immobilienkredite, bündelten diese Kredite dann mit einem Triple-A-Rating versehen und verkauften sie wieder an andere Marktteilnehmer. Im Sommer 2007 kam es nun verstärkt zu Zahlungsausfällen der Kreditnehmer, wodurch eine Neubewertung dieser Portfolios erfolgte und die „Experten“ rasch feststellten, dass es sich hierbei um eigentlich nicht verkäufliche Ramschanleihen handelte. Es kam zu einem Vertrauensverlust der Banken untereinander, die Interbanken-Zinssätze stiegen rasant an, teilweise wurde gar kein Geld mehr verliehen. Viele Finanzinstitute hatten auch langfristige Anleihen begeben, die sie mit kurzfristigen Krediten bedienten. Durch den Anstieg der kurzfristigen Zinsen kam es zu Liquiditätsengpässen, was wiederum Verkäufe in anderen Assetklassen auslöste. Ein klassischer Teufelskreis, der etliche Banken und Finanzinstitute in den Abgrund riss. Prominenteste Beispiele sind sicherlich Bear Stearns und Lehman Brothers. Der größte Trading Floor dieser Zeit war in Stamford, Connecticut. Ich war dort noch im Dezember 2007 zu Besuch und schwer beeindruckt von der Größe des Handelssaals. Eines fiel jedoch auf: In einer der normalerweise voll besetzten Reihen waren circa acht Plätze leer und die Schirme dunkel. Auf Nachfrage sagte man uns: Das ist die „Mortgage-Trading“-Abteilung, die vor einiger Zeit nach Hause geschickt wurde. Das war eigentlich der Anfang vom Ende. Mit rasanter Geschwindigkeit wurden in den verschiedenen Banken zuerst Eigenhandelsabteilungen aufgelöst, dann kam der Kundenhandel an die Reihe, er wurde weitestgehend automatisiert. In den Monaten danach wurden auch die Sales- und Research-Abteilungen auf ein Minimum reduziert. Der Ruf nach Regulierung wurde laut, in Windeseile wurden Gesetze erlassen, die eine ganze Industrie mehr oder weniger vernichteten. Mir war damals klar: Das wird nichts mehr. Der Markt ist auf Jahre tot. Ich glaube, von unseren Arbeitskollegen gibt es heute vielleicht noch eine Handvoll, die dem Banking treu geblieben sind.
Quelle: New York Post
ABBILDUNG 5.1 | TRADING FLOOR_VORHER_NACHHER_NY POST IN STAMFORD
Links: Trading im Trading Floor Stamford im Jahr 2007, voll besetzt Rechts: Nach der Finanzkrise
5.2Die zehn häufigsten Gründe, weshalb Trader kein Geld verdienen
Der Eigenhandel an den unterschiedlichen Märkten ist nicht einfach. Viele Neulinge verlässt nach einiger Zeit aufgrund von Misserfolgen der Mut, und sie werden unsicher. Oft fehlt an diesem Punkt bereits das notwendige Kapital, um weiterzutraden und aus den Fehlern zu lernen. Grundregeln des Tradings widersprechen auch den natürlichen Verhaltensweisen des Menschen, und nicht selten steht das eigene Ego im Weg. Kurzfristig geplante Kursspekulationen werden dann zu strategischen Investments, über die sich Kinder und Enkelkinder freuen dürfen. Hier sind zehn Gründe, weshalb die meisten Händlerneulinge nie profitabel traden werden:
1.Kein Risiko- und Money-Management.
2.Um groß zu gewinnen, wird pro Trade so viel Kapital riskiert, dass die Verluste es mathematisch unmöglich machen, unter dem Strich zu gewinnen.
3.Es gibt weder einen Plan noch ein System – Meinungen und Emotionen bestimmen die Handelsentscheidungen.
4.Trade-Einstiege basieren auf Hoffnung, Trade-Ausstiege auf Angst.
5.Es werden die falschen Märkte gehandelt – Unkenntnis führt zu kostspieligen Fehlentscheidungen.
6.Das Trading-Konto ist zu klein, die Provisionen und Gebühren zu hoch.
7.Ungeduld – FOMO (Fear Of Missing Out), die Angst, etwas zu verpassen.
8.Verluste werden zu lange laufen gelassen, Gewinne zu früh mitgenommen.
9.Der Wunsch, das Hoch zu verkaufen und das Tief zu kaufen, und damit den Trend komplett zu verpassen.
10.Das eigene Ego – es besser zu wissen als der Markt.