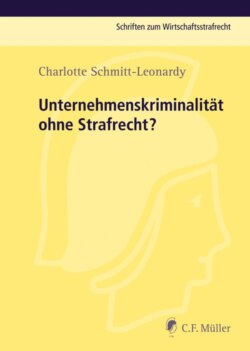Читать книгу Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht? - Charlotte Schmitt-Leonardy - Страница 83
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeil 1 Interdisziplinäre Grundlagen der Unternehmenskriminalität › C › IV. Unternehmenskriminalität – ein „täter“orientierter Versuch der Begriffsbildung
IV. Unternehmenskriminalität – ein „täter“orientierter Versuch der Begriffsbildung
146
Das Credo der Chicago School, der Sutherland angehörte, war „get inside the actor's perspective“, womit in erster Linie zu konsequenter Empirie und Feldforschung – „Leave your textbook behind! [...] Go into the district and get your feet wet!“[1] – aufgerufen wurde. In Anbetracht der dürftigen empirischen Befunde ist die Aufforderung „get inside“ schwer zu realisieren, weil vor allem die Unternehmen kooperativ sind, aus denen keine oder wenig Wirtschaftsstraftaten hervorgegangen sind.
147
Die täterorientierte Herangehensweise Sutherlands war jedoch – wie gesehen – mehr als der Aufruf nach konsequenter, qualitativ-empirischer Forschung: Sie bestand in der Einbeziehung eines bisher tabuisierten Bereichs – der gesellschaftlichen Elite – in die kriminologische Forschung. Aufgrund seiner Fokussierung auf die „Herren im weißen Kragen“ tragen seine Thesen für den weiteren Verlauf der Untersuchung nur noch bedingt; er bleibt jedoch gewissermaßen Gewährsmann, denn seine grundsätzliche Herangehensweise wird zum Vorbild genommen. Statt prozessualtaktischen oder schadensbezogenen Definitionsvorschlägen den Vorzug zu geben und dabei entweder zu unterstellen, dass Unternehmen – weil sie die essentialia der Marktwirtschaft sind – die Hauptakteure der so definierten Wirtschaftskriminalität sind oder sie als Opfer schützen zu wollen, wird der Aktionsradius dieser vermeintlichen Akteure beleuchtet. Die täterorientierte Herangehensweise hat damit den großen Vorzug, zwei implizite Feststellungen in der dogmatischen Diskussion um die Unternehmensstrafe gründlich untersuchen zu wollen: Zum einen, dass Unternehmen Täter im herkömmlichen bzw. in einem neu zu definierenden Sinne sind. Zum zweiten, inwiefern diese kriminell agieren. Damit wird ein Forschungsansatz, der grundsätzlich auf der Einsicht beruht, dass Kriminalitätsentwicklung mit Persönlichkeitsfaktoren des Menschen zusammenhängt und dessen Verhalten beeinflussbar ist, auf ein neues Gebilde angewandt. Bisher war es nur der Mensch, dessen Handeln, Motivation und Schuldfähigkeit untersucht wurde; auch wenn es um Handlungen ging, die in Gemeinschaft mit anderen erfolgten.[2] Da jedoch die erste Hypothese – das Unternehmen als Opfer – in den empirischen Befunden nicht bestätigt wurde, wird im Folgenden die zweite Hypothese des Unternehmens als Kriminalitätsverursacher sui generis weiter verfolgt. Hierbei wird es in einigen Definitionsansätzen als Kriminalitätskontext nahegelegt[3] und in strafrechtsdogmatischen Überlegungen als Täter erwogen.