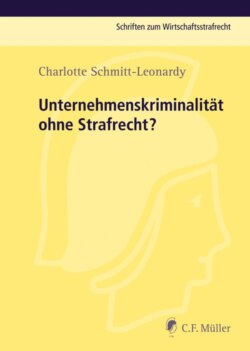Читать книгу Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht? - Charlotte Schmitt-Leonardy - Страница 87
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Unternehmen als Lern- und Neutralisierungskontext – sozialpsychologische Gesichtspunkte
Оглавление150
Im Zusammenhang mit Schießbefehlen des Nationalen Verteidigungsrates der DDR und der vorsätzlichen Tötungen von Flüchtlingen durch Grenzsoldaten der DDR wurde die durch kollektive Neutralisationsmechanismen ausgelöste „Paralysierung oder Suspendierung sonst wirksamer Normvorstellungen, Kulturverbote, Hemmungen und Gewissensreaktionen“[1] diskutiert.[2] Diese vorsätzlichen Tötungen unbewaffneter Flüchtlinge wurden als „offensichtliche und unerträgliche Verstöße gegen elementare Gebote der Gerechtigkeit und gegen völkerrechtlich geschützte Menschenrechte“[3] bezeichnet, aus diesem Grunde nicht als diese Handlungen legitimierendes Recht betrachtet; und dennoch stellten sie für die Soldaten im damaligen Kontext kein derart hemmendes unerträgliches Unrecht, sondern lediglich „Pflichterfüllung“ dar.[4] Insbesondere zwei – gruppenbedingte – Neutralisierungsprozesse spielen hierbei eine Rolle, die auch auf Unternehmensebene beobachtbar sind: unmittelbare und mittelbare Prozesse.
151
Als unmittelbare Neutralisierungsprozesse werden solche bezeichnet, die primär von dem Kollektiv auf das Individuum einwirken, also unmittelbar auf die Struktur des Kollektivs zurückführbar sind.[5] So wirken z. B. Wertvorstellungen und gruppeninterne Verhaltensregeln, die der geltenden Rechtsordnung zuwider laufen, unmittelbar auf die Individuen ein und können zur Bildung einer eigenen, subjektiv überlegenen Werteordnung führen.[6] Durch die dauerhafte Verinnerlichung dieser „parallelen Werteordnung“, die zu einer Beherrschung durch diese moralischen oder funktionalen Prinzipien führt, kann eine Neutralisation gegenüber dem Normappell des Gesetzgebers entstehen. Da hier der entscheidende Normappell durch die Etablierung interner Verhaltensanforderungen überdeckt und durch Phänomene der Gewöhnung etabliert wird, kann die eigentliche Rechts(guts)verletzung nicht mehr als Unrecht wahrgenommen werden, sondern wird mitunter als Selbstverständlichkeit begriffen.[7] Besondere Relevanz hat dieser sozialpsychologische Aspekt in organisatorischen Machtapparaten, die von einer hierarchischen Befehlsgewalt geprägt sind. Diese Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie als Ganzes außerhalb des Rechts stehen und eine sehr autoritäre Struktur aufweisen, der sich das Individuums nicht entziehen kann – insbesondere weil eine Verweigerung durch das Recht nicht geschützt wird.[8]
152
Allerdings zeigte Milgram in seinem Experiment,[9] dass auch formell nicht-autoritäre Aktionszusammenhänge einen deutlich neutralisierenden Effekt auf Individuen haben können. Er konstatierte eine außerordentlich hohe Gehorsamsbereitschaft gegenüber evident unmoralischen und auf die Anwendung von Gewalt gerichteten Befehlen, auch wenn sie im Widerspruch zu ihren Wertvorstellungen standen. Milgram folgerte hieraus zwei Funktionszustände: zum einen der Zustand der Autonomie, in dem das Individuum sich als für seine Handlungen verantwortlich erlebt, und zum anderen der Agens-Zustand, in den es durch den Eintritt in ein Autoritätssystem versetzt wird und nicht mehr aufgrund eigener Zielsetzungen handelt, sondern zum Instrument der Wünsche anderer wird. Dieser Agens-Zustand wurde in Milgrams Experiment leichter erreicht, wenn die Probanden den vermeintlichen Schüler nicht sahen[10] und ihr Unrechtsbewußtsein nicht durch die Sichtbarkeit des moralischen Unrechts geweckt werden konnte.
153
Diese Beobachtungen stimmen nicht nur mit makrokriminologischen Forschungsergebnissen überein, die ebenfalls eine Deindividualisierung des Opfers festhalten,[11] sondern auch mit den Aussagen Sutherlands, die er im Zusammenhang mit der Theorie differentiellen Kontakte trifft.[12] Desweiteren enthalten sie insofern Parallelen zu den empirischen Erkenntnissen zur Wirtschaftskriminalität, als die Unsichtbarkeit des Rechtsbruchs, fehlenden Affektivität der Handlungen, die Anonymität der Opfer und Neutralisierungstechniken mehrfach Erwähnung fanden. Der „opferbezogene Abstrahierungsprozess“[13] lässt sich also leicht in Übereinstimmung mit dem erläuterten theoretischen Bezugsrahmen bringen; die aus sozialpsychologischer Sicht erklärte „Konformität abweichenden Verhaltens“ dagegen schwer. Laut Jäger existiert eine „Kriminalitätstheorie, die solche Einflüsse auf das individuelle Verhalten, wie überhaupt die komplexen Entstehungsbedingungen kollektiver Verbrechen zu erfassen sucht“ nur in fragmentarischen Ansätzen.[14] Grund ist, dass die Zuschreibung von strafrechtlicher Verantwortung im Allgemeinen bei der Abweichung von Normen erfolgt und hier nicht Abweichung, sondern Konformität einen Hauptbeweggrund im Handeln des Einzelnen darstellt. Ebenso wie Alwart auf semantischer Ebene mit Bedacht vorging und den Begriff Mesokriminalität statt Makrokriminalität in die Diskussion einführte, muss nun bei Erklärung dieser mesokriminellen Prozessen vorgegangen werden. Die Makrosoziologie bietet gedankliche Anknüpfungspunkte, wirft dabei jedoch auch zusätzliche Fragen auf: Zum einen wird grundsätzlich zu differenzieren sein, wo Überschneidungen und wo Unterschiede in der Frage des Einflusses des Kollektivs auf das Individuum bestehen. Zum zweiten muss dort, wo eine (un-)mittelbare (kriminogene) Beeinflussung plausibel erscheint, geprüft werden, ob die Taten, die im Zusammenhang mit diesen gruppendynamischen Einflüssen zu sehen sind, als „persönlichkeitsfremd“[15] und – wenn ja – als Kollektiv- oder Unternehmensgesteuert anzusehen sind.
154
Hinsichtlich des erstgenannten Aspekts, der „Konformität des abweichenden Verhaltens“ im Unternehmen im Vergleich zu der „klassischen“ Makrokriminalität, gilt es die aktive Rolle des Staates zu sehen. Im engeren Sinne ist Makrokriminalität nämlich „staatsverstärkte Kriminalität“,[16] die gegen den eigenen Bürger gerichtet ist[17] und nicht lediglich Kriminalität zur Verteidigung irgendeiner Machtposition.[18] Im Unternehmenskontext erscheint also zumindest nicht zwingend, dass die Herausbildung von Gruppenemotionen und die bedingungslose Unterordnung gegenüber einer Befehlsgewalt, wie sie im makrokriminellen Kontext konstatiert wurde, typisch ist. Die Verweigerung bestimmter Anweisungen ist durchaus möglich und wird von der Rechtsordnung unterstützt bzw. sogar gefordert.[19] Wenn auch stabile rechtliche Rahmenbedingungen um einen „whistleblower Status“ immer noch erst im Entstehen begriffen sind, greifen dennoch arbeitsrechtliche Mechanismen zum Schutz der Unternehmensmitglieder ein.[20] Es ist jedenfalls fernliegend von einem Automatismus der Anweisungsumsetzung auszugehen, wie sie organisatorischen Machtapparaten auch nur ähnlich sein könnte. Das Unternehmen steht nicht als Ganzes außerhalb des Rechts, sondern hat sich einer grundsätzlich legalen Gewinnerzielungsabsicht verschrieben.[21]
155
Gleichwohl – deviantes oder gar kriminelles Verhalten kann sich als normalisierte Organisationspraxis[22] etablieren, wie am Fall Siemens nochmals exemplifiziert[23] werden soll: Es wird inzwischen[24] davon ausgegangen, dass in den Jahren 2000–2006 Schmiergeldzahlungen von über 1,3 Milliarden Euro aus verschiedenen – international involvierten – Unternehmensbereichen[25] des Siemens Konzerns heraus über ein sogenanntes „Netz schwarzer Kassen“ gezahlt wurden. Dieses Netz geht zurück auf mehrere Schwarzgeldkonten, die Siemensmitarbeiter seit den 90er Jahren in Österreich unterhielten und die seit 2000 nicht mehr direkt durch die Konzernzentrale gespeist werden konnten. Es etablierte sich in der Folge ein mehrstufiges Geflecht von Scheinberatungsfirmen mit Sitz in den USA, Österreich und den Virgin Islands, über die große Summen aus dem Konzern auf schwarze Konten nach Liechtenstein und in die Schweiz transferiert werden konnten. Von diesen Konten wurden die Bestechungszahlungen in diverse Länder[26] gezahlt, um Aufträge zu erhalten.[27] Insbesondere unter dem Druck eines Verfahrens der US Securities and Exchange Commission (SEC) und der eingeleiteten Verfahren in Deutschland[28] erfolgten umfangreiche strukturelle und personelle Veränderungen. Den Auftakt deutscher Gerichtsverfahren bildeten die Verfahren gegen den Finanzvorstand Andreas Kley und den ehemaligen Mitarbeiter Horst Vigener (beide Siemens Power-Generation) vor dem Landgericht Darmstadt. Kley hatte die interne Autorisierung, Zahlungen in unbegrenzter Höhe anzuweisen; er setzte dies unter anderem in einem etablierten – dem Zentralvorstand nach eigenen Äußerungen nicht bekannten – System zur Zahlung von Bestechungsgeldern um. Vigener kümmerte sich um Verwaltung und Abwicklung der Zahlungen über diverse Nummernkonten bei liechtensteinischen Banken. Zudem existierte eine weitere verdeckte Kasse in der Schweiz, die noch von der durch die Siemens AG übernommenen früheren KWU AG stammte und von Kleys Vorgänger unmittelbar übernommen worden war. Konkreter Anknüpfungspunkt des Falles war die Auftragsvergabe des 1999 europaweit ausgeschriebenen Projekts „La Casella“ zur Lieferung von Gasturbinen durch die italienische Enelpower. Im Rahmen der Ausschreibung verlangte der Geschäftsführer einer Enel-Tochter einen Millionenbetrag als Gegenleistung für eine Einflussnahme auf die Vergabeentscheidung; Kley veranlasste in der Folge eine Zahlung in Höhe von 2,65 Millionen Euro an diesen Geschäftsführer und ein weiteres geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Enelpower, und zwar über das Kontengeflecht in Liechtenstein. Im Hinblick auf das Mitte 2000 durch Enelpower ausgeschriebene Projekt „Repowering“ erfolgte eine weitere Zahlung an die Genannten.[29] Kley wurde wegen Bestechung ausländischer Angestellter und Untreue zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 400 000 Euro verurteilt. Der mitangeklagte Horst Vigener wurde wegen Beihilfe zur Bestechung zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich wurde ein Verfall und Wertersatz in Höhe von 38 Millionen Euro verhängt.[30] Das Gericht, das als Tatsacheninstanz für die kriminologische Betrachtung von besonderem Wert ist, stellte hierbei fest, dass strafschärfend gegenüber Kley die „besonders hervorgehobene Vertrauensstellung in der S. AG als für die Umsetzung der Compliance-Richtlinien zuständiger Finanzvorstand“ zu berücksichtigen war und ihn diesbezüglich nicht entlasten konnte, dass „in gewissem Maße noch ein korruptionsfreundliches Klima geherrscht hat“. Desweiteren wies das Gericht deutlich darauf hin, dass die Möglichkeit, über das liechtensteinische Kontensystem verdeckte Leistungen auf den Weg zu geben, zahlreichen Mitarbeitern bekannt gewesen sein musste, denn trotz Bestehens einer Compliance-Richtlinie bedurfte es nur eines gegenüber Kley signalisierten Zuwendungsbedarfs, um für „nützliche Aufwendungen“ abbuchen zu lassen; dieser Bedarf wurde durch die Mitarbeiter offenbar ohne Furcht vor persönlichen Konsequenzen angesprochen.[31] Im Revisionsverfahren hob der BGH das Urteil teilweise auf und qualifizierte das Führen schwarzer Kassen als Untreue, weil bereits die Errichtung schwarzer Kassen dem Entzug der Vermögenswerte gleichkomme, sodass schon durch Bildung der schwarzen Kasse ein Vermögensnachteil begründet würde.[32] In dem Verfahren vor dem Landgericht München wegen Auslandsbestechung in der Telefonsparte wurde die Siemens AG im Oktober 2007 zur Zahlung einer Geldbuße von einer Million Euro und einer Gewinnabschöpfung von 200 Millionen Euro verurteilt sowie zu erheblichen Steuernachzahlungen. Der frühere Siemens COM-Mitarbeiter Reinhard Siekaczek wurde 2008 wegen Veruntreuung von Firmenvermögen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und 108 000 Euro Geldstrafe verurteilt,[33] weil er in 49 Fällen insgesamt 49 Millionen Euro in schwarze Kassen abgezweigt haben soll, um sie anderen Siemens-Mitarbeitern für Bestechungshandlungen weltweit zur Verfügung stellen zu können. Obgleich er als Hauptverwalter des Netzes schwarzer Kassen galt, bezeichnete ihn der vorsitzende Richter als „Rädchen im System“, da die „gesamte Organisation“ bei Siemens und alle Kontrollinstanzen auf die Ermöglichung von schwarzen Kassen ausgerichtet gewesen sei.[34]
156
Korruption bei Siemens muss als übliche und institutionalisierte Geschäftspolitik zur Erlangung von Aufträgen gewertet werden, die zudem als strafrechtlich relevant – und damit kriminell – erkannt wurde. Dafür sprechen folgende Gesichtspunkte: Zum einen handelte es sich um Auslandsbestechung. Im Bereich der Inlandsgeschäfte wurde deutliche Zurückhaltung geübt, was darauf hindeutet, dass den Beteiligten die Strafbarkeit ihres Tuns bewusst war und der Aspekt der Aufdeckungswahrscheinlichkeit sowie – kulturell bedingte – Akzeptanz und Erfolgsaussicht von Korruption als Mittel der Auftragserlangung einkalkuliert waren. Dies mag auch mit strategischen Entscheidungen von Individuen auf Führungsebene zusammenhängen. Hierfür spricht der zweite Gesichtspunkt: Es handelte sich überwiegend um Fälle von Grand Corruption,[35] d. h. um die Schmierung von Funktionären auf den höchsten politischen und administrativen Ebenen – mithin zu einem hohen Preis. Die Schmiergelder und entsprechenden Transaktionen mussten also auf der Managementebene entschieden werden. Zum dritten[36] liegt eine – zumindest teilweise – Übereinstimmung mit den Zielen des Unternehmens nahe. Dies wird jedenfalls aus der Überlegung heraus plausibel, dass sich die involvierten Siemens-Beschäftigten nicht persönlich bereichert haben. Sie nahmen das strafrechtliche Verfolgungsrisiko auf sich und verstießen gegen unternehmensinterne Ethik- und Complianceregeln;[37] und verbesserten ihre Stellung im Unternehmen. Es ist also naheliegend einen Normalisierungsprozess hinsichtlich devianter Handlungsmuster und Sichtweisen innerhalb des Unternehmens Siemens zu vermuten und dies, obwohl Korruption negativ konnotiert war, was anhand der Codes of Conduct ersichtlich war.
157
Ebendiese Prozesse sind Gegenstand mikroinstitutionalistischer Ansätze in der Organisationsforschung, die davon ausgehen, dass Institutionen – in diesem Fall korrupte Praktiken – aus „reziproken Symbolen habitualisierter Verhaltensweisen bestehen, wobei die Bedeutungszuschreibung personenunabhängig erfolgt.“[38] Drei ineinander greifende Prozesse werden in jüngsten Forschungen[39] beschrieben, die zu einer „taken for granted“-Qualität devianter Handlungen führen: (1) explizite oder implizite Billigung, d. h. die Ermutigung bestimmter Mitarbeiter durch Vorgesetzte, wirtschaftliche Vorgaben auch durch korruptes Handeln zu erreichen. (2) Willfährigkeit, d. h. die Umsetzung der Ermächtigung zu korruptem Handeln aus Gründen der Anerkennung oder legitimen Autorität. (3) Institutionalisierung, d. h. die Implementierung von Korruption und dabei des Anscheins, entsprechende Handlungen seien nicht verwerflich. Dies würde insbesondere durch eine fragmentierte und auf Details von Sachverhalten fokussierte Sicht der Akteure erreicht. Diese, von Brief, Buttram und Dukerich beschriebenen Prozesse entsprechen den in Bezug auf die Wirtschaftskriminalität beschriebenen Neutralisierungsmechanismen.[40]
158
Der Unterschied besteht darin, dass neben der Gewöhnung an deviantes Verhalten, die auch im Wirtschaftsleben eintreten kann,[41] sich im Unternehmen leichter eine Objektivierung im Sinne eines verbreiteten und geteilten Verständnisses dieser Praktiken etablieren kann. Dies wiederum führt zu dem, was Tolbert und Zucker in ihrem mikroinstitutionalistischen Ansatz[42] die Sedimentation nannten, wodurch die Praktiken zu einer zwingenden Tatsache mit Strukturqualität werden. Korruption ist insofern ein gutes Beispiel, um diese Mechanismen zu verdeutlichen, als dieses Phänomen implizit Mechanismen bi- und multilateraler Versicherung bedingt. Korruption auf lange Sicht funktioniert nämlich nur auf der Grundlage von Protektion, Geheimhaltung und Verschwiegenheit und damit gegenseitiger Abhängigkeit.[43]
159
Die Hypothese, dass starker Druck auf sonst unauffällige Personen eine entscheidende Ursache bei der Herausbildung von Unternehmenskriminalität ist, liegt also nahe. Dies bedeutet nicht, dass die Beteiligten als Opfer widriger Umstände[44] zu betrachten sind, sondern nur, dass wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse und Bedürfnisbefriedigung auch im Unternehmen die Grundlage eines – Devianz billigenden Gemeinschaftsgefühls – bilden können. Das Kollektiv – in diesem Fall das Unternehmen als Funktionseinheit akkumulierter technischer und personeller Möglichkeiten – eröffnet dem Individuum Chancen und Angebote wie z. B. Karrieremöglichkeiten oder den Gewinn von Prestige und Selbstbestätigung, die im Wesentlichen durch die interne Normen- und Wertstruktur vorgegeben sind. Die Intensität des Wunsches des Individuums, diese Angebote wahrzunehmen, erzeugt eine höhere Bereitschaft zur Konformität innerhalb der Gruppe.[45] Selbst ohne die Prämisse, dass hierdurch eine bedingungslose Unterordnung erzeugt wird,[46] kann die interne Normen- und Wertestruktur in Bezug auf das strafrechtliche Normgefüge separatistische und differierende Tendenzen aufweisen,[47] die für die Individuen innerhalb des Kollektivs Normalität oder Selbstverständlichkeit werden können. Die Paralysierung sonst wirksamer Normvorstellungen ist also durchaus dem Unternehmenskontext zu attestieren, wenn auch mit Bedacht an eine Übertragung der makrokriminellen Zusammenhänge auf die Unternehmenskriminalität herangegangen werden muss.[48]
160
Bedächtiges Vorgehen erscheint auch hinsichtlich des zweiten Aspekts angebracht, ob nämlich der kriminogene Einfluss als kollektiv- oder unternehmensgesteuert angesehen werden muss. Das Verhalten des Einzelnen innerhalb des Unternehmens wird nämlich durch eine Vielzahl von Instrumenten beeinflusst, die sowohl strukturelle als auch nicht-strukturelle Handlungskoordination darstellen. Es spielen also zum einen persönliche Weisungen als vertikale Kommunikation, aber auch Prozesse der Selbstabstimmung – horizontale Kommunikation – eine Rolle. Beides sind personenbezogene Instrumente, die als sichtbare Interaktion von identifizierbaren Personen erlebt werden können.[49] Ebenfalls struktureller Art ist die Koordinierung über Handlungsprogramme und Pläne, über Routinen, Checklisten und Formulare. Hier werden vorwiegend anzustrebende Zustände kommuniziert, die der Lenkung von zukünftigen Handlungen dienen sollen (Vorauskoordination). Damit dies gelingt, erfolgt auch bei Abweichung eine systematische Rückmeldung, d. h. die Einhaltung von Handlungsprogrammen wird kontrolliert. Die beiden letztgenannten Instrumente sind solche unpersönlicher Koordination, die weniger sicht- und nachweisbar sind.
161
Die Etablierung von Kriminalität kann über diese Wege erfolgen; ebenso kann sie auf nicht-strukturelleHandlungskoordination innerhalb des Unternehmens zurückführbar sein. Auch diese werden nämlich in der Organisationsforschung unter den Stichworten „organisationsinterne Märkte“ und „Koordination durch Clans“ thematisiert. Die Annahme, dass klassische Marktmechanismen in das Unternehmen hineingetragen werden und sich Entscheidungen an Gewinn-Preis-Verhältnissen orientieren, liegt nahe. In der wirtschaftswissenschaftlichen Organisationsforschung wird beobachtet, wie Gewinnverantwortung organisatorischer Einheiten, Entscheidungsautonomie bestimmter Unternehmensbereiche und das Vorhandensein interner Verrechnungspreise für Leistungen einen innerorganisatorischen Wettbewerb schaffen können, bei dem beispielsweise Stellen um Ressourcen konkurrieren können und ihre Existenz durch Erfolg oder Nachfrage nach erstellten Leistungen gerechtfertigt sein können.[50]
162
Um erneut ein Beispiel zu bilden: Das „Umetikettieren“ und Verkaufen von Fleisch, dessen Haltbarkeitsdatum – teilweise seit mehreren Jahren – abgelaufen war.[51] Zumindest in einem Fall standen die Vorwürfe im Zusammenhang mit einer großen Supermarktkette und der Anweisung der Geschäftsführung an ihre Mitarbeiter Verderbquoten unbedingt unter 0,3% zu halten. Aus den Strafbefehlen geht hervor, dass einer der Mitarbeiter an seinem ersten Arbeitstag die Umetikettierung vornahm; auf Anweisung seines Vorgesetzten. Aus dem Urteil gegen den Merchandiser lässt sich ebenfalls entnehmen, dass die Mitarbeiter auf unterschiedlichen Hierarchiestufen Drucksituationen ausgesetzt waren, bestimmte Verderbquoten nicht zu überschreiten.[52] In einer (angeblichen) Weisung der Geschäftsführung an ihre Mitarbeiter, Verderbquoten unbedingt unter 0,3% zu halten, kann eine strukturelle Handlungskoordination vermutet werden. Vermutet man, die Weisung habe den expliziten Zusatz „um jeden Preis“ beinhaltet, bejaht man eine vertikale Kommunikation und hat ein Individuum – die Geschäftsführung – als Anknüpfungspunkt. Geht man von einer Situation aus, in der lediglich der angestrebte Zustand einer geringen Verderbquote kommuniziert wurde, kann die Koordination strukturell, aber unpersönlich erfolgt sein. Es könnte also lediglich eine „kriminelle Routine“ Einzug gehalten haben, die – als Erfolg ausgewiesen – in Kontrollen eine positive Rückmeldung erhielt. Die kriminogene Situation könnte aber auch einer anderen Erklärung zugänglich sein: Die Geschäftsführung könnte explizit niedrige Verderbquoten und inexplizit von einer besseren Abstimmung von Ein- und Verkauf ausgegangen sein, während die entsprechende Abteilung ihre fehlerhafte Kalkulation oder ihre wenig innovative Verkaufsstrategie durch das kriminelle Vorgehen überdecken konnte, um weiter dem internen Konkurrenzdruck zu genügen. Die Kriminalitätsentwicklung könnte also nur entfernt mit der Unternehmensstruktur und stärker mit der Interaktion der Unternehmensmitarbeiter zusammenhängen.
163
Für letzteren Aspekt spräche, dass das Unternehmen für den Mertonschen Innovationstyp wie geschaffen zu sein scheint. Kriminalität als Folge von überwältigenden Situationen im Unternehmen, in denen es um die Positionierung gegenüber anderen Mitarbeitern und die Unentbehrlichkeit der eigenen Stelle (die zugleich Lebensgrundlage ist) geht, ist keineswegs fernliegend. Sie erscheint sogar naheliegend, wenn man die Beobachtungen Ouchis, der das Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit und die gemeinsamen Werte und Normen innerhalb des Unternehmens herausstellt, mit in Betracht zieht.[53] Er bezeichnet diese weitere Möglichkeit nicht-struktureller Koordination innerhalb des Unternehmen als den Clan, der durch ein hohes Maß an Homogenität, Selektion, Entkulturation und moralischer Selektion die internen Abläufe beeinflusst und eine „Organisationskultur“ schafft, die filtert, was akzeptiert wird. Damit bestätigt er letztlich das, was Sutherland in seiner Theorie differentieller Assoziationen entwickelte und zeigt auf, wie kollektive Prozesse in Unternehmen um sich greifen können. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung untersucht und beschreibt das Phänomen der Organisationskultur schon lange, liefert Ebenenmodelle[54] und weist vor allem nach, dass eine vollständige Institutionalisierung dieser Prozesse und unmittelbare Zuordnung zum Unternehmen – also nicht zu einer Gruppe von Mitarbeitern – außerordentlich voraussetzungsreich ist.
164
Der aktuelle kriminologische und strafrechtliche Fokus wird allerdings vorwiegend auf die Reduzierung von Gelegenheiten und die Kontrolle durch unternehmensinterne Maßnahmen gerichtet, was darauf hindeutet, dass vor allem Organisationsprobleme bzw. die oft beklagte „organisierte Unverantwortlichkeit“ sowie in zunehmendem Maße komplexe und globalisierte Wirtschaftszusammenhänge als Ursache von Unternehmenskriminalität gewertet werden.[55] Es spricht aber auch einiges für die Ansicht,[56] dass der „Werteverfall“ als eine der Hauptursachen für Kriminalität im Unternehmen gelten muss. In diesem Fall wäre die kriminogene Situation mehr eine Charakter- oder Mentalitätsfrage als eine unternehmensgesteuerte. Schließlich muss mitunter zwischen den verschiedenen hierarchischen Ebenen innerhalb der Organisation Unternehmen differenziert werden. Wo auf „ausführenden“ Ebenen eine Abweichung gegenüber strafrechtlichen Normen auf eine Konformität mit den unternehmensinternen Regeln rückführbar sein kann, mag selbige Abweichung bei Führungskräften auf eine selbst zu verantwortende „Verschreibung hinsichtlich der Unternehmensziele“ zurückzuführen sein, die strafrechtlich anders zu bewerten wäre.[57] Insbesondere die von Freud[58] als zentrales Kriterium herausgearbeitete „soziale Angst“, welche den „Gewissensschwund als notwendige Folge“ hervorbringt und die Begehung von Straftaten ermöglicht, wenn die Erwartungen des unmittelbaren Umfelds auf die Begehung von Straftaten gerichtet sind und durch ihre Begehung die soziale Angst schwindet, legt nahe, zwischen den Positionen innerhalb des Unternehmens zu differenzieren. Ein weisungsgebundener Arbeitnehmer, der um seinen Arbeitsplatz fürchtet, wird womöglich wegen einer der „sozialen Angst“ vergleichbaren Motivation sanktionswürdige Handlungen begehen, während der Vorstandsvorsitzende diese Drucksituation durch die Vorgabe bestimmter Unternehmensziele selbst erzeugt haben kann.[59]
165
Um weiter differenzieren zu können, ob Unternehmenskriminalität im Zusammenhang mit diesen gruppendynamischen Einflüssen als kollektivgesteuert anzusehen ist oder unternehmensgesteuert oder beides ist, wird im Folgenden die Hypothese der strukturellen Bedingtheit von Unternehmenskriminalität weiter verfolgt; zunächst durch einen genaueren Blick auf die in der strafrechtlichen Literatur inflationär verwandten Begriffe der organisierter Unverantwortlichkeit und der kriminellen Verbandsattitüde.