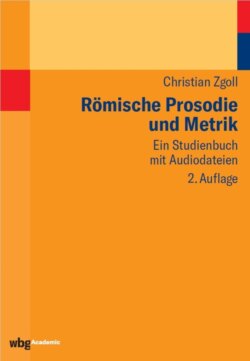Читать книгу Römische Prosodie und Metrik - Christian Zgoll - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Wortakzent und Versrhythmus
ОглавлениеMit etwas Disziplin und Lerneifer kommt man so weit, daß man bei den meisten und gebräuchlicheren lateinischen Vokabeln zumindest die wichtigen Vokale und Silben in ihrer Länge (oder Kürze) korrekt ausspricht, ohne dabei den natürlichen Wortakzent zu vernachlässigen, den es ja auch noch zu berücksichtigen gilt.
Wesentlich dafür ist ein korrektes Vorsprechen lateinischer Vokabeln durch die Lehrerinnen und Lehrer im schulischen Unterricht59. Es ist allerdings nicht nur das manches Mal zu Unrecht geschmähte Lehrpersonal an der Schule, welches den Schülern eine ungenaue Aussprache beibringt, ohne die Beachtung der richtigen Quantitäten; auch an der Alma Mater beschränkt man sich bei der Aussprache des Lateinischen in aller Regel auf die Einhaltung der richtigen Vokallängen – die korrekten Zeitlängen von geschlossenen Silben insgesamt hingegen werden auch hier meist nicht eingehalten. So spricht man zwar gewöhnlich indífferēns aus und zeigt damit, daß man um die Regel weiß, nach der Vokale vor den Konsonantenfolgen „nf“ bzw. „ns“ lang ausgesprochen wurden; aber die ersten beiden (langen) Silben werden meist nach deutschem Sprachempfinden ausgesprochen und nehmen jeweils genauso viel Zeitdauer in Anspruch wie die (kurze) dritte. Eine völlige Umstellung wäre zwar wünschenswert, ist aber freilich schwer realisierbar und auch nicht gefordert; es geht hier vor allem um eine Sensibilisierung für das Andere der lateinischen Aussprache.
Bei der Dichtung wartet nun ein weiteres Problem auf die Interessierten: die mühsam erlernte korrekte Aussprache wird jetzt noch zusätzlich in ein rhythmisches Korsett gezwängt, und da kommt es immer wieder vor, daß vom Rhythmus her „gewichtige“, mit einem longum versehene Versteile auf eine Wortsilbe treffen, die gerade nicht den natürlichen Wortakzent trägt. Als Beispiel der Beginn von Vergils Aeneis: Árma virúmque canó. Bei den Wörtern arma und virumque liegen die Längen im Rhythmus des Hexameters jeweils an derselben Stelle, an der in normaler Aussprache auch der natürliche Wortakzent liegt, nicht aber bei cano. Normal spricht man cáno, nicht canó – so wenig, wie man im Deutschen „ich singé“ betonen würde.
Das Problem einer gewissen Inkongruenz zwischen Wortbetonung und Längen im Versrhythmus stellt sich gerade beim Hexameter vor allem in der ersten Vershälfte regelmäßig, während in der zweiten Hälfte des Hexameters Wortakzent und Verslängen in der Regel übereinstimmen60. Nur in seltenen Fällen liegen die Betonungen von (mehrsilbigen) Wörtern im ganzen Vers jeweils auf einem longum (sog. versus partipedes)61, wie z.B. in den Versen impius haec tam culta novalia miles habebit (Verg. ecl. 1,70) oder spargens umida mella soporiferumque papaver (Verg. Aen. 4,486)62. Im lateinischen „Sprechvers“ der Komödie sind die Divergenzen zwischen Wortakzent und Längen im Vers deutlich geringer63.
Wie beim Vortrag antiker Dichtung mit diesem Problem umzugehen sei, darüber gab es eine Zeit lang kontroverse Ansichten. Die einen waren dafür, beim Vortrag rein dem Rhythmus zu folgen und den natürlichen Wortakzent einem angenommenen, sich an den Längen orientierenden rhythmischen Akzent, dem sog. „Iktus“, unterzuordnen64, historisch bedingt oft noch einhergehend mit einer Vernachlässigung der Silbenquantitäten (also árma virúmque canó)65. Die anderen plädierten dafür, daß man neben einer sorgfältig quantitierenden Aussprache rhythmisch sich nahelegende Betonungen dem natürlichen Wortakzent unterzuordnen habe (also ármă vĭrúmquĕ cánō).
Das hat bereits Wilamowitz gefordert66: „Vergil und Ovid wollen so gelesen sein, daß der Wortakzent befolgt wird, aber jede Silbe die Zeit ausfüllt, die ihrer Quantität zukommt“. Dem schließt sich Boldrini an67: „Die Römer lasen ihre Verse genau so wie Prosa; der Rhythmus ergab sich durch die Abfolge von Quantitäten, die als Vers erkennbar waren, wenn sie den Erwartungen entsprachen, die das Idealmodell hervorrief.“ So äußert sich bereits auch Stroh: „Diesen Iktus, den wir in der Schulaussprache verwenden, hat es in der ganzen Antike, der griechischen wie der römischen, nie gegeben“, und an anderer Stelle68: „Grundsätzlich gilt, dass der Vers in der Poesie genauso zu lesen ist wie das Kolon in Prosa“69. Aufgekommen ist der Iktus nach den Forschungen von Stroh erst um 1600, um die verlorengegangenen Quantitäten annähernd wiederherzustellen, und in Zusammenhang mit der Entstehung des Taktsystems in der Musik70. Allerdings ist Stroh zu Recht etwas vorsichtiger als Boldrini und sagt selbst beim iambischen Senar, der ja der Alltagssprache von der Rhythmisierung her mit am nächsten steht, ausdrücklich, daß diese Verse „prosaähnlich“, nicht „wie Prosa“ klingen71. Resümierend schreibt Leonhardt72: „Bei der künstlerischen Rezitation lateinischer Verse wurden … wie im Griechischen Wortakzente und Versstruktur gleichzeitig zu Gehör gebracht; künstliche Wortakzente zur Verdeutlichung der Versstruktur (seit G. Hermann „Iktus“ genannt … [wohl aber schon bei Bentley]) hat es in der Antike nur … zu Lehrzwecken gegeben. Nachvollziehbar wurde der Vers bei der Rezitation … allein durch die richtige … Realisierung der Silbenquantitäten.“
Die zweite Partei hat den Sieg davongetragen, und das mit guten Gründen. Es ist unter anderem wirklich nur sehr schwer vorstellbar, daß die Menschen früher in rhythmisch gebundener Sprache die Worte zum Teil völlig anders ausgesprochen haben sollten als im normalen Alltag. Besser als bei obigem Vergilbeispiel mag das anhand einer Passage aus der Tragödie Thyestes von Seneca verdeutlicht werden. Abgefaßt ist der betreffende Abschnitt in anapästischen Dimetern, die man nach der alten, sog. „iktierenden“ Schulaussprache so vortragen müßte (Sen. Thyest. 789-792):
Quo, térrarúm superúmque paréns,
cuiús ad ortús noctís opacáe
decus ómne fugít, quo vértis itér
medióque diém perdís Olympó?
Nun mag man vielleicht denken: Warum nicht? Aber in freilich nur grober Annäherung würde das im Deutschen analog etwa so klingen:
Wohín, der Erdén und Oberén Erzeugér,
bei dessén Aufgáng der Nácht, der dunklén,
ganze Ziérde entfliéht, wohin dréhst du die Báhn,
läßt mittén am Himmél den Tág verschwindén?
So kann es kaum gewesen sein. Ein rhythmisch durch Längen besonders „gewichtiger“ Taktteil führte in der Antike nicht zur Vernachlässigung des natürlichen Wortakzents.
Dafür lassen sich auch aus linguistischer Perspektive Argumente anführen. Zum einen besitzt der Wortakzent große Wichtigkeit für die Unterscheidung von Wortbedeutungen; eine Akzentuierung an „falscher“ Stelle kann sinnentstellend sein (vgl. bspw. den Unterschied zwischen itáque, „und so“, und ítaque, „deshalb“, oder vólvere, „wälzen“, und volvére, „sie haben gewälzt“ etc.). Zum zweiten ist eine korrekte Betonung der Wörter immer auch diastratisch (also auf die sozialen Schichten der Sprecher bezogen) bedeutsam, insofern sie den „Hochsprachler“ vom falsch betonenden „Barbaren“ unterscheidet73. Passagen bei Cicero zeigen darüber hinaus, daß seine Hörer durchaus imstande waren, „quantitierende Versmaße auch ohne Unterstützung durch einen Iktus zu erfassen“74. Schließlich sprechen historische und vortragstechnische Gründe dagegen, daß der Versrhythmus dem natürlichen Wortakzent übergeordnet war75.
Genausowenig wie wir im Deutschen sagen würden „Wáffen und Mánn besingé ich“, genausowenig haben die Römer árma virúmque canó gesprochen. Man kann durchaus – im Deutschen wie im Lateinischen – Versrhythmus und Wortakzent gleichermaßen berücksichtigen, ohne gegen das natürliche Sprachgefühl zu verletzen, und ohne dabei den Rhythmus völlig aus den Augen zu verlieren, indem man den natürlichen Wortakzent nicht durch Tonstärke, sondern durch Tonhöhe heraushebt76.
Es ist wahrscheinlich, daß eine solche Praxis der antiken Aussprache nahekommt; mit letzter Sicherheit zu beweisen ist das nicht. Die Sprachmelodie ist etwas äußerst Komplexes, sich auch nach dem Sinn der Aussage vielfältig Veränderndes. Zur praktischen Durchführbarkeit: Man kann unter Beibehaltung des durch die Quantitäten vorgezeichneten Rhythmus die ursprünglichen Wortakzente dadurch leichter beibehalten, daß man sie in einer höheren Tonlage ausspricht. Dadurch ergibt sich eine Hervorhebung, die fast unvermeidlich auch einen leichten Akzent nach sich zieht, also: arma virumque cáno (dabei ist das „a“ von cano höher zu sprechen, aber die Kürze des „a“ und natürlich die Länge des „o“ streng zu wahren). Zur Übung kann man ein Metronom aufstellen, das dazu hilft, sich in den quantitierenden Rhythmus einzufinden: für jede lange Silbe zwei Schläge, für jede kurze einen Schlag. Man wird auf diese Weise gezwungen, die Längen auch wirklich auszuhalten und bekommt dadurch eine gute Hilfestellung, die man später, wenn man den „quantitierenden Swing“ verinnerlicht hat, bald nicht mehr benötigt.
Bei musikalischer Begleitung käme das Problem von Wortakzenten, die sich nicht mit Verslängen decken, erst gar nicht zum Tragen, weil man diese Diskrepanz kaum als störend empfände, würde sie doch im musikalischen Gewand viel weniger wahrgenommen als bei einer reinen Rezitation77. Bleibt man bei der Rezitation, so ist freilich die strikte Beachtung der Silbenlängen entscheidend, sonst geht der Rhythmus verloren. Wenn man einmal einen Wortakzent vergißt oder vernachlässigt oder falsch setzt, spielt das für den Rhythmus des Verses kaum eine Rolle. Liest man jedoch eine Quantität falsch, dann gerät man sofort aus dem Takt, dann ist der rhythmische Fluß zerstört. Auf solche Störungen reagierte der antike Mensch äußerst empfindlich, selbst wenn er keinerlei metrisches Grundwissen besaß, wie wir aus einer Stelle bei Cicero erfahren (Cic. orat. 173):
Bei einem Vers, da schreit das ganze Theater laut auf, wenn auch nur eine einzige Silbe zu kurz oder zu lang gesprochen war. Dabei kennt die breite Masse weder Versfüße, noch erfaßt sie irgendwelche Rhythmen, noch erkennt sie, was Anstoß erregt oder warum oder gegen was es verstößt! Trotzdem hat die Natur selbst unseren Ohren die Fähigkeit verliehen, bei den Lauten alle Längen und Kürzen sowie die Höhe oder Tiefe der Wortbetonungen richtig zu beurteilen.
in versu quidem theatra tota exclamant, si fuit una syllaba aut brevior aut longior; nec vero multitudo pedes novit nec ullos numeros tenet nec illud, quod offendit, aut cur aut in quo offendat intellegit, et tamen omnium longitudinum et brevitatum in sonis, sicut acutarum graviumque vocum, iudicium ipsa natura in auribus nostris collocavit.
Darin liegt letztlich das Geheimnis, warum Römer und Griechen eine mögliche Diskrepanz zwischen Wortakzent und Längen im Versrhythmus als lange nicht so störend empfunden haben wie wir heute. Bei ihnen waren die Quantitäten das Wichtigste, der Akzent hingegen war untergeordnet und auf einer anderen Stufe, nämlich unter anderem durch Tonhöhe unterschieden, nicht durch Tonstärke. Bei uns ist die Quantität eher untergeordnet und vor allem der Akzent ausschlaggebend78. Im Deutschen kann man Lŏgik oder Lōgik sagen, ohne das Sprachgefühl ernsthaft zu verletzen; verletzt wird es im Deutschen erst, wenn man Logík sagen würde79. Für einen Griechen wäre hingegen die Aussprache Lōgik ähnlich schlimm wie für uns Logík, und er würde sich im Stillen denken: βάρβαρख़ॢ – welch ein Barbar, da er λόγख़ॢ („Vernunft“) so ähnlich ausspricht wie λωγάॢ („Hure“)!
Wenn wir die quantitierende Aussprache lateinischer Wörter streng einhalten und auch die sonstigen prosodischen Regeln des Lateinischen vollkommen beherrschen würden, dann könnten wir jeden lateinischen Vers lesen, ohne das Versmaß zu kennen, und ohne dabei aus dem Takt zu geraten80. So wie auch jeder Deutsche Schillers Verse „Festgemauert in der Erden ‖ steht die Form aus Lehm gebrannt“ problemlos und fehlerfrei lesen kann, ohne zu wissen, in welchem Versmaß sie abgefaßt wurden81. Auch der antike Mensch hat sich die Dichtung nicht erst über die Metrik erschlossen; Metrik ist erst nachträgliche Reflexion über eine sinnliche Erfahrung (Cic. orat. 183)82:
Sind wir doch auch zur Kenntnis des Verses selbst nicht durch unsere Vernunft gelangt, sondern durch unsere natürlichen Sinne, die erst durch die Vernunft und ihre Abmessungen über das Phänomen belehrt wurden. So hat sorgfältige Beobachtung der Praxis die Theorie hervorgebracht.
neque enim ipse versus ratione est cognitus, sed natura atque sensu, quem dimensa ratio docuit, quid acciderit; ita notatio naturae et animadversio peperit artem.
Da wir aber den „quantitierenden Swing“ des Lateinischen nicht mitgelernt haben und uns selbst nach dem Lernen noch sehr schwer tun, unser akzentuierendes Sprachempfinden abzulegen und „umzustellen“ auf ein quantitierendes, müssen wir auch das Lesen lateinischer Verse regelrecht üben. Jede andere fremdsprachige Dichtung bereitet uns keine Probleme – solange sie akzentuierend ist. Beim Lateinischen (wie auch im Griechischen) geht es aber um das Sich-Einfinden in einen ganz anderen Sprachrhythmus.