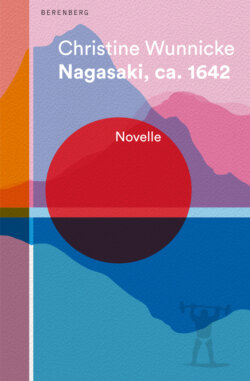Читать книгу Nagasaki, ca. 1642 - Christine Wunnicke - Страница 12
7
ОглавлениеZwei Tage nach dem Blumenfest rief Seki Keijiro den gesamten Haushalt zusammen, um kundzutun, dass er den Haarschneider bestellt hatte. »Ich habe ohnehin wenig Freude an ihm«, sagte er säuerlich, »und ich möchte mich nicht zu allem Überfluss auch noch im Pförtnerhaus einrammeln müssen, um mir die Haare machen zu lassen, und deshalb spreche ich eine förmliche Warnung aus, damit ihr euch rechtzeitig Beschäftigungen suchen könnt, die euch von diesem großen Ereignis ablenken, und ich gestatte mir ebenfalls die Warnung, dass ich schlechte Laune bekommen werde, wenn ihr wieder wie die Karpfen hinter allen Türen hervorgafft.«
Die Mitteilung wurde nicht gut aufgenommen, besonders nicht von Frau Seki. Bis der Haarschneider endlich kam, lag sie, unterstützt von einer Tochter und einer Dienerin, ständig ihrem Vater in den Ohren, Keijiro werde sich den Kopf scheren lassen und ins Kloster gehen und sie müsse mit und dort Gerstenbrei essen und beten und sterben. Es endete damit, dass Seki Keijiro und sein Schwiegervater sich anderthalb Tage lang zusammen im Pförtnerhaus versteckten und einander mürrisch anschwiegen.
Seit gut zwanzig Jahren hatte Keijiro keinen Haarschneider empfangen, da er dies, wie so vieles, nicht nötig hatte. Er trug seine Haare, wie Haare nun einmal wuchsen, und wenn alles ins Gesicht hing, drehte er einen neuen Knoten, und wenn sie zu lang wurden, schnitt er sie ab. Er sah aus wie ein Räuber. Und jung, sagten die Mägde. So gut erhalten, der edle Herr Seki, wie eingelegter Rettich. Kaum grau auf dem Kopf, mit siebenundfünfzig Jahren, und steht da wie ein Birkenbaum, obwohl er immer nur sitzt.
Herr Seki ließ den Haarschnitt wort-, klag- und reglos über sich ergehen. Dabei zog er ein Gesicht wie einer, der unter der Folter schweigt, bis ihm das Gedärm bei den Knien hängt, erzählte nachher der Haarschneider. Aber dann wurde es fürwahr eine Plage. Herr Seki bekam einen Rasurbrand und über dem Rasurbrand einen Ausschlag vom dicken Haaröl und an den Ohren einen Ausschlag vom dünnen Haaröl und im Nacken einen grundlosen Ausschlag, und dann schälte und schuppte sich alles. Er legte sich ein nasses Handtuch auf den Kopf, setzte darauf einen Binsenhut und machte Reisleim. Damit klebte er Holzspäne in die Scheide des anderen Schwerts, auf dass die Klinge fest sitze. Niemand kam gelaufen. Herr Seki hatte eine solch üble Laune, dass man das bis zum Westflügel spürte. Man mied ihn vorsichtshalber eine ganze Woche lang. Frau Seki ging freiwillig in ein Kloster und aß dort Gerstenbrei und betete, wenn auch wohl nur vorübergehend.
»Und warum?«, fragte der Schwiegervater.
»Posten«, sagte Seki Keijiro.
»Was?«
»Nagasaki.«
»Gönnst du mir einen ganzen Satz, Keijiro?«
Herr Seki räusperte sich. Einen Moment lang wünschte der Schwiegervater, er hätte nichts gefragt. Einen Moment lang wünschte er, er wäre im Westflügel geblieben oder hätte seine Tochter ins Kloster begleitet.
»Ich trete einen Posten in Nagasaki an«, sagte Herr Seki leise und warf einen unklaren Blick durch das Binsengitter vor seinen Augen, »beim dortigen Statthalter, der lieber in Yedo Speichel leckt, als in Nagasaki sein Amt zu versehen, weshalb ich für ihn die Barbaren verwalte, die fremden Kaufleute in ihrer Umzäunung.«
Da war der Schwiegervater recht sprachlos.
»Es geht mir um die Orandesen«, sagte Keijiro. Dieses Wort kaute er langsam.
»Orandesen«, echote der Schwiegervater, zu verdutzt, um verschüttetes Wissen auszugraben; auf den Kopf zu gefragt, hätte er wohl nicht beantworten können, worum es sich hierbei handelte.
»Und wie ging das zu?« Der Schwiegervater hörte aus seiner Stimme einen lamentierenden Ton heraus, der ihn an seine Tochter erinnerte. Er räusperte sich nun seinerseits.
»Ein Brief hin«, sagte Keijiro, »ein Brief zurück.«
»Und warum …«
»Ich verfolge Nachrichten über Oranda seit einundvierzig Jahren.« Wieder warf er einen Blick durch die Binsen, unlesbar, nicht angenehm. »Seit man letzthin für die Christen die Grenzen geschlossen hat …« Er stockte. »Seit die Christen vertrieben sind …«, begann er erneut und brach ab. »Die Orandesen sind seit der Abreise der Christen die einzigen Fremden, die dem da …« – er zeigte mit dem Daumen nach Osten – »… genehm sind, und deshalb …«
»Du sollst den Oberkommandanten nicht ›den da‹ nennen und nicht in seine Richtung zeigen, als wäre das ein Baum oder ein Pferd oder was weiß ich«, rügte ihn der Schwiegervater.
Keijiro stöhnte. »Seit unser aller edler Herr Oberkommandant in Yedo, der kleine Iemitsu …«
»Du sollst ihn nicht ›den kleinen Iemitsu‹ nennen, Blitz und Kugelblitz!«, rief der Schwiegervater.
»Ich kannte ihn, als er klein war. Jetzt kenne ich ihn nicht mehr, erfreulicherweise.«
Der Schwiegervater blieb jetzt stumm. Er wollte nicht versehentlich eine dieser Geschichten über den kleinen Iemitsu hervorlocken. Als er ein berühmter Mann gewesen war, hatte Herr Seki die Söhne des damaligen Oberkommandanten unterrichten dürfen, vor allem jenen, der nun selbst Oberkommandant war. Manchmal, wenn er getrunken hatte, erzählte Herr Seki recht breit davon, und jedesmal musste der Schwiegervater lachen und bangte dann tagelang um seinen Kopf.
»Seit der großmächtige Herr Tokugawa Iemitsu es für gut befand, die Christen abzuschaffen«, sagte Keijiro endlich, »sind die Orandesen allein. Das passt mir. Ich habe einundvierzig Jahre darauf gewartet, dass man sie mir zu einem handlichen Bündel schnürt. Jetzt tat man mir die Gnade.« Er verschob die Unterlippe zu einer Art Lächeln. Der Schwiegervater war nun so verwirrt, dass er sich überhaupt keinen Reim mehr auf Orandesen machen konnte und auch keinen Reim auf seinen Schwiegersohn.
Sie saßen viele Minuten schweigend da.
»Wenn du einen Posten beim Statthalter hast, solltest du dort vielleicht auch nicht verkünden, dass der Statthalter in Yedo Speichel leckt«, murmelte der Schwiegervater.
»Ah«, sagte Keijiro.
Das Haus war still. Vielleicht waren sie inzwischen allesamt ins Kloster verschwunden. Der Schwiegervater linste durch Keijiros Hut. Er dachte, welch furchtbarer Mann das gewesen sei, welch furchtbarer Mann das vielleicht immer noch war, der furchtbare Seki Keijiro, wie er hockte und webte und trank und lauerte, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, und nicht vernünftig älter wurde, mit seiner ewigen furchtbaren offenen …
»Ist es der Statthalter? Die Sippe des Statthalters?«, flüsterte der Schwiegervater. Er warf einen Blick auf das andere Schwert, das blank dalag, während der Reisleim trocknete.
»Nein«, sagte Keijiro, »die Orandesen. Du hörst mir nicht zu.«
Dem Schwiegervater fiel dazu noch immer nichts ein.
»Ich habe eine offene Angelegenheit«, sagte Keijiro, »sie betrifft Orandesisches, und ich weiß auch nicht viel besser als du, was das eigentlich ist, und jetzt ist es soweit, und erzähl es bitte nicht meiner Frau.«
Dann nahm er den Hut ab und das Handtuch vom Kopf und kratzte ausgiebig seinen geschälten, geschuppten, für einen anständigen Posten anständig frisierten Kopf, und dann begann er zu lachen, und er lachte lange, völlig vergnügt, oder zumindest fast.
Zwei Tage später brach er mit kleinem Gefolge auf. Der Schwiegervater ritt ein Stück mit ihm. Auf dem Rückweg würde er seine Tochter im Kloster abholen. Seki Keijiro hatte den Webstuhl dabei, in praktische Teile zerlegt, und er trug noch immer den Binsenhut, und das andere Schwert, in einer schönen roten Tasche, trug er über dem Rücken.