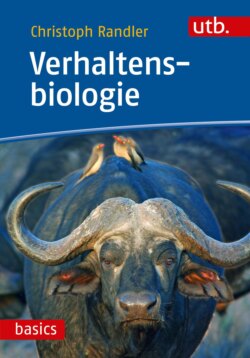Читать книгу Verhaltensbiologie - Christoph Randler - Страница 24
Arbeitsorte in der Verhaltensbiologie
ОглавлениеVerhaltensbiologische Studien können sowohl im Labor als auch im Freiland durchgeführt werden. Im Labor herrschen kontrollierte Bedingungen, die leichter variiert werden können, weshalb Experimente im Labor leichter möglich sind. Beispielsweise kann man Tieren im Labor durch Beleuchtung vortäuschen, dass bereits die Sonne aufgeht, obwohl es noch Nacht ist. Eine solche Studie ist im Freiland nur unter erschwerten Bedingungen machbar, wenn nicht gar unmöglich. Viele Messapparaturen sind nur im Labor und nicht im Freiland einsetzbar. Allerdings können Laborstudien nicht immer direkt auf die Freilandsituation übertragen werden. Im Freiland kommen viele Störvariablen hinzu, die sich kaum kontrollieren, bestens aber wenigstens zum Teil erfassen und quantifizieren lassen. Zu diesen Störvariablen gehört, dass Tiere sich im Freiland verstecken können, dass man nichts über die Vorerfahrungen (z.B. Lernprozesse) der beobachteten Tiere weiß und nichts über ihren inneren Zustand (z.B. Hunger). Allerdings zeigen Tiere im Freiland ihr natürliches Verhalten, was ein Vorteil gegenüber Laborversuchen ist. Des Weiteren gibt es Arten, die sich im Labor nicht halten lassen (z.B. einige große Huftiere). Meist sind die Forschungsorte gekoppelt an die Unterscheidung experimentell/observational, da im Labor eher Experimente, im Freiland eher Beobachtungen durchgeführt werden. Dennoch gibt es auch observationale Laborstudien. Wird beispielsweise eine Hausmaus (Mus musculus) im Labor in einen Kasten gesetzt und beobachtet, ob sie sich eher an der Wand oder in der Mitte aufhält, ist dies zunächst einmal eine observationale Vorgehensweise. Erst wenn eine Variable systematisch variiert, z.B. die Wand eingesetzt, verändert oder entfernt wird, entspricht dies einem experimentellen Design (→ Abb. 2-4).
Im Labor kann man relativ einfach mit domestizierten Tieren arbeiten, aber auch manche Wildtierarten können kurzzeitig in ein Labor verfrachtet werden. Bei der Vogelzugforschung werden beispielsweise wildlebende, während des Vogelzuges gefangene Vögel für ein oder zwei Nächte in einen Registrierungskäfig gesetzt und ihr Verhalten erfasst (Fusani et al. 2009). Danach werden sie wieder freigelassen. Auf diese Weise konnte festgestellt werden, dass Zugvögel mit einer guten Körperkondition mehr nächtliche Zugunruhe zeigten als solche mit einer schlechteren Kondition (Eikenaar & Schläfke 2013). Man kann auf diese Weise auch herausfinden, in welche Richtung die Zugvögel ziehen würden.
Box 2.1
Die Vielfalt der Erkennungs- und Markierungsmöglichkeiten
| Abb. 2-5
Markierungsmethoden und Überwachungstechniken. A) Höckerschwan (Cygnus olor) mit Halsmarkierung, B) Graugans (Anser anser) mit Farbfußring, C) Kleine Zangenlibelle (Onychogomphus forcipatus) mit Flügelmarkierung, D) Reh (Capreolous capreolous), durch eine Kamerafalle überwacht, E) Afrikanischer Elefant (Loxodonta africana) mit individueller Erkennung anhand der Stoßzahnde-formation, F) Afrikanischer Elefant mit GPS-Halskrause. Fotos: C. Randler.
Stehen keine natürlichen Kennzeichen wie individuelle Unterschiede in der Fellfärbung oder im Gefieder zur Verfügung, muss man zu Markierungen wie Vogelringen (Aluminium, Farbringe), Ohrmarken, Flügelmarken, Halsringen und Farbmarkierungen greifen. Kurzfristige Markierungen sind beispielsweise bei Wirbellosen auch mit einem wasserfesten Farbstift möglich (Libellenflügel).
Wichtig ist, dass die Markierungen das Verhalten der Tiere nicht verändern und möglichst über die gesamte Untersuchungsdauer sichtbar bleiben. Es gibt eine Reihe von Studien, die belegen, dass z.B. die Markierung mit Metallringen keinen Einfluss auf das Verhalten und das Überleben haben, während andere zeigen, dass beispielsweise Flügelmarkierungen bei Königspinguinen (Aptenodytes patagonicus) die Überlebensrate von Jungtieren und den Bruterfolg der adulten Tiere senken (Gauthier-Clerc et al. 2004). Kleinere Transponder oder RFID-Chips können über verschiedene Empfangsstationen abgelesen werden und ermöglichen so eine automatische Registrierung der Individuen. Für die meisten Markierungen muss eine Genehmigung der zuständigen Behörden eingeholt werden. Technische Hilfsmittel erlauben es uns, das Verhalten der Tiere relativ unbeeinflusst zu beobachten, oder ermöglichen es, Tiere bei Nacht oder in dunklen Bauen mit Filmtechnik zu beobachten.
Bei allen Laborexperimenten sind grundsätzlich die Tierschutzbestimmungen zu beachten und bei Studien, bei denen Wildtiere der Natur entnommen und kurzfristig ins Labor verbracht werden, zusätzlich die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. eine spezielle Ausnahmegenehmigung zu beantragen (vgl. auch die «Ethics in Research» der Association for the Study of Animal Behaviour; ASAB/ABS 2006). Generell gilt bei Labortieren die Regel: «Reduction, Replacement, Refinement»: Es sollen möglichst wenige Experimente mit möglichst wenigen Tieren durchgeführt werden, d.h., die verwendeten Methoden sollen so verfeinert und die Forschungsfragen so präzisiert werden, dass möglichst wenige Tiere an den Experimenten teilnehmen müssen. Statistische Power-Tests helfen, die erforderliche Stichprobengröße bereits im Vorfeld abzuschätzen.
Tab. 2-2 | Überblick über die Methoden der Verhaltensbiologie.
| Originaldaten | Sekundärdaten |
| Beobachtung: kein Eingriff in die Natur | komparative/phylogenetische Analyse: jede Art ergibt einen Datenpunkt und wird in Bezug zu verschiedenen Variablen gesetzt |
| Quasi-Experiment: experimenteller Eingriff, aber keine Kontrolle aller Variablen | Review: «narrativ» und z.T. etwas subjektiv, neuerdings klare Vorgaben für die Durchführung systematischer Reviews; Datenpunkte sind die jeweiligen Studien, daher kann eine Art mehrfach zum Ergebnis beitragen |
| Experiment: Variablen werden isoliert und variiert (strenge Kontrolle der Variablen) | Meta-Analyse: klare Regeln für die Literatursuche; Systematische Datenanalyse; Basis der Daten ist die jeweilige Studie; eine Art kann mehrfach zum Ergebnis beitragen |