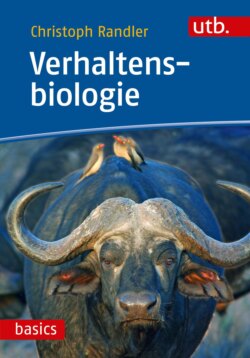Читать книгу Verhaltensbiologie - Christoph Randler - Страница 26
Verhaltensphylogenie
ОглавлениеBei der Verhaltensphylogenie geht es um die stammesgeschichtliche Entstehung und Entwicklung von Verhalten aus evolutiver Sicht. Anders als bei morphologischen Merkmalen, die als Fossilien Millionen Jahre überdauern, kann Verhalten nicht konserviert werden. Mit der komparativen phylogenetischen Methode können Rückschlüsse auf die evolutive Entstehung von Verhalten anhand heute lebender (rezenter) Arten gezogen werden. Dazu wird auf die Stammbäume (Phylogenien) der interessierenden Arten zurückgegriffen. Diese sind mittlerweile dank einer Vielzahl an molekulargenetischen Untersuchungen gut bekannt. Nun wird – ähnlich der vergleichenden Verhaltensforschung – das Verhalten von nahe verwandten Arten untersucht und auf den Stammbaum (Phylogenie) übertragen. Mithilfe dieser Methode wird dann abgeschätzt, wann im Laufe der Evolution ein Verhalten entstanden ist oder wieder verschwand, aber auch, ob dieses Verhalten im Stammbaum an unterschiedlichen Stellen unabhängig voneinander entstand (Konvergenz). Konvergenz bedeutet, dass bei nicht verwandten Tierarten ein ähnlicher Selektionsdruck oder gleiche Umwelteinflüsse ein ähnliches Verhalten ausprägten. Der Gegenbegriff zur Konvergenz ist die Divergenz; sie besagt, dass nahe verwandte Arten ein unterschiedliches Verhalten entwickelten. Ähnliches oder gleiches Verhalten oder Aussehen gibt also nicht notwendigerweise einen Hinweis auf nahe Verwandtschaft, nahe verwandte Arten können aber ähnliches Verhalten zeigen. Aktuell wird in der Phylogenie das Prinzip der Parsimonie (Einfachheit) favorisiert, d.h., es wird die Erklärung bevorzugt, die die wenigsten evolutiven Änderungen voraussetzt (→ Abb. 2–6).
| Abb. 2-6
Zwei hypothetische Szenarien, nach denen der Brutparasitismus bei Kuhstärlingen (Molothrus sp.) entstanden sein könnte. Das obere Szenario geht davon aus, dass es zuerst einen Spezialisten gab. Das untere beginnt mit einem generellen Brutparasiten. Beide Hypothesen erscheinen wahrscheinlich, obwohl die obere nur einen evolutionären Wandel voraussetzt, die untere dagegen zwei. (Neu gezeichnet nach Rothstein et al. 2002.)
Ein Vorteil der phylogenetischen Methode sind Verallgemeinerungen über viele Arten hinweg. Dies steht im Gegensatz zu Studien, die an einzelnen Arten durchgeführt werden und deren Ergebnisse somit zuerst nur für diese eine Art gelten. Am Beispiel der Amseln haben wir das Fluchtverhalten vor Katzen (oder anderen Beutegreifern) diskutiert. Mit dem komparativen phylogenetischen Ansatz könnte man nun auch bei anderen Vogelarten schauen, ob ein solches Verhalten zu beobachten ist. Beginnen würde man eine solche Prüfung beispielsweise bei Drosseln und anderen Singvögeln, die der Amsel relativ ähnlich sind. In einem nächsten Schritt würde man dann, ähnlich wie bei einer Meta-Analyse, Daten zur Fluchtdistanz sehr verschiedener Arten aus der Literatur extrahieren. Diese Daten können dann mit weiteren Faktoren in Beziehung gesetzt werden, z.B. mit der Körpergröße. Dadurch könnte man feststellen, dass größere Vogelarten eine höhere Fluchtdistanz haben, also früher fliehen (Møller et al. 2016). Diese Verallgemeinerung ist erst durch die vergleichende phylogenetische Methode möglich, Beobachtungen allein an Amseln hätten dazu nicht genügt. Es gibt viele weitere Beispiele für Erkenntnisse, die mit dieser Methode gewonnen werden können (Bennett & Owens 2002).
Merksatz
Während die meisten Methoden in der Verhaltensbiologie Analysen auf dem Niveau des Individuums durchführen, untersuchen phylogenetische Methoden das Verhalten auf dem Artniveau bzw. zwischen den Arten.
Bei Datenanalysen repräsentiert eine bestimmte Art einen statistischen Datenpunkt, während bei Originaldaten meist ein einzelnes Individuum einen statistischen Datenpunkt bildet. In der Regel variiert das Verhalten zwischen einzelnen Arten deutlich stärker als innerhalb einer Art. Allerdings unterliegen diese phylogenetischen Studien einem statistischen Irrtum, da die einzelnen Tierarten wegen ihrer Verwandtschaftsbeziehungen keine «unabhängigen» Datenpunkte darstellen. Es mussten daher Methoden entwickelt werden, um dieses Problem zu lösen.
Kritik am Ansatz der vergleichenden Verhaltensphylogenie: Der vergleichende Ansatz kann nicht experimentell überprüft werden. Allerdings können Hypothesen überprüft werden, für die es keinen experimentellen Zugang gibt. Wichtig beim vergleichenden Ansatz sind:
• eine gründliche Wahl der geeigneten Tiergruppe,
• die korrekte statistische Behandlung (phylogenetisch unabhängige Kontraste),
| Abb. 2-7
Gehirngröße (in Relation zum Körpergewicht) und Lauben bei Laubenvögel (Ptilonorhynchidae). Je größer das Gehirn, desto komplexere Lauben bauen die entsprechenden Arten. (Neu gezeichnet nach Madden 2001.)
• das Berücksichtigen von Variablen, die einen zusätzlichen Einfluss auf die Analysen haben können (konfundierende Variablen),
• klare, sich widersprechende oder sich gegenseitig ausschließende Hypothesen,
• Übereinstimmung der Phylogenie (Stammbäume) mit der Wirklichkeit. Die Realität zeigt aber, dass sich die postulierten Stammbäume mithilfe zunehmend besser werdender Methoden (bis hin zum Sequenzieren des gesamten Genoms) regelmäßig ändern.
• Wissen über die bereits ausgestorbenen Arten und deren Entwicklung. Darüber ist allerdings bislang wenig bekannt.
Da die phylogenetischen, vergleichenden Studien ebenso korrelativ sind wie Beobachtungen, lassen sich oftmals Ursache und Wirkung in verschiedene Richtungen interpretieren. Illustriert sei dies am Beispiel der Gehirngröße von Zugvögeln. Sol et al. (2005) stellten fest, dass Zugvogelarten relativ zur Körpergröße ein kleineres Gehirn haben als Standvögel. In den phylogenetischen Analysen postulierten sie nun, Standvögel seien «klüger» als Zugvögel. Als Beleg dafür diente das (relativ) größere Gehirn der Standvögel. Die Gehirngröße wurde also als Maß für die kognitiven Fähigkeiten verwendet. Winkler et al. (2004) dagegen stellten die Hypothese auf, dass Zugvogelarten im Laufe der Evolution ein kleineres und effizienteres Gehirn entwickelten, um Energie zu sparen. Das kleinere Gehirn ist gemäß ihrer Hypothese demnach kein geeigneter Indikator für schlechtere kognitive Fähigkeiten, sondern ein Beleg für die Anpassung der Vögel an die ziehende Lebensweise. Diese unterschiedlichen Interpretationen konnten mit der vergleichenden phylogenetischen Methode nicht aufgelöst werden. Sie gaben in der Folge Anlass zu einer Studie an der Dachsammer (Zonotrichia leucophrys), deren Unterarten teils Zugvögel, teils Standvögel sind. Die ziehenden Unterarten besaßen ein kleineres Gehirn als jene, die sesshaft waren. Pravosudov et al. (2007) argumentieren, dass sich das Gehirn vergrößerte, nachdem eine Unterart sesshaft wurde. Dies spricht für die Hypothese von Winkler et al. (2004) und zeigt, dass bei vergleichenden phylogenetischen Studien mit Ursache und Wirkung sorgfältig umgegangen werden muss und dass weitere Studien helfen, die Beziehung zwischen den Variablen zu klären.
Merksatz
Phylogenetische Analysen versuchen, Studien an einzelnen Arten zu generalisieren und auf viele Taxa zu übertragen. Phylogenetisch basierte Studien können aber auch Anregungen bieten, an einzelnen Arten konkret und experimentell weiter zu forschen.
Das Zugvogelbeispiel zeigt, wie hilfreich es ist, sich widersprechende Hypothesen zu wählen, um ein Verhalten zu erklären. Phylogenetische Analysen beruhen zum Großteil auf bereits publizierten Daten. Es ist jedoch auch möglich, zuerst eine Hypothese aufzustellen und dann zu prüfen, ob alle erforderlichen Daten veröffentlicht sind, und noch fehlende selbst zu erheben. In der Analyse werden Original- und Sekundärdaten kombiniert.