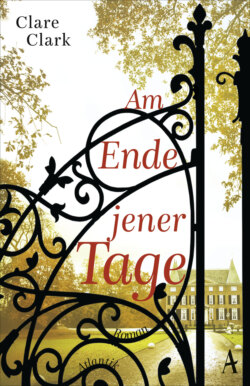Читать книгу Am Ende jener Tage - Clare Clark - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеDer Sommer 1916 war warm und trocken. Woche für Woche trafen schlimmere Kriegsnachrichten ein, aber in Hampshire veranstaltete man weiterhin Picknicks, Teegesellschaften und Tennispartys, und an den langen rosa Abenden gab es Musikdarbietungen von so geisttötender Langweiligkeit, dass sich Jessica zusammennehmen musste, um nicht laut zu schreien oder sich sämtliche Kleider vom Leib zu reißen. Die anderen Mädchen kannten sich schon ihr ganzes Leben lang. Die Jungen waren ihre Brüder und Cousins, manchmal auch Schulfreunde. Man hatte sie aus irgendwelchen Provinznestern herangekarrt, um das Publikum zu vervollständigen. Es waren pickelige, ungeschlacht aussehende Wesen, die meisten noch Milchbärte mit Manieren. Gelegentlich brachte jemand einen Mann mit, der älter war, auf Heimaturlaub oder verwundet, doch keiner von diesen blieb lange. Jessica konnte es ihnen nicht verdenken. Jeder Mensch mit einem Funken Verstand sah, dass es auf dem Land nichts gab, was einen Aufenthalt lohnte. Die Einzigen, die blieben, waren beinamputiert, konnten kaum atmen oder zitterten so sehr, dass sie nicht in der Lage waren, eine Tasse Tee in der Hand zu halten. Man verhielt sich ihnen gegenüber zwar freundlich, war jedoch erleichtert, wenn sie wieder nach Hause fuhren. Ihre Gebrechen berührten jedermann peinlich, sie selbst am meisten.
Inzwischen war Jessica die Einzige, die noch zu Hause wohnte. Im Januar war Phyllis dem freiwilligen Krankenpflegedienst beigetreten und nach London gegangen. Eleanor hatte versucht, sie davon abzuhalten. Phyllis’ oberste Pflicht gelte ihrer eigenen Familie, sagte sie, außerdem gebe es in Hampshire genügend kriegswichtige Aufgaben. Im Übrigen sei Krankenpflege eine stumpfsinnige, anstrengende und oft gefährliche Arbeit. Den arglosen Helferinnen stießen oftmals unsägliche Dinge zu, wenn sie schutzlos verwundeten Männern ausgeliefert seien, die geradezu nach weiblicher Gesellschaft gierten. Phyllis wisse doch selbst, dass sie in einem Lazarett völlig fehl am Platze wäre, sie, die als Mädchen nie auch nur eine Puppe umsorgt habe, geschweige denn einen Menschen. Und ob sie denn wirklich glaube, die Oberschwestern würden ihren Helferinnen erlauben, den ganzen Tag die Nase in ein Buch zu stecken? Aber Phyllis zuckte nur mit den Schultern und sagte, sie habe sich entschieden.
»Die Pflegekräfte bekommen die übelsten Aufgaben aufgebrummt«, sagte Jessica zu ihr. »Lavinia Petersham hat erzählt, ihre Schwester macht nichts anderes als Böden schrubben und Toiletten putzen. Und sie kriegt nicht einen einzigen Tag frei.«
»Ach ja?«, erwiderte Phyllis.
»Ich will es dir nur gesagt haben. Man wird dir nicht erlauben, tatsächlich irgendjemanden zu pflegen. Du wirst nur eine bessere Putzfrau sein.«
»Was sonst könnte ich sein? Und nicht einmal dafür bin ich richtig qualifiziert.«
»Es macht dir also nichts aus?«
»Dass meine häusliche und schulische Erziehung rundweg versagt hat, weil versäumt wurde, mich auch nur mit einer einzigen nützlichen praktischen Befähigung auszustatten? Doch, das macht mir was aus.«
»Du kannst es dir immer noch anders überlegen«, sagte Jessica. »Es ist noch nicht zu spät.« Aber Phyllis starrte sie nur an, als hätte sie japanisch mit ihr gesprochen. Eine Woche später fuhr sie nach London, um ihre Ausbildung zu beginnen. Sie nahm Theos Koffer mit, jenen, den Großmutter Melville ihm geschenkt hatte, als er ins Internat kam. Er war aus braunem Leder gefertigt und hatte auf dem Deckel Theos Initialen eingeprägt. Als Eleanor das sah, rang sie nach Luft und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Mir gefällt die Vorstellung, dass Theo mich überallhin begleitet«, sagte Phyllis.
Eleanor legte die Hand auf die Ecke des Koffers und strich mit dem Daumen sanft über das genarbte Leder.
»Dieses alte Ding hatte ich schon ganz vergessen«, sagte Jessica.
»Ich weiß«, erwiderte Phyllis. »Hoffentlich besteht es nicht auf Orangen zum Nachtisch und weigert sich nicht, das Fenster aufzumachen.«
»Oder schnäuzt sich in sein Taschentuch, nachdem alle in den Waggon eingestiegen sind, um dann etwas über Tropenkrankheiten vor sich hin zu murmeln«, fügte Jessica hinzu.
»Oder versucht, mit Eleanors seidenem Sonnenschirm vor dem Fenster Schmetterlinge zu fangen.«
Eleanor schluchzte und zog den Koffer mit beiden Armen an sich. Phyllis warf Jessica einen Blick zu.
»Du wirst ihn nicht mitnehmen«, sagte Eleanor unter Tränen. »Er gehört dir nicht. In sein Zimmer zu gehen und seine Sachen zu durchstöbern. Ich erlaube das nicht, hörst du? Ich erlaube es nicht.«
Phyllis zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. »Tut mir leid«, sagte sie. »Aber er war nicht nur ein Teil von dir. Er war ein Teil von uns allen.«
Sie nahm den Koffer. Als sie zum Abschied Eleanor an der Eingangstür küssen wollte, drehte ihre Mutter das Gesicht zur Seite und ging ins Haus zurück, ohne sich noch einmal umzusehen.
Nachdem Phyllis und die Hälfte der Hausangestellten fort waren, wurde es auf Ellinghurst still wie in einer Kirche. Selbst die Pferde hatte man für den Krieg requiriert. Als der Sommer anbrach, ging Jessica auf die anstehenden Partys, weil sie schlicht nichts Besseres zu tun hatte. Sie schlug Tennisbälle absichtlich in die Büsche, um dann unter dem Vorwand, sie zu suchen, in Ruhe eine Zigarette zu rauchen. Sie stellte eine Liste mit den Namen der Jungen zusammen und forderte die Mädchen auf, die ersten zehn auszuwählen, die es ihnen ihrer Meinung nach am besten besorgen könnten. Einmal brachte sie eine Flasche Gin mit, die sie aus dem Barschrank im Salon entwendet hatte, und wollte ein paar Mädchen dazu animieren, sich mit ihr davonzuschleichen und eine eigene, richtige Party zu veranstalten. Aber keine wollte mitmachen. Also trank sie ein wenig von dem Gin und schüttete den Rest in einen Blumentopf mit Farn in der Hoffnung, dass er einging. Die Mädchen waren allesamt Transusen und Langweilerinnen.
Aber noch schlimmer waren die Jungen. Insbesondere Hubert Dugdale, der ihr monatelang wie ein Dackel hinterhergetrappelt war, im August jedoch aus heiterem Himmel Iris Lloyd Warner mit einem Strauß Rosen bedachte. Ausgerechnet der fetten, sommersprossigen Iris, die schon außer Atem geriet, wenn sie nach einem weiteren Stück Kuchen griff. Die anderen Mädchen seufzten und quiekten und fanden es unglaublich romantisch, aber Jessica hatte dafür nur Verachtung übrig. Nicht dass ihr auch nur im Mindesten etwas an dem Hohlkopf Hubert Dugdale gelegen wäre, sondern aus Prinzip. Das Feuer der Leidenschaft erstarb nicht einfach deshalb, weil es nicht geschürt wurde. Es nährte sich selbst, gierig, lodernd wie ein in Flammen stehendes Haus, erschreckend und prächtig zugleich. Dass Hubert Dugdale ihr in der einen Woche seine unsterbliche Liebe erklären konnte und in der nächsten diese fette, rotfleckige Iris Lloyd Warner umgarnte, steigerte Jessicas Verachtung für ihn nur noch mehr. Was war das für ein armseliger Abklatsch von Liebe, wenn sie von einem scharfen Windstoß zerstoben werden konnte wie eine Pusteblume?
Manchmal vergaß Jessica, dass Theo tot war. Manchmal dachte sie einen ganzen Tag lang nicht daran und war glücklich. Aber dann hasste sie sich, weil sie es vergessen hatte. Nanny sagte, die Zeit heile alle Wunden, aber Jessica wollte nicht, dass ihre Wunden heilten. Sie wollte verletzt bleiben, für immer bluten wie der heilige Franz von Assisi. Der Schmerz war alles, was sie Theo dafür anbieten konnte, dass sie am Leben war.
Sie machte Inventur. Sie suchte alle Winkel des Hauses auf, die ihr einfielen, stieg die Wendeltreppe im Eckturm hinauf, zum alten Rauchsalon von Großvater Melville mit seinen gerundeten holzgetäfelten Wänden und der roten Lampe, mit der er der Küche signalisiert hatte, wenn er etwas brauchte. Sie wanderte durch längst verschlossene Flure und trat in Schlafzimmer, deren Mobiliar mit Laken zum Schutz gegen den Staub abgedeckt war und in denen schon vor dem Krieg niemand mehr geschlafen hatte. Sie stieg zu den leeren Schlafzimmern im Dachgeschoss hinauf, wo die Bediensteten gewohnt hatten, als sie noch zahlreich gewesen waren, und wo jetzt nur mehr eiserne Bettgestelle und Blecheimer aufgereiht standen, die das Regenwasser aus dem undichten Dach auffingen. Sie ging in das Waffenzimmer mit seinen nummerierten Holzregalen voller Stiefel und Gamaschen und in Großvater Melvilles Racquethalle im Turm, deren Holzvertäfelung sich von den Wänden löste und deren Zementboden verätzt und mit Flecken übersät war durch die jahrelangen Chemieexperimente, die Onkel Henry als Junge dort durchgeführt hatte. Sie begab sich in den Taubenschlag, in die Orangerie, zum Torhaus und in die leeren Stallungen, wo ein einsamer Max die Trennwand seiner Pferdebox mit den Hufen bearbeitete, um überhaupt eine Beschäftigung zu haben. Sie spazierte auf der Brustwehr umher, durch die Gärten, zwischen den grasbewachsenen Böschungen des alten Burggrabens und über die Brücke zu den Obstgärten und in den Wald, und an jedem dieser Orte sammelte sie sämtliche Erinnerungen an Theo, deren sie sich entsinnen konnte.
Einige dieser Erinnerungen waren Teil der Familienlegende, Geschichten, die so oft erzählt worden waren, dass sich Jessica gar nicht mehr sicher war, ob sie sich wirklich selbst daran erinnerte: Theo, wie er mit dem Rolls-Royce über den Krocketrasen fuhr und Pritchard hinter ihm herlief wie ein Verrückter, oder wie Theo die gestopften wollenen Unterhosen von Mr Floyd, dem überforderten Hauslehrer, am Fahnenmast flattern ließ. Manche Erinnerungen waren für immer in Schwarzweiß festgehalten: ein pausbackiger Theo auf dem Rücken von Max bei seiner ersten Jagd am zweiten Weihnachtsfeiertag, mit einem Schneeball in jeder Hand neben einem riesigen Schneemann oder grinsend im Wald mit einer Schrotflinte im Arm und zwei Tauben, die an seinem Finger baumelten.
Die besten Erinnerungen aber waren jene, die ihr allein gehörten. Sie hatte nicht gedacht, dass es so viele wären. Theo, wie er Vaters Zylinderhut wie einen Wurfring über den Adler auf dem Treppenpfosten im Großen Saal segeln ließ. Theo, wie er im Kinderzimmer eine Schachtel öffnete und ihr die betrunkenen Hirschkäfer darin zeigte, nachdem sie sich an den Überresten der Cocktails gütlich getan hatten, die vor dem Essen auf der Terrasse kredenzt worden waren. Wie er auf dem verknoteten Seil über dem See hin und her schwang, um schließlich mit lautem Platschen im silbrig aufspritzenden Wasser zu landen. Oder wie er aus einem Zahnputzbecher mit stibitztem Champagner auf den Ferienbeginn trank, oder wie er sie immer wieder die Böschung zum Wassergraben hinunterrollen ließ, bis ihr Rock ganz grün war und er im Alleingang den Mahdi von Khartum zurückgeschlagen hatte. Wie sie zusammen bäuchlings auf dem Rasen lagen und er Blütenblätter von den Gänseblümchen zupfte, während sie aus den Blumen Kränze wand: Betet mich an, vergöttert mich, interessiert sich nur für meinen Körper. Wie sie, als er auf Heimaturlaub war, die Tür zur alten Spülküche öffnete und ihn weinend und zusammengekauert am Boden fand.
In die Spülküche war sie seither nicht mehr gegangen. Diese Erinnerung wollte sie nicht wachhalten.
Eleanor war entschlossen, ein Denkmal errichten zu lassen, und hatte einen Londoner Architekten mit dem Entwurf betraut. Ihr schwebte eine auf griechischen Säulen ruhende Kuppel vor, darunter eine Apollostatue, und auf der Innenseite der Kuppel ein Spruch von Sokrates: DIE SEELEN DER GERECHTEN SIND UNSTERBLICH & GÖTTLICH. Als Sir Aubrey einwandte, Arbeitskräfte seien knapp und wenn sie Bauarbeiten durchführen ließen, dann besser solche, die verhinderten, dass ihnen das Dach auf den Kopf fiel, ließ Eleanor ihn einfach stehen. Jessica erzählte sie, Mrs Waller habe Theo gefragt, ob ihm die Entwürfe für das Denkmal gefielen, und da sei der Zeiger umhergewirbelt wie ein Derwisch und habe auf JA gedeutet, sogar drei Mal hintereinander. Später, so berichtete Eleanor, habe Theo WEINE NICHT, LIEBSTE buchstabiert, klar und deutlich wie gedruckt. Alle Anwesenden seien sich einig gewesen, noch nie habe jemand eine derart eindeutige Botschaft aus dem Jenseits erhalten.
Seit dem Februar suchte Eleanor jeden Donnerstag Mrs Waller auf. Anfangs dachte Jessica, Eleanor werde der Sache bald überdrüssig, so wie sie allem bald überdrüssig wurde, aber fünf Monate später und trotz angeblicher Benzinrationierung fuhr Pritchard sie nach wie vor jeden Donnerstag nach dem Mittagessen nach Bournemouth und wartete, bis es Zeit für die Rückfahrt war. Vielleicht, dachte Jessica misslaunig, hielt ihre Mutter die Séancen für eine kriegswichtige Tätigkeit; falls ja, war es die einzige, der sie sich jemals widmete. Wenn Nanny am Samstagnachmittag ihr Strickzeug beiseitelegte und zum Haus heraufkam, um für alliierte Kriegsgefangene Pakete zu bestücken, behauptete Eleanor stets, sie habe Kopfschmerzen und müsse sich hinlegen. Andere Besitzer großer Häuser ließen Genesungsheime und Lazarette darin unterbringen, Eleanor aber verwahrte sich dagegen, dies auch nur in Betracht zu ziehen, selbst als das Kriegsministerium ein entsprechendes Ersuchen an sie richtete. Das sei undenkbar, erklärte sie. Es war einer der wenigen Punkte, in denen sie und Sir Aubrey einer Meinung waren.
Eleanor fragte Jessica nie, ob sie sie zu Mrs Waller begleiten wolle. Jessica war froh darüber. Sie hasste es, wenn Eleanor vom »Tempel« erzählte, als handelte es sich um ein Heiligtum und nicht einfach nur um ein Zimmer über einer Drogerie. Auch wollte sie nicht die Zettel mit dem Gekritzel betrachten, die ihr Eleanor, rotwangig und aufgeregt, vor die Nase hielt, als wären es magische Worte und nicht unverständliches Kauderwelsch. Und sie wollte sich nicht anhören müssen, wie Mrs Waller ihre Hände über die versiegelten Umschläge mit den Fragen der Teilnehmer kreisen ließ, um die Worte über die Haut aufzunehmen. Mrs Waller selbst konnte die Stimmen der Geister nicht vernehmen. Stattdessen begann sie nach jeder Frage das Alphabet aufzusagen, bis der Tisch wackelte, worauf sie von neuem begann. Die auf diese Weise gewonnenen Buchstaben fügten sie dann zu Wörtern und Sätzen zusammen. Wenn die Geister aufgeregt seien, erzählte Eleanor, fange der Tisch auf seinen hölzernen Beinen zu wackeln oder zu tanzen an oder drehe sich wie ein Karussell. An solchen Tagen sei die seelische Energie der Geister so stark, dass man sie als winzige Lichtblitze in der trüben rötlichen Dunkelheit wahrnehmen könne. Eines Nachmittags sei der Tisch auf wundersame Weise regelrecht emporgeschwebt, durch das Stimmengewirr aus dem Jenseits befreit von der Schwerkraft der Erde.
An manchen Tagen bediene sich Mrs Waller der Planchette, eines herzförmigen Stück Holzes mit einem daran befestigten Stift, das sich auf Geheiß der Geister bewege und Botschaften aufs Papier schreibe. Zuweilen praktiziere Mrs Waller auch das automatische Schreiben, bei dem ihre Rechte von einer fremden Hand geführt werde und der Stift in ihren Fingern wie verrückt auf das bereitliegende Papier Buchstaben kritzele. Mrs Wallers Trancen seien nicht besonders tief, sodass man ihr Fragen stellen könne, fast wie in einem Gespräch.
Eleanor bewahrte die Zettel in einem mit Seide ausgekleideten Kästchen auf ihrer Frisierkommode auf, selbst jene, auf denen die Spuren des Stifts kaum als Buchstaben zu erkennen waren. Sie las sie immer wieder, als wären es Liebesbriefe, bis das Papier dünn wurde wie Musselin. Bisweilen schlich sich Jessica donnerstagnachmittags, sobald das Auto außer Sichtweite war, ins Schlafzimmer ihrer Mutter und nahm die Zettel heraus. Sie betrachtete sie lange und versuchte in ihnen zu sehen, was Eleanor sah, aber es gelang ihr nicht. Es erschien ihr wie ein weiterer Verrat.