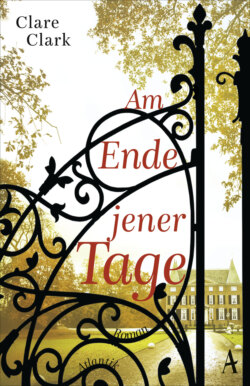Читать книгу Am Ende jener Tage - Clare Clark - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеIn den Osterferien 1917 beehrten die Yorkshire-Melvilles Ellinghurst schließlich mit ihrem Besuch. Angesichts dieses bedeutsamen Ereignisses bestand Sir Aubrey darauf, dass Phyllis übers Wochenende nach Hause kam, obwohl sie einwandte, sie sei im Genesungsheim unabkömmlich. Doch Sir Aubrey erwiderte, es gebe Dinge, die wichtiger seien als der Krieg.
Evelyn Melville war der Cousin vierten oder dritten Grades ihres Vaters. Zwar hatte Sir Aubrey Jessica das Verwandtschaftsverhältnis genau erklärt, aber sie hatte nicht zugehört. Niemand kannte Evelyn, außer Sir Aubrey, und selbst er hatte ihn nur einmal gesehen, vor unzähligen Jahren bei einer Familienhochzeit, als sein Cousin noch ein kleiner Junge gewesen war. Inzwischen war er ein Rechtsanwalt mittleren Alters und künftiger Erbe des Adelstitels Baronet. Er hatte eine Frau, Cousine Lettice, und vier kleine Söhne, von denen sich der jüngste auf seiner Decke wie eine Larve ausnahm. Die Melville-Baronets hatten immer auf Ellinghurst gelebt. Nach Sir Aubreys Tod würden Haus und Titel auf seinen Cousin Evelyn übergehen und eine seiner Larven Jessicas Schlafzimmer beziehen.
Die Yorkshire-Melvilles trafen mit dem Nachmittagszug aus London ein. Sir Aubrey ließ sie mit dem Auto vom Bahnhof abholen. Über ein Jahr lang hatte sich Jessica Evelyn als diabolischen, aber verführerischen Schurken ausgemalt, als Ganoven mit schwarzem Schnurrbart und finsterer Seele, der sämtliche Ländereien auf eine Karte setzen würde; manchmal auch wie den wehleidigen Mr Collins aus Stolz und Vorurteil, der die Porträts anglotzte und fettige Fingerabdrücke auf dem Silber hinterließ. Aber der Mann, der aus dem Wagen stieg, war ein ganz normal aussehender Mensch mit lichter werdendem Haar und Nickelbrille. Die dicken Brillengläser waren das einzig Auffällige an ihm. Von der Seite betrachtet meinte man, er habe vier Augen nebeneinander, zwei davon groß und verschwommen. Sein schlechtes Augenlicht habe ihm den Kriegsdienst erspart, erklärte er Jessica.
Während er und Sir Aubrey am nächsten Tag das Anwesen besichtigten, einen Blick in die Hauptbücher warfen und mit Grundstücksmaklern und Steuerberatern Unterredungen führten, machte sich Jessica mit Pritchard auf den Weg, um Phyllis vom Zug abzuholen. Alles war besser, als mit der dicken Cousine Lettice zusammen zu sein. Lettice übergab ihr Baby nicht dem Kindermädchen zur Betreuung wie normale Leute. Am liebsten hielt sie es im Arm und ließ es auf ihrem Knie wippen. Schlimmer noch, sie bot es immer wieder Jessica an wie ein Geschenk, als gäbe es nichts Schöneres auf der Welt als ein säuerlich riechendes Würmchen festzuhalten, dem, wenn man es drückte, ein ekliger weißer Brei aus dem Mund und über die Brust lief.
»Babys sind einfach himmlisch«, sagte Lettice zu Jessica und versuchte das schreiende Bündel in ihren Armen mit gurrenden Lauten zu beruhigen. »Warte nur, bis du selbst eines hast. Du wirst es zum Fressen gern haben.«
Jessica widerstand der Versuchung zu fragen, ob Babys mit Senf oder mit Minzgelee besser schmeckten. Es machte einfach keinen Spaß, die Lettices dieser Welt zu sticheln. Sie sahen einen dann nur auf gekränkte, verwirrte Weise an und sagten ausweichend, dass sie solche Späße nicht besonders schätzten, was einen wie einen Dummkopf dastehen ließ und gleichzeitig wütend machte.
»Sie ist erst einen Tag hier«, sagte sie auf der Rückfahrt im Wagen zu Phyllis, »hat mir aber schon versichert, sie spüre instinktiv, dass ich den Mann, den ich einmal heiraten werde, bereits kenne. Falls sie recht hat, ist es das Deprimierendste, was je ein Mensch zu mir gesagt hat.«
Phyllis lachte. Sie war schmal, fast hager, ihre blassen Augen mit den bläulichen Lidern zeugten von einer tiefen Erschöpfung. Was Jessica jedoch am meisten erschreckte, war die Art und Weise, wie Phyllis aus dem Fenster starrte, als sie die buckelige Brücke passierten. Jessica kannte das Gefühl, nach ein paar Monaten in der Schule wieder nach Hause zu kommen, diese wilde Mischung aus Heimweh und Erleichterung über jede Wegbiegung, die genau im richtigen Moment auftauchte, jedes schmerzlich vertraute Feld und jeden ordentlich ausgerichteten Zaunpfosten – all diese Details, die sie Stück für Stück zu sich selbst zurückbrachten. Der Gedanke, dass es Phyllis genauso ging, gab Jessica das Gefühl, ihr näher zu sein.
»Kaum zu glauben, dass jemand, der so verfettet ist, Knochen hat, geschweige denn etwas darin spürt, aber offenbar ist es so«, sagte sie. »In der Sekunde, da sie Evelyn erblickte, hatte sie ein untrügliches Gefühl. Es hat sie bis ins Mark getroffen, positiv meine ich. Ich wüsste nur zu gern, ob sie auch instinktiv gespürt hat, dass sie nur geduldig abzuwarten braucht, um eines Tages als Lady Melville aufzuwachen.«
Ein Zucken huschte über Phyllis’ Gesicht. Jessica war gespannt, nach wem sich Phyllis zuerst erkundigen würde, nach Eleanor oder Evelyn. Für beides hatte sie sich schon Antworten zurechtgelegt. Aber stattdessen beugte sich Phyllis nach vorn. »Würden Sie bitte anhalten, Pritchard? Gleich hier, bitte.«
»Oh Gott, ist dir etwa schlecht?«, fragte Jessica, aber Phyllis gab keine Antwort. Sie wartete nicht, bis Pritchard ausstieg und ihr die Wagentür aufhielt. Kaum hatte er die Bremse angezogen, kletterte sie hinaus. Jessica tat es ihr gleich. Es war nicht mehr weit. Vor ihnen führte der Weg durch abschüssige grüne Weiden, auf denen Schafe grasten, und zum Meer hin zeigte der Himmel eine milchig-blaue Färbung. Die Bäume im Wald waren kurz vor dem Ausschlagen, ein Hauch von Grün lag bereits auf den Zweigen. Phyllis reckte das Gesicht in die bleiche Frühlingssonne und lauschte den Vögeln und dem schwachen kehligen Blöken, mit dem die Mutterschafe ihre Lämmer riefen.
»Wenn du jetzt irgendwas in der Art sagst, wie schön und ruhig es hier ist verglichen mit London, dann schreie ich, das kannst du mir glauben«, sagte Jessica.
Phyllis lächelte. Dann kramte sie in den Taschen ihres Mantels und zog eine Schachtel Zigaretten und Zündhölzer heraus. »Willst du eine?«
Jessica schüttelte den Kopf und sah zu, wie sich Phyllis eine Zigarette anzündete. Sie wusste nicht, was mehr Unmut in ihr hervorrief – dass Phyllis rauchte oder dass sie keine Handschuhe trug. Mit derlei Dingen pflegte Phyllis Eleanor zu ärgern, sofern sie die Handschuhe nicht gerade verloren hatte natürlich. Phyllis hatte schon immer alles Mögliche verloren, ihr ganzes Leben lang. Eleanor trieb das schier in den Wahnsinn.
»Wann hast du mit dem Rauchen angefangen?«, fragte Jessica.
Phyllis gab keine Antwort. »Wir könnten uns immer noch von Pritchard zum Bahnhof zurückbringen lassen«, sagte sie stattdessen und blies eine Rauchwolke in die Luft. Ihre Hände waren rot und rau. »Um halb geht ein Schnellzug nach London.«
»Du hast dir schon den Fahrplan für die Rückfahrt angesehen?«
»Das ist eines der Dinge, die sie dir bei der Ausbildung zur Krankenschwester einbläuen.« Sie grinste säuerlich. »Merke dir für den Notfall stets die Ausgänge.«
»So verlockend das auch ist, ich weiß nicht, ob Lettices Knochen die Enttäuschung verkraften würden.«
»Und Eleanor?«
Jessica zögerte, dann zuckte sie mit den Schultern. »Du weißt schon«, sagte sie. Die Schwestern tauschten einen Blick. »Aber Mrs Moore hat einen Pflaumenkuchen gebacken.«
»Ist nicht wahr?«
»Heute Morgen. Eigens für dich.«
Phyllis stöhnte auf. »Teufel auch! Na gut, dann muss es halt der um sechs Uhr sein. Das ist zwar ein Bummelzug, aber bleibt mir eine Wahl? Mrs Moores Pflaumenkuchen.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich träume von ihm, weißt du. Die ganze Zeit.«
»Du bist zwanzig, lebst in einer Großstadt und träumst von Pflaumenkuchen? Sag, dass das nicht wahr ist.«
»Ich bin zwanzig und lebe in einem Heim in Roehampton, zusammen mit achtzig anderen Mädchen, und ich träume nicht von irgendeinem blöden Pflaumenkuchen. Ich träume von Mrs Moores Pflaumenkuchen, wenn er frisch aus dem Ofen kommt, innen noch warm und feucht, und fast platzt vor dicken Sultaninen und Walnüssen und himmlischen getrockneten Feigenstückchen …«
Jessica nahm Phyllis’ Kopf in beide Hände. »Du brichst mir das Herz, Phyllis Melville, weißt du das? Du brichst mir mein verdammtes Herz.«
Zum Tee verdrückte Phyllis zwei Stück Pflaumenkuchen und wiegte dabei Lettices Larvenbaby auf ihrem Schoß. Das Kind hielt still und sah sie ernst an, während sie Tee trank und ins Kaminfeuer starrte. Als Lettice sie nach ihrer Arbeit fragte, antwortete sie im Telegrammstil, als müsste sie für jedes einzelne Wort bezahlen. Ihr neuer Einsatzort sei Roehampton. Ein Genesungsheim. Ja, Queen Mary sei die Schirmherrin und schon mehrmals zu Besuch gekommen. Ein Privathaus, requiriert vom Kriegsministerium. Ja, speziell für Offiziere und Männer, die Gliedmaßen verloren hätten. Prothesen, zu Tausenden. Beine, Arme, manchmal beides. Ja, ein Wunder, was die Ärzte heutzutage bewerkstelligen könnten. Hundert neue Fälle pro Woche und eine lange Warteliste. Wird immer länger, ja. Natürlich, sehr tapfer. Ein leuchtendes Beispiel, alle.
»Auch du«, sagte Lettice. »Ich bewundere dich sehr. Es muss furchtbar anstrengend sein.« Sie beugte sich vor, das Gesicht vor Mitgefühl in Falten gelegt, die Hände flatterten im Schoß wie dicke Vögel. Doch Phyllis richtete sich nur mit unbewegter Miene in ihrem Sessel auf, den Blick auf das Kaminfeuer gerichtet. »In Harrogate gibt es auch ein solches Heim für Männer. Manchmal sieht man, wie sie davor herumgeführt werden, die Hälfte von ihnen blind, die Gesichter völlig zerstört. Ich sag den Kindern immer, sie sollen nicht hinsehen, aber sie tun es natürlich trotzdem. Sie können nicht anders. Ich meine, man hat doch Mitleid mit diesen armen Wesen, natürlich hat man das, es ist einfach zu schrecklich, aber ich weiß nicht recht, ob man sie so auf die Straße lassen sollte. In die Öffentlichkeit, meine ich. Teddy hat davon Albträume bekommen.«
»Man sollte sie einsperren«, sagte Phyllis. »Oder ertränken. In Säcken wie kleine Kätzchen.«
»Also nein, das habe ich doch nicht … wie kleine Kätzchen, gütiger Himmel!«, stotterte Lettice, völlig aus der Fassung geraten. »Vermutlich ist das der berühmte Lazaretthumor, von dem alle reden. Nichts kann so grausig sein, dass man nicht Witze darüber reißen könnte, stimmt’s?«
Phyllis öffnete den Mund, schloss ihn aber gleich wieder. »Ich weiß nicht«, sagte sie schließlich mit Überdruss in der Stimme. »Dazu müsste man die Jungs auf meiner Station fragen.« Dann fingerte sie eine Zigarette aus der Schachtel auf dem Tisch und zündete sie an. Lettice machte ein entsetztes Gesicht.
»Du meine Güte! Ich glaube nicht … ich meine, wenn es dir nichts ausmacht«, sagte sie und hob die Larve von Phyllis’ Schoß. »Du verstehst doch, nicht wahr, die Gefahr, dass er sich verbrennt …«
Das Baby fing an zu plärren. Phyllis sah Lettice an, die Zigarette zitterte zwischen ihren Lippen. Einen Augenblick lang dachte Jessica, Phyllis würde Lettice ohrfeigen. Stattdessen gab sie ein seltsam ersticktes Lachen von sich. Dann zog sie so heftig an der Zigarette, dass die Spitze rot aufglühte, warf sie ins Feuer und stand auf. Hinter ihr auf dem Tisch hatte ihre Mutter die Pläne für das Denkmal ausgebreitet.
»Bitte sieh dir das an«, sagte Eleanor zu Phyllis und strich das Papier glatt. Aber Phyllis drehte den Kopf zur Seite und erklärte, sie werde jetzt einen Spaziergang machen.
»Ich komme mit«, bot Jessica an. Phyllis schüttelte den Kopf.
»Würde es dir etwas ausmachen, hierzubleiben?«, sagte sie. »Ich möchte lieber allein sein.«
Nachdem sie gegangen war, herrschte Schweigen. Kurz darauf kam Cousin Evelyn mit Sir Aubrey zurück. Ihm gefielen die Pläne für das Denkmal. Dann setzte er sich neben Jessica. Er finde Ellinghurst herrlich, sagte er. Als sie erwiderte, das sei gut, denn bald würde er ja hier wohnen, lächelte er und sagte, er sei sicher, Sir Aubrey werde sie alle überleben.
»Hampshire hat durchaus seine Reize, natürlich«, sagte er, »aber Yorkshire kann es nicht das Wasser reichen.« Harrogate sei reizvoller als Buxton, ja sogar als Bath, und wenn Jessica einen so gesunden Teint haben wolle wie Letty, die trotz ihrer vier Kinder immer noch die hübscheste Frau in ganz Yorkshire sei, solle sie sie besuchen und in Harlow Carr Schwefelbäder nehmen.
»Schwefel?«, fragte Jessica und verzog das Gesicht. »Stinkt das nicht fürchterlich?« Aber Cousin Evelyn lächelte unverwandt und erwiderte, Harrogate sei das weltweit fortschrittlichste Zentrum für Wasserheilkunde. Und was die im Kursaal gegebenen Konzerte angehe, so überträfen diese alles, was in London oder Wien gespielt werde, und zwar nicht erst seit Beginn des Kriegs.
»Die Royal Hall, Evie, Liebster«, korrigierte ihn Lettice und beugte sich vor, um ihm einen nicht vorhandenen Fussel vom Ärmel zu bürsten. »Wir sagen jetzt Royal Hall dazu.«
Sie betatschte ihn ständig, und er sie. Als Cousin Evelyn tags darauf nach der Kirche im Morgenzimmer seine Nase an der von Lettice rieb, warf Phyllis ihrer Schwester heimlich einen angewiderten Blick zu und deutete mit zwei Fingern in ihren Mund, als wollte sie sich übergeben. Dann verließ sie den Raum. Jessica machte Anstalten, ihr zu folgen, aber ihr Vater legte ihr eine Hand auf den Arm. Leise sagte er, der Pflegedienst sei eine schlimme Sache, Phyllis habe da Dinge gesehen, die kein Mädchen ihres Alters sehen dürfte.
»Hat sie dir das erzählt?«, fragte Jessica überrascht.
»Das musste sie gar nicht. Lass sie einfach in Ruhe.«
Jessica folgte dieser Bitte, obwohl es ihr nicht fair erschien. Was hatte es für einen Sinn, Phyllis zu bitten, nach Hause zu kommen, wenn sie sich dann ständig zurückzog? Gereizt trottete sie hinter Lettice her, die ihre Larve im Kinderwagen für den allmorgendlichen Spaziergang nach draußen schob. Der Rasen war zu weich für die Räder, deshalb gingen sie die Auffahrt und dann den Pfad zum alten holländischen Garten entlang, wo Arbeiter damit begonnen hatten, das Fundament für Theos Denkmal zu legen. Als der Pfad in Schlamm überging, blieb Lettice stehen und legte eine Hand auf Jessicas Arm.
»Ich hoffe, du hältst es nicht für anmaßend«, sagte sie, »aber ich spüre Theos Gegenwart hier sehr stark. Wie im Zimmer eines Babys, wenn es schläft. Dieser Frieden, die Stille nach dem Trubel des Tages.«
Jessica zuckte mit den Schultern. »Warte mal, bis am Montag die Arbeiter wiederkommen. Dann ist es vorbei mit der Stille.«
»Ja, natürlich. Aber das habe ich nicht gemeint.«
»Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob Eleanor auf Stille aus ist. Ihr ist es lieber, die Toten quasseln wie ein Wasserfall.«
»Du meine Güte, meine Liebe, was redest du denn da!«
»Wieso, stimmt doch. Vermutlich glaubst du auch an all diesen Quatsch? An Spiritismus, schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits?«
»Wenn du mich fragst, ob ich daran glaube, dass die Toten die Hände nach uns ausstrecken, dann antworte ich mit Ja. Du etwa nicht?«
»Natürlich nicht. Das ist fauler Zauber.«
»Oh nein, meine Liebe«, sagte Lettice entschieden. »Es gibt wissenschaftliche Beweise dafür.«
»Was für Beweise?«
»Da solltest du lieber Evie fragen, er kennt sich damit viel besser aus als ich, aber ein Cousin meiner Mutter ist ein sehr angesehener Wissenschaftler, Sir Oliver Lodge, vielleicht hast du schon von ihm gehört? Er ist brillant. Er hat die Telegrafie schon vor Mr Marconi erfunden, auch wenn Mr Marconi als gewiefter Italiener diese Erfindung flugs für sich reklamiert hat.«
»Was hat das denn mit dem Jenseits zu tun?«
»Raymond Lodge, der jüngste Sohn von Sir Oliver, ist vor zwei Jahren in Flandern gefallen. Inzwischen hat Sir Oliver wissenschaftlich bewiesen, dass Raymonds Geist, auch wenn sein Körper tot ist, nach wie vor unter uns weilt. Darüber hat er ein Buch geschrieben, Raymond. Du kennst es nicht? Es ist ein wahrer Verkaufsschlager.«
Jessica schüttelte den Kopf. Von der Auffahrt hinter den Rhododendren war Hufgetrappel zu hören, und als der Pferdewagen um die Ecke bog, erblickte sie Jim Pughs vertrauten, vom Wetter zerschlissenen Hut. Sie runzelte die Stirn. Es war doch gar kein Besuch angekündigt.
»Wir sollten zurückgehen«, sagte sie.
Der Besucher trug die Uniform eines Captains. Als sie beobachtete, wie der Offizier am Kutschenportal ausstieg, spürte Jessica wieder den altvertrauten Schrecken in sich aufsteigen, obwohl sie wusste, dass niemand sonst aus ihrer Familie umgekommen sein konnte. Auf dem Kutschbock drückte sich Jim Pughs weißer Hund an sein Herrchen, die braunen Augen trüb vom Alter.
»Soll ich bleiben?«, flüsterte Lettice, aber Jessica schüttelte den Kopf. Sie wartete, bis Lettice den Kinderwagen in den Großen Saal bugsiert hatte. Dann streckte sie, höflich lächelnd, die Hand aus.
Der Offizier hieß Cockayne. Er habe Lady Melville geschrieben, sagte er, sie erwarte ihn. Jessica tat, als wisse sie Bescheid. Sie wies Jim an, den Pferdewagen zu den Stallungen zu bringen, und führte den Captain ins Morgenzimmer. Dort läutete sie nach Tee. Als Enid mit einem vollen Tablett zurückkam, sagte sie zu Jessica, Lady Melville bitte um Entschuldigung, sie werde gleich da sein.
»Es ist meine Schuld«, sagte Cockayne. »Ich habe einen Zug früher genommen.«
Jessica goss Tee ein. »Milch, Captain Cockayne?«
»Guy. Zitrone, danke.«
Er diente bei den Royal Hampshires, Theos Regiment. Jessica erkannte das Tigeremblem auf seinen Knöpfen. Er und Theo seien in derselben Woche eingerückt und von da an immer zusammen gewesen, sagte er. Ein halbes Jahr nach Theos Tod sei auch er verwundet worden. Die Kugel eines Scharfschützen, sagte Guy. Aber nicht genau genug gezielt, um ihn zu töten. Nach ein paar Monaten Genesung hätten ihn die Ärzte wieder für einsatzfähig erklärt. In einer Woche werde er zu seinem Bataillon zurückkehren. Er erzählte ihr das alles mit tonloser Stimme, als sei es eine Durchsage am Bahnhof, und sah sich dabei ständig um, als versuchte er sich an etwas zu erinnern. In Jessica rührte sich der Verdacht, dass er vielleicht gar kein Soldat war, sondern ein Trickbetrüger, der nach Dingen Ausschau hielt, die einen Diebstahl lohnten. Sie rückte geflissentlich die Löffel auf dem Teetablett gerade und fragte sich, wo ihre Mutter blieb.
Dann holte er Fotografien aus seinen Taschen. Sie zeigten Theo, manchmal allein, manchmal zusammen mit anderen Männern. Jessica griff nach einer der Aufnahmen und betrachtete sie. Theo, der in einem Schützengraben saß, den Rücken an einem Wall aus Sandsäcken, neben sich ein Gewehr. Er sah müde aus und verdreckt, seine Gamaschen waren schlammverkrustet, aber er reckte sich mit zusammengekniffenen Augen der Kamera entgegen, als würde er ein Geheimnis ausplaudern. Jessicas Herz schlug schneller.
»Wer hat das Foto gemacht?«, fragte sie.
»Ich.«
»Ich dachte, an der Front sind Kameras nicht erlaubt?«
»Stimmt. Es war Theos Kamera. Er hat sich nie viel um Vorschriften geschert.« Er rang sich ein Lächeln ab. Jessica betrachtete abermals das Foto von Theo, dann sah sie wieder Guy Cockayne an. Er hatte braunes Haar, das ihm leicht in die hohe Stirn fiel, aber seine Augen waren von einem reinen, klaren Blau, außen dunkler als in der Mitte, als hätte jemand seine Iriden mit Tinte eingekreist. Seine vollen Lippen und die hohen Wangenknochen wurden durch das hagere Gesicht noch betont. Er sah nicht wie ein Soldat aus, eher wie ein Dichter oder ein mittelalterlicher Heiliger. Als er ihr das Gesicht zuwandte, begegnete er ihrem Blick. Schnell schlug sie die Augen nieder und starrte in ihre Teetasse.
»Sie sehen ihm sehr ähnlich«, sagte er.
»Tatsächlich?«, erwiderte sie mit heiserer Stimme. Es fiel ihr schwer zu sprechen.
»Sie haben dieselben Augen.«
»Löwenaugen. Hat unser Kinderfräulein immer gesagt.«
»Löwenaugen.« Er nickte. »Ja.«
»Sie sagte immer, Löwenaugen seien ja schön und gut, aber was wirklich zähle, sei ein Löwenherz.« Sie zögerte und wusste nicht, wie sie die Frage stellen sollte. »War Theo … war er sehr tapfer?«
Guy beugte sich vor und rückte die auf dem Tisch aufgereihten Fotos zurecht. Seine Hände waren lang und schmal, mit blassen Nägeln.
»Theo war der tapferste Mann, der mir je begegnet ist«, sagte er schließlich. »Ganz gleich, wie schlimm es draußen war, er weigerte sich einfach, Angst zu haben. Er sagte, es sei kein Mut, sondern eingefleischter Widerspruchsgeist. Er sagte, Sie seien genauso.«
»Er hat von mir erzählt?«
»Natürlich.«
»Was … was hat er erzählt?«
»Dass Sie genauso sind wie er. Wild. Frei. Ungezähmt. Wie eine wilde Kreatur, die lieber sterben würde, als in Gefangenschaft zu leben.« Er lachte, ein ersticktes Husten, und zog den Kopf ein. »Entschuldigung.«
Jessica starrte auf den Boden und versuchte sich Theo vorzustellen, wie er solche Dinge über sie gesagt hatte. Ihr ganzes Leben lang hatte sie ihn geliebt und zu ihm aufgeblickt und sich gewünscht, so zu sein wie er und von ihm wahrgenommen zu werden. Und ihr ganzes Leben lang hatte es sie gequält, dass er sie nicht beachtete. Doch er hatte sie wahrgenommen und beachtet. Er hatte erkannt, dass sie so war wie er. Ein Anflug von Stolz durchfuhr sie.
Die Tür ging auf, und Eleanor kam herein, mit Phyllis im Schlepptau. Guy erhob sich. Als sie sich setzten, platzierte sich Eleanor auf dem Sofa so nah neben ihm, dass sich ihre Beine fast berührten. Beim Anblick der Fotos kamen ihr die Tränen. Sie sagte, Theo habe Mrs Waller etwas von Fotos gesagt und sei ganz ungehalten gewesen, als sie nicht gleich begriffen habe. Streifen dahinter, habe er gesagt – Eleanor deutete auf das Muster der Sandsäcke hinter Theo. Streifen dahinter. Sie sagte es so, als würde dies alles erklären.
Nachdem Guy seinen Tee getrunken hatte, sagte er, er müsse aufbrechen, um noch den Zug zu erreichen, und bat darum, sich die Hände waschen zu dürfen. Eleanor ging nach oben, um sich hinzulegen, und Jessica wartete mit Phyllis im Großen Saal. Als er längere Zeit nicht zurückkam, machte sich Jessica auf die Suche nach ihm. Sie fand ihn im Gang, wo er mit der Stirn an die Wand gelehnt dastand, die Augen geschlossen.
Bei der Verabschiedung an der Eingangstür spürte sie, wie schlank und knochig seine Hand war.
»Darf ich Ihnen schreiben, an die Front?«, sagte sie unvermittelt. »Um Theos willen, meine ich. Über Theo.«
Guy zögerte zuerst, dann nickte er. »Ja, bitte.«
Tags darauf machten sich die Yorkshire-Melvilles auf die Heimreise nach Harrogate. Es regnete, ein feines Nieseln, das sich wie Rauch in den Bäumen verfing. Gemeinsam mit Phyllis und ihrem Vater wartete Jessica unter dem Steinbogen des Kutschenportals, während Cousin Evelyn seiner Frau, dem Kindermädchen und dem Larvenbaby in den Wagen half. Nachdem alles verstaut war, kam er noch einmal zum Portal. Auf seinem Mantel glitzerten winzige Regentropfen.
»Kommt uns besuchen«, sagte er und gab den beiden Mädchen einen Abschiedskuss. »Dann zeigen wir euch, warum es zwei Sorten Menschen auf der Welt gibt, die aus Yorkshire und die anderen, die gern dort leben würden.« Angesichts seines breiten Yorkshire-Dialekts stellten sich Jessica die Nackenhärchen auf.
»Du wirst froh sein, wieder nach Hause zu kommen«, sagte ihr Vater.
»Doch, ja, eigener Herd ist Goldes wert, wie man so schön sagt.« Sie gaben sich die Hand. Dann tätschelte Evelyn ihrem Vater unbeholfen den Arm. »Bestelle Eleanor unseren Dank, ja? Hoffentlich geht es ihr bald besser.«
Sir Aubrey nickte. »Gute Reise«, sagte er.
Cousin Evelyn beugte den Kopf, um in den Wagen zu steigen, zögerte jedoch und richtete sich noch einmal auf.
»Du weißt hoffentlich, wie leid es mir tut, Aubrey«, sagte er. »Diese … Situation. Das hätte sich keiner von uns gewünscht.«
Als der Wagen mit knirschenden Reifen losfuhr, trat Sir Aubrey auf die Kiesauffahrt hinaus. Er sah zu, wie der Wagen langsam den Weg hinunterrollte und bei den Rhododendren um die Kurve bog, bis er außer Sichtweite war. Erst als der Regen stärker wurde, drehte er sich um und ging ins Haus zurück.