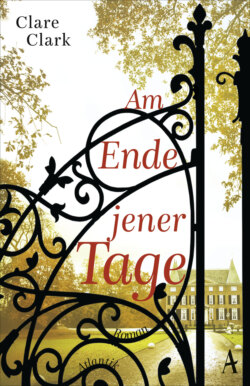Читать книгу Am Ende jener Tage - Clare Clark - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление1915
Der Dezember war bitterkalt. Auf dem dick zugefrorenen See von Ellinghurst konnte man Schlittschuh laufen, und an den Fensterscheiben bildeten die Eiskristalle wellige Muster wie auf Muschelschalen. Am zweiten Sonntag des Monats, als der graue Nachmittag in die Dämmerung überging, schneite es. Jessica stand am Fenster des ehemaligen Kinderzimmers. Es brannte kein Licht. Sie beobachtete, wie die weißen Flocken wie Federn in die heraufziehende Dunkelheit schwebten. Jenseits der schwarzen Silhouette der Bäume hing der Vollmond wie ein silbriger Fleck unter der dichten Wolkendecke. Fröstelnd zog sie sich ihre Strickjacke enger um die Schultern.
Theo war tot. Ein Junge hatte das Telegramm gebracht, auf einem roten Fahrrad war er die Auffahrt heraufgekommen. An das Steinsims des Fensters gelehnt, hatte Jessica die silberne Klingel und das dunkle, ausgefranste Stoffband erkennen können, das um den Lenker gewickelt war. Als Mrs Johns den Jungen erblickte, wich sie von der Tür zurück und rief schrill nach Jessicas Mutter. Jessica hörte Eleanor auf der Treppe zur Galerie etwas zu Phyllis sagen und dann das Klacken ihrer Absätze auf den Stufen, begleitet von dem kaum verhüllten Ärger in ihrer Stimme.
»Also wirklich, Johns, was kann denn schon …« Aber als sie den Jungen erblickte, erstarben ihr die Worte auf den Lippen, und ihre Beine gaben nach. Sie musste sich am Adler am Fuß des Treppengeländers festhalten, um nicht zu Boden zu sinken, und sah nicht auf, als Sir Aubrey aus seinem Arbeitszimmer stürzte, hinter ihm Mrs Johns, die Hände in die Schürze gekrallt. Eleanor ging auch nicht dem Jungen entgegen, der in seiner zu großen Uniform auf der Schwelle wartete, den Briefumschlag in der ausgestreckten Hand. Sie klammerte sich an den Pfosten, als wäre er ein Schiffsmast bei stürmischer See, das Gesicht kalkweiß, und wiegte den Kopf vor und zurück.
Vor nicht einmal drei Monaten hatten sie die Nachricht erhalten, dass Onkel Henry in der Schlacht von Gallipoli gefallen war.
»Nein«, sagte sie mit entsetztem Blick. »Nein, nein, nein«, wiederholte sie immer und immer wieder und heulte düster auf wie der Wind im Kamin. Sir Aubrey kramte eine Münze aus der Tasche und reichte sie dem Jungen. Als dieser ihm den Umschlag gab, starrte er darauf, als hätte er noch nie zuvor ein Telegramm gesehen.
Jessica ballte die Fäuste, dass sich die Nägel in ihre Handteller gruben, und wünschte inständig, ihr Vater würde den Umschlag nicht öffnen. Denn so lange bliebe das, was darin stehen mochte, ungeschehen. Vorerst zumindest. Ihr Vater strich mit dem Daumen über die maschinengeschriebene Adresse. Dann drehte er das Kuvert um, glitt mit dem Finger unter die Lasche und zog das Blatt Papier heraus. Jemand schrie erstickt auf. Vielleicht sie.
Dann stand, wie bei einem Schnitt in der Wochenschau, plötzlich Phyllis neben ihr.
»Vater?«, sagte Phyllis und streckte die Hand aus, aber Sir Aubrey schüttelte nur den Kopf und starrte weiter auf das Telegramm. Er atmete stockend und wankte leicht. Phyllis trat einen Schritt näher an ihn heran. Er blinzelte und sah hoch, drehte sich von ihr weg und schüttelte den Kopf, während er mit der freien Hand über seine Krawatte strich.
»Keine Antwort«, sagte er zu dem Jungen. Dieser nickte, rückte seine Kappe zurecht und öffnete den Mund, als wollte er etwas erwidern. Aber es kam nichts heraus. Er machte kehrt und schwang das Bein über sein rotes Fahrrad. Nachdem sich die Eingangstür geschlossen hatte, herrschte unerträgliches Schweigen. Jessica stand wie versteinert da, hypnotisiert vom Ticken der Standuhr, dem Zischen und Seufzen des Kaminfeuers und Eleanors leiser Totenklage, die von heiserem Atemholen unterbrochen wurde.
»Vater?«, fragte Phyllis erneut und mit unsicherer Stimme.
Sir Aubrey räusperte sich. Sorgfältig faltete er das Telegramm zusammen und steckte es in die Innentasche seines Jacketts. »Bring bitte deine Mutter nach oben«, sagte er mit einer Stimme, die nicht die seine war. »Sie muss sich hinlegen.«
Phyllis schüttelte den Kopf. »Was steht in dem …«
»Gefallen im Kampf. Vierter Dezember. Vermutlich werden wir zu gegebener Zeit mehr erfahren.« Er hielt inne und zog ein Taschentuch heraus. Letzten Samstag, dachte Jessica stumm, während Phyllis die Hände vors Gesicht schlug. Theo war seit letztem Samstag tot. Sie beobachtete, wie ihr Vater das Taschentuch entfaltete und sich schnäuzte. Sorgfältig faltete er es wieder zusammen.
»Es gibt keine edlere Tat, als sein Leben für sein Land hinzugeben«, sagte er mit brüchiger Stimme. Eleanors Schreie waren spitzer und kürzer geworden, sie gellten in den Ohren wie kleine schmerzhafte Stiche. »Wir sollten stolz sein. Mrs Johns, würden Sie bitte? Ich … ich muss mich um einige Dinge kümmern.« Er steckte das Taschentuch wieder ein. Dann strich er abermals über seine Krawatte, ging ins Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich.
Die nächsten Tage waren bestimmt von den üblichen Ritualen. Besucher kamen und verschwanden wieder. Eine bleichgesichtige Phyllis bewirtete sie mit Tee. Drei Tage später brachte die Morgenpost einen Brief aus Frankreich. Jessica hielt sich gerade im Großen Saal auf, als er eintraf. Sie starrte auf Theos vertraute krakelige Handschrift auf dem Umschlag, und es brach förmlich aus ihr heraus. Theo lebte! Es hatte ein Versehen gegeben. Es war nicht Theo, den diese Granate in Stücke gerissen hatte, nein, nicht Theo, sondern jemand anderes. Wusste er überhaupt, dass sie geglaubt hatten … Der Umschlag war an ihre Mutter adressiert, dennoch riss sie ihn auf.
Der Brief war knapp gehalten, nicht einmal eine Seite lang. Theo hatte noch nie viel fürs Briefeschreiben übriggehabt. Sie sollten sich keine Sorgen um ihn machen, schrieb er, sein Bataillon sei zwar vorgerückt, aber sie fühlten sich trotzdem recht sicher, denn nur gelegentlich flögen verirrte Geschosse über sie hinweg. Sie seien nicht mehr dem schweren Bombardement ausgeliefert, das ihnen in der letzten Stellung so sehr zugesetzt habe. Er wünschte nur sehnlichst, dass es endlich zu regnen aufhörte, denn der Regen verwandle alles in einen tiefen, klebrigen Matsch. Aber auch wenn die ganze Welt aus Schlamm bestehe und die Männer darin ebenso, seien seine Jungs guter Laune, allein schon wegen der Gerüchte, dass in den deutschen Schützengräben alles noch schlimmer sei. Zumindest in dieser Hinsicht ist der Sieg unser, schrieb er, obwohl ich für ein trockenes Paar Strümpfe alles geben würde. Unter seinem hingekritzelten Namenszug hatte er das Datum notiert.
Jessica sank auf die Steinplatten nieder, schlang die Arme um die Knie und schluchzte tränenlos. 2. Dezember 1915. Sie hätte nicht geglaubt, dass der Schock noch einmal genauso groß sein konnte.
Später, sie wusste nicht zu sagen wann, stand sie auf und ging barfuß ins Badezimmer. Unten brannte Licht, und auf dem Treppenabsatz zeichneten sich längliche Schatten ab. Das Haus lag nicht mehr im Schlaf. Die Zeit hatte ihre Bedeutung verloren, die alten Grenzen zwischen Tag und Nacht waren aufgehoben. Vor Theos Zimmer blieb sie zögernd stehen. Die Tür stand einen Spalt weit offen, und ein schmaler Lichtstreifen fiel auf den Holzboden im Inneren. Mit stockendem Atem schob sie die Tür auf.
Drinnen stand, Jessica den Rücken zugewandt, ihre Mutter vor der Kommode. Die oberste Schublade war offen, ihr Inhalt über den Boden verstreut. In den Händen hielt Eleanor ein Paar wollene Jagdsocken, dunkelgrün und mit einem fröhlich gelben Rautenmuster an den Bündchen. Langsam, als könne sie ihren Kopf nur mühsam im Gleichgewicht halten, drehte sie sich um, ohne etwas zu sagen. Jessica war sich nicht sicher, ob Eleanor sie überhaupt wahrnahm. Ihr Gesicht war versteinert, und wie bei einem Totenschädel sah man nur dunkle Höhlen anstelle der Augen. Die silbergerahmten Fotografien hinter ihr auf der Kommode waren alle zur Wand gedreht.
Auf Ellinghurst war es seit jeher Tradition, an Heiligabend das ganze Haus weihnachtlich zu schmücken. Aus dem Wald holten sie Fichtenzweige und Efeuranken und flochten sie zusammen mit Tannenzapfen, scharlachroten Bändern sowie getrockneten Orangenscheiben und Zimtstangen zu Kränzen, mit denen sie Anrichten und Treppenpfosten dekorierten. Die Kinder sammelten Stechpalmenzweige und klemmten sie hinter die Bilderrahmen. Auch an die Türen hängte man Kränze, auf die Kaminsimse stellte man silberne Kandelaber mit cremefarbenen Kerzen, und den Großen Saal zierte ein riesiger Weihnachtsbaum, so hoch, dass man ihn von der Galerie aus fast berühren konnte, behängt mit Glaskugeln, silbernen Sternen und Hunderten von kleinen elektrischen Kerzen.
An Weihnachten 1915 jedoch gab es keinen Schmuck, und es kamen auch nicht wie sonst Eleanors Freunde mit ihren Zigarettenspitzen, es wurde weder getanzt noch wurden Cocktails getrunken. Als der Sohn von Mr Fisher den Baum abliefern wollte, schickte ihn Mrs Johns wieder fort. Wie ein gebrochener Knochen ragte der abgehackte Stamm wippend über den Rand des klappernden Karrens, als der Junge den Rückweg antrat. Die Sterne und Kugeln und das schwere Silberlametta, das Onkel Henry vor dem Krieg aus Deutschland mitgebracht hatte, blieben in ihren Kisten auf dem Dachboden. Eleanor sperrte das Klavier ab. Keine Musik, keine Lieder. Der Tod erfüllte das Haus wie schmutziges Wasser, das jedes Geräusch erstickte.
Als hätte jemand die Zeit angehalten. Die Zeiger der Uhr wanderten zwar langsam um das Zifferblatt, aber die Tage blieben sich gleich. Solange Jessica denken konnte, war auf Ellinghurst der Weihnachtsmann stets um Mitternacht an Heiligabend erschienen, nicht durch den Kamin wie in den Weihnachtsgeschichten, sondern durch die Eingangstür, weil – wie Eleanor immer sagte – nur ein Verrückter durch den Kamin käme, wenn das Feuer brannte. Als Jessica mit sieben Jahren gesehen hatte, wie der Weihnachtsmann Eleanor die Hand küsste, hatte sie begriffen, dass es gar nicht der Weihnachtsmann war, sondern Monsieur du Marietta, der aus Wien stammte und jeden Morgen zum Frühstück vier grüne Äpfel aß. Tags darauf, nach dem Kirchgang und bevor die Geschenke ausgepackt wurden, schlich sie in sein Zimmer und füllte seine Schuhe mit einem Brei aus Mehl und Wasser. Eleanor war außer sich. Sie wies Nanny an, Jessica ohne Abendessen zu Bett zu schicken, Weihnachten hin oder her, um dort zu bleiben, bis es ihr leid tue. Aber Jessica tat es nicht leid, nicht im Mindesten, nicht nur, weil Monsieur du Marietta es verdient hatte, sondern weil Theo gesagt hatte, sie sei ein staunenswertes Geschöpf, und sie an ihren Armen durch die Luft gewirbelt hatte. Zu Jessicas liebsten Beschäftigungen gehörte es, auf dem Bauch auf der Galeriebrüstung zu balancieren; sie liebte die schwindelerregende Höhenangst, die sie dabei befiel. Aber wenn Theo sie herumwirbelte, war es fast so, als würde sie tatsächlich fliegen.
Auch in den Folgejahren kam der Weihnachtsmann weiterhin nach Ellinghurst, obwohl sie alle längst zu alt waren, um noch an ihn zu glauben. Einmal war es ein Bankier, den Eleanor in Berlin kennengelernt hatte, ein andermal ein italienischer Bildhauer. Und einmal Mr Connolly mit dem weißen Automobil. Im Jahr zuvor war es Theo gewesen, als er eine Woche Fronturlaub hatte. Seine Hand zitterte, als er die Geschenke verteilte. Anschließend saß er mit einem Glas Whisky am Kamin. Eleanor hatte den Kopf an seine Schulter gelehnt, und ein paar ihrer Haarsträhnen hafteten an seinem scharlachroten Mantel.
»Versprich mir, mein Schatz«, flüsterte sie, »versprich mir, dass du immer der Weihnachtsmann sein wirst.«
Theo versprach es nicht. Er hob nur sein Glas, rief mit schwerer Zunge »Ho, ho, ho!« und leerte es in einem Zug. Überhaupt trank er diese Weihnachten eine Menge Whisky, und das machte ihn aggressiv. Er versuchte, mit Phyllis Streit anzufangen, aber sie war wie ihr Vater und ging nicht darauf ein, also ließ er seine Zanksucht an Jessica aus. Sie revanchierte sich, indem sie zu ihm sagte, er sei abscheulich und es wäre ihr lieber gewesen, er wäre nicht nach Hause gekommen. Zwei Tage vor Ende seines Urlaubs verließ er Ellinghurst und fuhr nach London. Er verriet nicht, warum er fortging und wohin. Nanny erklärte Jessica, es sei nicht ihr Fehler und Jungs in Theos Alter seien nun einmal schwierig, aber Eleanor war untröstlich. Sie weinte und tobte und warf Sir Aubrey vor, er habe Theo aus dem Haus getrieben. Das war nicht fair, aber statt zu protestieren, begab er sich wortlos und mit steinerner Miene in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich.
Er behauptete stets, er ziehe sich zurück, um an seinem Buch über die Geschichte von Ellinghurst zu arbeiten, aber Jessica wusste, dass es reine Schwäche war. Nie bot er Eleanor Paroli, selbst wenn sie ihn im Gespräch mit anderen Männern auslachte. Das war auch der Grund, warum sie ihn nicht liebte. Man konnte jemanden lieben, der mit einem stritt, und selbst im erbittertsten Zank konnte man ihn so sehr lieben, dass es wehtat. Aber wie konnte man jemand lieben, der kein Rückgrat besaß?
An Weihnachten nach Theos Tod gab es keinen Weihnachtsmann. Heiligabend kam Eleanor nicht zum Essen herunter. Doch am nächsten Morgen gingen sie gemeinsam in die Kirche, darauf hatte Sir Aubrey bestanden. Sie seien nicht die einzige Familie im Dorf, sagte er, die einen Sohn verloren habe. Es war das erste Mal seit dem Telegramm, dass Eleanor das Haus verließ. Sie hielt sich an Phyllis fest, als sie in ihrem raschelnden schwarzen Kleid aus dem Wagen stieg, das Gesicht hinter einem dichten Trauerflor verborgen. Auf dem Friedhof blieb sie plötzlich stehen und legte die Hand auf einen von Flechten überwucherten Grabstein. Phyllis flüsterte ihr etwas zu und drückte aufmunternd ihren Arm, aber sie krümmte sich, als sei ihr übel, und wurde von Schluchzern geschüttelt. Angesichts dieser ungezügelt zur Schau gestellten Trauer hatte Jessica das Gefühl, als würde man ihr ein Kissen aufs Gesicht pressen.
Sie betraten die Kirche erst, als die Orgel bereits den Einzugschoral spielte. Jessicas Erinnerung nach war das Gotteshaus geschmückt wie stets zur Weihnachtszeit – mit der Krippe mit bemalten Gipsfiguren in der hochkant gestellten Holzkiste, die als Stall diente, dem Winterjasmin in den hohen Vasen hinter dem Altar, dem Adventskranz mit den heruntergebrannten roten Kerzen und der weißen Kerze in der Mitte, deren Flamme in der Zugluft von der Eingangstür ein wenig flackerte. Jessica sog den vertrauten Kirchengeruch tief ein. Auf dem Weg zu ihrem Platz erhoben sich mehrere Gemeindemitglieder und bekundeten flüsternd ihr Beileid, aber Eleanor reagierte nicht. Sie verschränkte fest die Hände, während Phyllis sie zu der für ihre Familie reservierten Bank führte, eine gebeugte Gestalt, unempfänglich für jeden Trost.
Der Pfarrer war ein beleibter Mann mit Mehrfachkinn und üppigem graugelocktem Haar. Jessica hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Während sie sich fragte, was aus dem stets flüsternden Mr Lidgate mit seiner schwachen Lunge geworden sei, blickte sie stirnrunzelnd zu Phyllis hinüber.
»Als Seelsorger an die Front gegangen«, erwiderte Phyllis leise.
Jessica hatte nie einen Gedanken an Mr Lidgate verschwendet, aber plötzlich empfand sie seine Abwesenheit als ein klaffendes Loch, das sich in ihr aufgetan hatte. Einmal hatte Mr Lidgate am Ende seiner kaum verständlichen Fürbitten gestottert: »Herr, erhöre unser Gebet!« Worauf Theo ihr im gleichen heiseren Flüsterton des Pfarrers ins Ohr geraunt hatte: »Nicht die geringste Chance, Schätzchen.« Jetzt schloss Jessica die Augen und schlug die Arme fest um ihren Oberkörper wie ein Korsett. Als sie sich vor ein paar Jahren das Schlüsselbein gebrochen hatte, hatte sie sich das angewöhnt. Denn je weniger man sich bewegte, umso eher war es zu ertragen.
Der neue Pfarrer hob zu seiner Weihnachtspredigt an und stützte sich mit dem Ellbogen auf die Kanzelbrüstung, als wäre sie ein Kneipentresen. Wenn das Land jetzt im Krieg stehe, bedeute das nicht, dass Gott sie verlassen habe, sagte er. Dann erzählte er die Legende des »Racheengels von Mons«, der den bedrängten britischen Truppen genau in dem Augenblick erschienen sei, als sie sich verloren glaubten, und sie zum Sieg geführt habe. Erst vor wenigen Monaten sei am Himmel über Flandern ein leuchtend weißes Kreuz zu sehen gewesen, das die Soldaten auf beiden Seiten so geblendet habe, dass sie ihre Waffen niederlegten und beteten. Dies sei ein christlicher Krieg. Jesus, Gottes einzig geliebter Sohn, zu dessen Geburtsfest sie sich hier versammelt hätten, habe ihnen den Weg gezeigt, indem er sein Leben für die Menschen hingab. Nun sei es an seinem Volk auf Erden, auch ein solches Opfer zu bringen.
»Das Opfer ist traditionell das Thema von Ostern, nicht von Weihnachten«, sagte er, »aber dieser Krieg hat unsere Welt auf den Kopf gestellt und uns mit ihr. Vertrauen wir auf die Gewissheit, dass jene, die gefallen sind, dies für das Heil der Menschheit getan haben. Lasst uns nicht trauern. Lasst uns frohlocken über ihre Tapferkeit und ihren Heldenmut. Lasst uns danken für ihre Opferbereitschaft. Und an diesem Tag der Hoffnung wollen wir der Worte von Horace Annesley Vachell gedenken: ›Zu sterben, um andere vor dem Tod – oder schlimmer noch, der Schande – zu retten, zu sterben bei der Erstürmung einer Höhe; zu sterben und in das reichere Leben im Jenseits unerschütterliche Hoffnungen und Sehnsüchte mitzunehmen, Erinnerungen ohne Bitterkeit, all die Frische und Fröhlichkeit des Monats Mai – ist das nicht ein Anlass zur Freude statt zur Trauer?‹«
Da erhob sich Eleanor. Sie wehrte die Hand ihres Mannes ab, der sie zurückhalten wollte, und schob sich aus der Kirchenbank heraus. Alle Leute starrten auf sie und verfolgten sie mit ihren Blicken, während sie den Mittelgang entlang zum Ausgang schritt. Erst jetzt fiel Jessica auf, dass fast nur Frauen in der Kirche waren. Die wenigen Besucher männlichen Geschlechts waren Alte oder Kinder. Die Tür fiel krachend ins Schloss. Schweigen, dann Hüsteln und aufgeregtes Geflüster. Der dicke Pfarrer bat die Gemeinde, sich zu erheben. Als die Orgel die ersten Klänge von Nun freut euch, ihr Christen ertönen ließ, sah Jessica Phyllis an.
»Lasst sie«, sagte Sir Aubrey.
Jessica zögerte. Phyllis schüttelte den Kopf. Dann klappte sie ihr Gesangbuch zu und folgte ihrer Mutter nach draußen.
Als der Frost kaum noch strenger werden konnte und die Mittagssonne wie ein fahler Klecks am tiefen Himmel hing, kündigte Sir Aubrey seinen Töchtern den Besuch von Mrs Carey an. Mrs Carey war die frühere Mrs Grunewald, die seit dem Krieg wieder ihren Mädchennamen angenommen hatte. Auch Oskars Namen hatte sie geändert. Er schrieb sich jetzt Oscar, mit »c«, und seinen Nachnamen hatte sie in Greenwood anglisieren lassen, sodass er nun hieß wie der amerikanische Zahnarzt, der für George Washington aus den Knochen eines Nilpferds ein Gebiss angefertigt hatte. Die Geschichte von Greenwood dem Zahnarzt war eine von Theos Lieblingsgeschichten gewesen.
»Was soll das heißen, sie kommen hierher?«, fragte Jessica empört. »Das sind doch Deutsche.«
»Nein, keineswegs. Mrs Carey stammt aus Sussex.«
»Oskars Vater war ein Hunne.«
»Joachim Grunewald als ›Hunnen‹ zu bezeichnen, ist lächerlich. Er war Komponist. Ein Künstler. Er hätte den Krieg ebenso verabscheut wie jeder andere.«
»Und wenn schon. Er hätte trotzdem auf der anderen Seite gekämpft. Gegen uns.«
Sir Aubrey schwieg. Er beugte sich über seinen Teller und schnitt das Fleisch in immer kleinere Rechtecke. Das Kratzen des Messers auf dem Porzellan tat Jessica in den Zähnen weh. Auf der anderen Seite des Tisches blätterte Phyllis eine Seite ihres Buchs um, das Kinn in die hohle Hand gestützt. Ihre beharrliche Taubheit brachte Jessica in Rage. Las denn außer ihr niemand Zeitung? Hatten sie nicht die Berichte über die deutschen Soldaten in Belgien gehört, die Babys misshandelten, verstümmelten und mit dem Bajonett aufspießten? Ihr Vater betrachtete das Fleisch auf seinem Teller. Dann nahm er ein Stück auf die Gabel und hob sie zum Mund. Der Happen war klein genug, um ihn auf einmal zu schlucken, aber er kaute und kaute, den Blick auf das Tischtuch geheftet.
»Ich werde das nicht zulassen«, erklärte sie wütend. »Wie kannst du nur auf so einen Gedanken kommen? Den Feind in unser Haus lassen, unter unser Dach?«
Sir Aubrey presste die Lippen zusammen und schluckte. »Zum allerletzten Mal, Jessica, Oscar Greenwood ist kein Deutscher. Sein Vater wurde vor seiner Geburt eingebürgert. Der Junge ist genauso englisch wie du.«
»Außer dass sein Vater ein Hunne war. Und seine Mutter trägt einen Ring mit einer deutschen Gravur auf der Innenseite. Weißt du noch, Phyllis? Mrs Grunewalds Ring? Sie hat ihn einmal abgenommen und uns die Inschrift gezeigt.«
»Ihr Name ist Mrs Carey.«
»Sie trug einen deutschen Ring, weil ihr Mann ein Hunne war. Man kann das nicht ändern mit einem … einem Wisch Papier.«
»Das Gesetz besagt etwas anderes.«
»Es kümmert dich also nicht, dass Oscar deutsche Onkel und deutsche Cousins hat? Es kümmert dich nicht, dass es vielleicht einer aus Oscars Familie war, der Theo umgebracht hat?«
»Jetzt reicht es aber, Jessica!«, schrie ihr Vater und knallte das Glas so heftig auf den Tisch, dass Phyllis zusammenzuckte. Jessica biss sich in die Wange, um Ruhe zu bewahren, und zwang sich, ihrem Vater in die Augen zu sehen. Ihr Herz pochte. Sir Aubrey hatte die Hände auf dem Tisch zu Fäusten geballt, und einen schrecklichen Moment lang glaubte sie, er wolle sie schlagen. In seinen Mundwinkeln sammelte sich Speichel, am Hals prangten purpurrote Flecken. Jessica sah, wie die Härchen in seinen Nasenlöchern zitterten, während er heftig ein- und ausatmete.
Dann, als wäre ein Seil gekappt worden, wandte er plötzlich den Blick ab. Als er nach der Serviette auf seinem Schoß griff, streifte er mit der Hand seine Gabel, die zu Boden fiel. Phyllis beugte sich hinunter, hob sie auf und legte sie auf ihren eigenen Teller.
»Ich läute nach einer frischen«, sagte sie, aber Sir Aubrey schüttelte den Kopf.
»Mir reicht es«, sagte er und tupfte sich, ohne Jessica anzusehen, mit der Serviette sorgfältig den Mund ab. Dann faltete er sie, legte sie auf den Tisch und schob seinen Stuhl zurück. Schweigend lauschten sie, wie das Echo seiner Schritte auf dem Flur verklang.
»Puh«, meinte Jessica, »hat der miese Laune!«
Phyllis gab keine Antwort. Stattdessen griff sie nach der Klingel und läutete. »Du bist fertig, oder?«, fragte sie und betrachtete Jessicas kaum berührten Teller.
»Was kümmert’s dich?«, erwiderte sie und schob den Teller beiseite. Der Geruch der kalt gewordenen Soße verursachte ihr Übelkeit. Dass Phyllis einmal für sie Partei ergreifen würde, wäre zu viel erhofft, dachte sie. Sie blickte ihre Schwester finster an, aber Phyllis presste die Lippen zusammen und wandte sich wieder ihrem Buch zu.
»Du könntest mit mir reden«, sagte Jessica. »Das wäre mal eine nette Abwechslung.«
»Und du könntest etwas lesen«, erwiderte Phyllis gleichmütig. »Das wäre auch mal eine nette Abwechslung.« Als Enid hereinkam, um die Teller abzuräumen, hob Phyllis ihr Buch vom Tisch hoch, um ihr die Arbeit zu erleichtern, hörte aber dabei nicht auf zu lesen. Eleanor verabscheute es, im Speisezimmer Dienerschaft um sich zu haben; das gebe ihr das Gefühl, sagte sie, in einem Gasthaus zu sitzen. Aber sie hatte sich daran gewöhnt. Im Übrigen gab es auf Ellinghurst keine männlichen Diener mehr, seit Harold und Robert eingezogen worden waren.
»Den Kaffee hier, Miss, oder im Salon?«, fragte Enid.
»Hier bitte. Danke, Enid«, antwortete Phyllis. Enid stellte die Kanne vor sie hin und verteilte die Tassen. Vergeblich wartete Jessica darauf, dass Phyllis eingoss. Schließlich griff sie unter geräuschvollem Seufzen selbst nach der Kanne und füllte zwei Tassen. Die eine schob sie ihrer Schwester hin.
»Danke«, murmelte Phyllis geistesabwesend und las weiter. Jessica trank ihren Kaffee und erwog aufzustehen, wusste aber nicht, wohin sie gehen sollte. Sie wollte nicht allein sein. Gelangweilt fältelte sie den Saum des Tischtuchs und fragte sich, warum sich Phyllis weigerte, auch nur das geringste Interesse für Kleidung und Schminke aufzubringen. Nanny pflegte zu sagen, Phyllis’ rotes Haar sei »bemerkenswert«, ein Ausdruck, den die Leute benutzten, wenn ihnen nichts Netteres einfiel, aber Phyllis’ blasses spitzes Gesicht schrie geradezu nach ein wenig Farbe, und ihre Brust war flach wie ein Brett. Nie brachte sie auch nur die geringste Begeisterung für Feste auf, auch nicht letzten Sommer, als sie in die Gesellschaft eingeführt werden sollte. Natürlich legte da schon niemand mehr Wert auf derartige Dinge. 1915 gab es keine Ballsaison mehr, keine Debütantinnen und keine Präsentationen bei Hofe. Der Krieg hatte all das vereitelt, restlos, so wie er auch alles andere restlos vereitelt hatte.
Wieder befiel sie eine düstere Stimmung. Jessica ließ den Saum des Tischtuchs los, holte mit dem Fuß aus und trat gegen das Tischbein. Das schmerzte zwar in den Zehen, tat ihr aber irgendwie gut, deshalb fuhr sie damit fort. Bei jedem Tritt bebte der Tisch. Phyllis blickte mürrisch drein.
»Du solltest kein so finsteres Gesicht ziehen«, sagte Jessica. »Das macht hässliche Falten.«
»So etwa?« Phyllis verzog das Gesicht noch mehr. Ohne den Blick vom Buch zu wenden, griff sie nach ihrer Kaffeetasse.
»Du willst das doch wohl nicht trinken?«, sagte Jessica. »Mit dieser ekligen Haut darauf?«
Phyllis sah auf die Tasse, zog eine Grimasse und stellte sie zurück. Jessica beugte sich vor und stocherte mit dem Löffel auf der Hautschicht im Kaffee herum. »Für ein Mädchen, das angeblich so klug ist, kannst du unglaublich blöd sein.«
Phyllis stieß einen erstickten Schrei aus und ließ ihr Buch auf den Tisch fallen. »Manchmal, Jessica …« Sie streckte ihre Hände mit den Innenseiten nach oben aus. »Was stimmt nicht mit dir?«
»Was mit mir nicht stimmt? Wollte ich etwa Kaffee trinken, auf dem schon eine Haut schwimmt wie ein … wie ein Pariser? Du brauchst nicht so entsetzt zu schauen! Wenn du weniger Bücher über Paris lesen und mehr über Pariser nachdenken würdest, wärst du wahrscheinlich auch weniger trübsinnig.«
»Meinst du, ja?«
»Na, und ob.«
»Und ich dachte, mir wäre trübsinnig zumute, weil Theo tot ist. Wie blöd bist du eigentlich?«
Als sie die Tür hinter sich zuwarf, wackelten die Bilder an der Wand.
Allein am Tisch rammte Jessica ihren Löffel in die Zuckerdose und drehte ihn mehrmals, sodass braune Zuckerkristalle über das gestärkte weiße Tischtuch stoben. Für gewöhnlich war es Jessica und nicht Phyllis, die auf Ellinghurst die Türen knallen ließ. Plötzlich kamen ihr die Verse eines Gedichts von Rupert Brooke in den Sinn, das Theo nach Onkel Henrys Tod in Gallipoli Eleanor geschickt hatte, obwohl er doch früher nie etwas für Gedichte übriggehabt hatte.
Der Krieg hat keine Macht. Mein Weg bleibt wohlbehütet
von allem, was der Tod an Schmerz und Leid aufbietet,
ich stehe sicher, wo der Schutz fehlt, Männer sterben,
und stirbt mein schwacher Leib, am sichersten von allen.
Jessica ließ den Löffel klirrend zu Boden fallen und begann zu weinen.