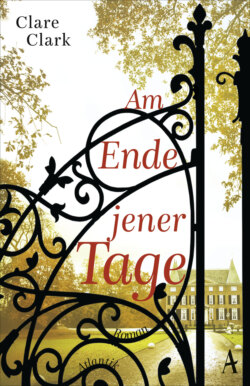Читать книгу Am Ende jener Tage - Clare Clark - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеOscar ging zum Turm. 385 Stufen führten von dessen Fuß bis hinauf zur Spitze. 385 war nicht nur eine Primzahl und die Summe dreier weiterer Primzahlen, sondern auch eine quadratische Pyramidalzahl. Das bedeutete, wenn man einhundert Kugeln zu einer quadratischen Grundfläche von zehn mal zehn anordnen und die übrigen darauf verteilen würde, reichten 385 Kugeln, um eine Pyramide ähnlich jener in Ägypten zu bauen. Sir Aubrey hatte Oscar einmal erzählt, der Turm sei ohne Gerüst errichtet worden, man habe einfach nur ein Teil auf das andere gesetzt. Wie eine Gleichung, hatte Oscar gedacht. Wenn er die 385 Stufen erklomm, wollte er jede einzelne zählen und eine Zahl nach der anderen in seinen Geist einsinken lassen wie einen Stein in einen Teich.
Am Morgen hatte der Postbote ein verschnürtes Paket aus braunem Packpapier gebracht. Es enthielt Theos Frontuniform. Patentante Eleanor hatte sie auf Theos Bett ausgebreitet, auf den frisch gewaschenen Laken. Weste und Hose blutdurchtränkt, der Mantel zerfetzt. Und alles schlammverkrustet. Oscar hatte nicht gewusst, dass Schlamm so riechen konnte. Als wäre es nicht Erde, sondern verfaultes Fleisch. Dieser intensive Gestank verschlug ihm fast den Atem, wie Nebel kroch er unter den Türen hindurch und nistete sich in den Vorhängen ein. Im oberen Stock konnte man sich kaum mehr aufhalten.
Zuerst hatte Oscar in die Bibliothek gehen wollen, wo es nach Wachspolitur und Papier roch, aber als er die Tür öffnete, sah er seine Mutter dort sitzen. Sie hatte eine Hand auf Sir Aubreys Arm gelegt, der sich vor- und zurückwiegte, immerzu nur wiegte, ohne einen Laut. Oscar stahl sich rasch wieder davon, ehe die beiden ihn bemerkten.
Die Knöpfe an Theos Uniform zierte ein Tigeremblem, das Abzeichen des Royal-Hampshire-Regiments. Alle in der Schule kannten die Regimenter der britischen Armee. Ständig redeten sie darüber, wie gern sie in den Krieg ziehen würden, wären sie nicht zu jung dafür. Sie würden den »Hunnen« eine tüchtige Abreibung verpassen, sagten sie, und irgendeiner schaute dabei immer Oscar an. Sie nannten Oscar einen Scheißdeutschen. Es spielte keine Rolle, dass er auf der Kommode neben seinem Bett ein Foto von Theo in Uniform stehen hatte. Haut dem Scheißdeutschen eins rein, rief immer irgendeiner, und reihum traten sie ihn, verpassten ihm Schläge oder boxten ihn in die Rippen. Er sei ein Spion, behaupteten sie und nahmen ihm die Taschenlampe weg, die ihm seine Mutter zum Geburtstag geschenkt hatte, angeblich weil er damit nachts den Deutschen Signale gab. Am Ende des Schultrimesters erzählte McAvoy überall herum, Oscars Vater sei als Geheimagent enttarnt und in den Tower von London gebracht worden, wo er von einem Erschießungskommando exekutiert würde.
Oscar konterte nicht damit, dass sein Vater bereits tot war. Das wussten sie ohnehin, außerdem müsste, wenn sie es absichtlich vergaßen und es offiziell Ärger geben würde, seine Mutter benachrichtigt werden. Das wollte Oscar vermeiden. Zwar sagte sie, man müsse vor nichts Angst haben, in Wahrheit aber hatte sie seit der Versenkung der Lusitania reichlich Angst. Die Zeiten, als Churchill noch gewitzelt hatte, er werde den deutschen Wein beim Abendessen in Gewahrsam nehmen, waren lange vorbei. Inzwischen galt alles, was auch nur entfernt deutsch war, als niederträchtig und abstoßend, nicht nur Wein von Rhein und Mosel, sondern auch deutsche Würste und Goethe und selbst Beethoven. In Clapham hatte man den Gemüseladen verwüstet und niedergebrannt, weil er einen deutsch klingenden Namen trug, obwohl die Besitzer Ungarn waren und das Geschäft seit mehr als fünfzig Jahren betrieben. Seine Mutter hatte den goldenen Mottoring abgelegt, den sie am Mittelfinger der rechten Hand getragen hatte. Oscars Vater hatte ihn ihr bei seinem Heiratsantrag geschenkt. Außen waren zwei ineinander verschlungene Efeublätter eingraviert und auf der Innenseite die Inschrift Du allein. Dort, wo der Ring gesessen hatte, war ihr Finger ein wenig eingekerbt, als hätte ihn das Gold abgerieben.
Als ihm seine Mutter sagte, sie werde ihre beiden Namen ändern, fügte sie hinzu, sie verstehe sehr gut, wenn er darüber traurig oder sogar wütend sei. Oscar war nur wütend, dass er nicht Carey heißen durfte wie sie selbst, sondern eine englische Form seines deutschen Familiennamens bekam. Er glaubte ihr nicht, als sie sagte, er sei der englischste Junge, den man sich denken könne, gerade weil sich sein Vater bewusst dafür entschieden hatte, Engländer zu sein. Jedes Mal, wenn Oscar für irgendeinen Gegenstand als Erstes die deutsche Bezeichnung einfiel, fröstelte er innerlich, als hätten die Jungen in der Schule recht und er wäre wirklich der Feind. Er hatte Angst, auf Deutsch zu träumen oder zu sprechen.
Schnellen Schrittes überquerte er den Rasen Richtung Wald und sog die kalte Luft ein. Statt seine Umgebung wahrzunehmen, hatte er nur das Bild seiner Patentante Eleanor beim Öffnen des Pakets vor Augen. Oscars Vater war nach London gekommen, weil sich seine Familie mit ihm überworfen hatte, aber es lebten noch etliche seiner Brüder und Schwestern in Deutschland. Vor dem Krieg hatte Tante Adeline seiner Mutter zu Weihnachten stets eine Karte geschickt. Sie hatte fünf Söhne, alle erwachsen, und Dutzende Neffen, Oscars Cousins. Er wusste, statistisch gesehen war die Möglichkeit, dass einer von ihnen Theo Melville oder die Knox-Brüder oder den ältesten Sohn von Mrs Winterson, der Freundin seiner Mutter, getötet haben könnte, verschwindend gering, trotzdem ging ihm dieser Gedanke nicht aus dem Kopf. Als er die Tür zum Turm öffnete, haftete seinen Haaren und seiner Haut noch immer der penetrante Geruch von Theos Uniform an und schnürte ihm die Kehle zu.
Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er Phyllis wahrnahm. Sie hatte sich auf der Holzbank im Gekachelten Raum zu einer Kugel zusammengerollt, die Arme um die Schienbeine geschlungen, und sah aus wie ein aus dem Nest gefallenes Küken. Neben ihr auf der Bank ein aufgeschlagenes Buch, mit der Innenseite nach unten. Als Oscar zurückwich, sah sie auf. Ihre spitze Nase war rot.
»Oh«, sagte sie, »du bist es.«
»Tut mir leid. Ich wollte nicht …«
»Schon gut.«
»Ich geh wieder.«
»Nein, bleib.«
Oscar zögerte. Phyllis schniefte und rieb sich die rotgeränderten Augen mit dem Ärmel ihres Pullovers. »Bitte bleib«, sagte sie. »Wir müssen nicht reden oder so. Es wäre nur einfach schön, ein … ein wenig Gesellschaft zu haben, verstehst du?«
Oscar nickte. Vielleicht verstand er es tatsächlich, ein wenig zumindest, dachte er. Eigentlich wollte er antworten, dass es ihm um Theo leidtue, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken. Ihm fiel ein, was seine Mutter einmal zu ihm gesagt hatte: sicher zu wissen, dass man Schuld an etwas trage, mache einem die Entschuldigung nicht unbedingt immer leichter.
Stattdessen sagte er: »Du frierst.«
Sie zuckte mit den Schultern und zog sich die Pulloverärmel über die Hände. »Ist schon in Ordnung.« Sie trug keinen Mantel. Oscar sah an sich herunter, an seinem eigenen Mantel und dem gestreiften dicken Schal. Er hatte vorher noch nie einen neuen Mantel besessen, zumindest keinen eigens für ihn gekauften, aber als er eines Tages von der Schule nach Hause gekommen war, hatte ihn seine Mutter kurz gemustert und gesagt, er sehe aus wie eine Vogelscheuche.
»Schau mal«, hatte sie gesagt und ihn vor den Spiegel geführt. »Der Mantel sitzt derart eng, dass man meinen könnte, deine Arme wären verkehrt herum.« Da hatte er gelacht, weil es tatsächlich so aussah, und sie auf den Scheitel geküsst, was auch sie zum Lachen brachte. Der Mantel gehörte zu den ausrangierten Kleidungsstücken von Theo, und wie alle seine Sachen war er von ausgesuchter Qualität. Allerdings war Oscar seit den Sommerferien sieben Zentimeter gewachsen, was abgerundet ein Wachstum um 4,286 Prozent bedeutete. In Theos Schrank gab es zwar noch einen größeren Mantel, aber sie waren trotzdem zu Arding & Hobbs gegangen und hatten einen neuen gekauft.
Als er hörte, wie Phyllis mit den Zähnen klapperte, zögerte er kurz, ehe er sagte: »Hier.« Er nahm seinen Schal ab und hielt ihn ihr hin. »Du kannst ihn haben. Also, nicht behalten … ich meine, ich möchte ihn später gern wieder zurück …«
Zu seiner Überraschung schenkte ihm Phyllis ein schiefes Lächeln. »Danke«, sagte sie. Als sie sich den Schal umlegte, dachte Oscar erneut an Theos blutverkrustete khakifarbene Uniform. In Clapham hallten die Straßen von den Marschkolonnen der Soldaten wider. Auf dem Common, dem großen Stadtpark von Clapham, hatte das Kriegsministerium neben ihrer Gemüseparzelle ein großes Areal für die Ausbildung von Offizieren in Beschlag genommen. Die Abzeichen auf den Mützen der Soldaten und ihre gewichsten, makellosen Stiefel funkelten in der Sonne.
»Ich bin sehr traurig«, sagte Oscar, den Blick auf den Boden gerichtet. »Wegen Theo, meine ich.«
»Ich weiß.«
Oscar fiel nichts ein, was er sonst noch hätte sagen können. Er wollte seine Hände in den Taschen vergraben, doch weil in der einen sein Buch steckte, nahm er es heraus und legte es auf den Tisch. Er dachte an seine letzte Begegnung mit Theo bei dessen Heimaturlaub. Patentante Eleanor war ihm nie von der Seite gewichen; wenn er in seinem Sessel saß, setzte sie sich auf die Armlehne und strich ihm mit den Fingern über die Schultern oder durchs Haar. Bei Tisch platzierte sie ihn neben sich und legte ihm die Hand auf seinen Arm. Oscar musste an Charles II. denken, der es derart leid gewesen war, dass seine von Skrofulose geplagten Untertanen zu ihm kamen, um von ihm geheilt zu werden, dass er diese Arbeit königlichen Handauflegern übertragen hatte. Wenn Patentante Eleanor andere Menschen berührte, tat sie es wie ein berufsmäßiger Handaufleger. Außer bei Theo. Ihn berührte sie auf eine Weise, als wären ihre Finger Eisenspäne, die unwiderstehlich von Theo, dem Magneten, angezogen wurden.
Phyllis griff nach seinem Buch. »Die Zeitmaschine. Ist es gut?«
»Ich weiß noch nicht. Aber der Anfang gefällt mir.«
Phyllis schlug es auf. Sie las die erste Seite und blätterte dann um. Oscar mochte es nicht, wenn andere Leute seine Sachen anfassten, sagte aber nichts.
»Diese Passage gefällt mir«, sagte sie. »Wo der Zeitreisende erklärt, es gebe keinen momentanen Würfel. Dass etwas, um existieren zu können, nicht nur Länge, Breite und Höhe haben muss, sondern auch Dauer. Es muss in der Zeit existieren. Das ist mir noch nie in den Sinn gekommen – dass die Zeit eine eigene Dimension sein könnte.«
»Der einzige Unterschied zwischen der Zeit und irgendeiner der drei Dimensionen des Raumes besteht darin, dass unser Bewusstsein sich in ihr bewegt.«
Phyllis fand die von Oscar zitierte Stelle und deutete mit dem Finger darauf. »Ja.«
»Wells hat recht«, sagte Oscar. »Raum und Zeit sollten von einem vierdimensionalen Standpunkt aus gedacht werden. Mathematisch, meine ich.«
»So etwas lernt ihr in der Schule?«
»Schön wär’s. Der Schulstoff ist nicht annähernd so interessant.«
»Und ich dachte, das wirklich Wissenswerte würde man nur den Mädchen vorenthalten.«
Oscar schwieg. Seit dem vergangenen Schultrimester hatte es der Mathematiklehrer aufgegeben, ihn zusammen mit der übrigen Klasse zu unterrichten. Stattdessen hatte er Oscar eine Bücherliste gegeben und ihn in die Bibliothek geschickt. Die meisten Bücher waren gut. Besonders gefallen hatte Oscar jenes über mathematische Gesetze, die, wie sich herausstellte, überhaupt keine Gesetze waren, zum Beispiel, dass die Winkelsumme eines Dreiecks immer exakt 180 Grad beträgt. Der Mathematiker, der bewiesen hatte, dass dies kein Gesetz war, hieß Riemann. Dieser Riemann hatte auch eine neue Geometrie erfunden und eine Hypothese über die Verteilung von Primzahlen aufgestellt, nach Ansicht von Oscars Lehrer eines der wichtigsten ungelösten Probleme der reinen Mathematik. Aber als sein Lehrer ihm ein Buch über Riemann zu lesen gab, ließ Oscar es versehentlich auf seinem Pult liegen. Bernhard Riemann war Deutscher.
»Eleanor hält dich für ein mathematisches Wunderkind«, sagte Phyllis. »Du wirst bestimmt ein Stipendium für Oxford bekommen, sagt sie.«
»Vielleicht. Das wäre schön.«
Sie starrte auf ihre Knie. »Du hast Glück. Mich würde Eleanor nicht fortgehen lassen. Sie sagt, die wirklich klugen Mädchen sind darauf bedacht, nicht allzu klug zu erscheinen. Offenbar heiraten die Männer nicht gern kluge Mädchen.«
Oscar sah überrascht drein. »Das wusste ich nicht.«
»Onkel Henry hat versucht, sie umzustimmen. Er sagte, dass … ach, ich denke, das spielt jetzt keine Rolle mehr.«
Sie schwiegen beide. Phyllis steckte die Finger in die Ärmelaufschläge ihres Pullovers und schlang die Arme um den Oberkörper, um sich zu wärmen. Ihr spitzes Gesicht war blass, unter ihren Augen lagen purpurfarbene Schatten. Sie sah sehr müde und traurig aus. Oscar wollte ihr gern etwas Nettes sagen.
»Weißt du eigentlich, dass es deinem Onkel Henry zu verdanken ist, dass Wissenschaftler nicht mehr zum Kriegsdienst eingezogen werden?«, sagte er schließlich. »Jedenfalls nicht die richtig guten.«
»Wirklich?«
»Mein Physiklehrer hat mir ein Buch gegeben. Na ja, eigentlich eine Zeitschrift. Und da war ein Artikel über deinen Onkel drin.«
»Darüber, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass Wissenschaftler nicht mehr im Krieg kämpfen dürfen?«
»Nein, das hat mir Mr Hall erzählt. Der Artikel handelte vom Melville’schen Gesetz.«
Phyllis zeigte den Anflug eines Lächelns. »Eleanor zufolge lautet das Melville’sche Gesetz, je weniger ein Melville zu tun hat, desto mehr Zeit verbringt er in seinem Arbeitszimmer und tut so als ob.«
»Das ist nicht das Melville’sche Gesetz.«
»Weiß ich. Ist bloß ein Scherz.«
»Oh«, sagte Oscar. Er starrte zu Boden. »Tut mir leid.«
»Es ist eine Schande, aber ich kenne das Melville’sche Gesetz tatsächlich nicht. Das richtige, meine ich.«
Oscar zögerte. »Soll ich es dir erklären?«
»Ja, bitte.«
»Das Melville’sche Gesetz beschreibt eine systematische mathematische Beziehung zwischen der Wellenlänge der von chemischen Elementen produzierten X-Strahlen und ihrer Kernladungszahl.«
»Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.«
»Es bedeutet, dass bis zu dem Zeitpunkt, als dein Onkel es herausgefunden hat, die Leute dachten, die Kernladungszahl wäre mehr oder weniger beliebig. Also dass sie zwar annähernd auf der Atommasse beruht, aber nicht festgelegt ist. Melville hat mit seinen Experimenten nachgewiesen, dass die Kernladungszahl eines Elements in direkter Beziehung zu dem X-Strahlenspektrum seiner Atome steht.«
»Ist das wichtig?«
»Natürlich ist das wichtig. Vor ihm wusste das ja keiner.«
»Aber spielt es denn eine Rolle? Macht es einen Unterschied, wenn man es weiß?«
Oscar runzelte die Stirn. »Wenn du meinst, was es verändern wird – da bin ich mir nicht sicher. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe, und in der Schule lernt man so was nicht. Aber etwas zu wissen, macht immer einen Unterschied, oder? Das ist doch der springende Punkt. Bei allem.«
Sie lächelte. Ihr Gesicht war kantig, aber ihre Augen blickten sanft. Sie machte nicht den Eindruck, als würde sie ihn insgeheim auslachen.
»Was hast du?«, fragte er.
»Nichts. Es ist schön, dir zuzuhören. Du redest normalerweise nicht sehr viel.«
»Meistens habe ich nichts Wichtiges zu sagen.«
»Das scheint aber die wenigsten Leute vom Reden abzuhalten.«
»Meine Mutter vermutet, es liegt daran, dass ich als Kind oft Deutsch und Englisch durcheinandergebracht und deshalb beschlossen habe, lieber überhaupt nichts zu sagen.« Das war ein alter Scherz seiner Mutter, der ihm nach langer Zeit wieder eingefallen war. Da bemerkte er Phyllis’ Blick und zuckte innerlich zusammen. »Ich spreche jetzt nicht mehr Deutsch«, platzte er heraus. »Ich konnte es sowieso nie gut.«
Phyllis erwiderte nichts. Das Schweigen schmerzte Oscar in der Kehle. »Mein Vater war deswegen immer böse auf mich«, sagte er leise. »Er hat behauptet, Deutsch sei die Sprache der Wissenschaft und der Hochkultur. Obwohl er Deutschland hasste und nicht dorthin zurückwollte. Er hat gesagt, im Vergleich zu den Deutschen seien die Engländer nur begeisterte Amateure.« Oscar ließ den Kopf hängen. »Ich bin froh, dass er tot ist.«
»Sag so was nicht«, erwiderte Phyllis streng.
»Aber es ist wahr.«
»Das ist egal. Du hast nicht das Recht, froh zu sein, dass jemand tot ist, ganz gleich, wer. Jetzt nicht mehr.«
Der Nachmittag ging in die Dämmerung über. Im grauen Licht sah Phyllis’ Gesicht sehr weiß aus. Wind kam auf. Oscar hörte ihn in der Turmspitze pfeifen und das Rauschen der wogenden Bäume. Sie schwiegen. Oscar dachte an Nanny, das Kinderfräulein, das nicht mehr im Haus wohnte, sondern in einem feuchten Cottage im Dorf, zwischen Unmengen von Federn, Steinen, fleckigen Zeichnungen und Stickmustertüchern mit zu eng gesetzten Stichen. Am Vortag hatte seine Mutter ihn zu ihr geschickt, um sie zu besuchen, und als es Zeit zum Aufbruch wurde, hatte sie geweint. Die Tränen flossen in die brüchigen Falten ihrer Wangen, und sie sagte, sie hoffe, Oscar werde den Mädchen jetzt, da Theo tot war, ein Bruder sein.
Phyllis streckte die Hand aus und legte sie Oscar auf den Arm. Ihre Fingerspitzen waren gelb vor Kälte. »Danke«, sagte sie.
»Wofür?«
»Dass du mir von Onkel Henry erzählt hast. Und dass du nicht so bist wie die meisten Jungs mit fünfzehn.«
Oscar sah auf die Hand auf seinem Ärmel. Dann legte er verlegen, wie beim Abklatsch-Spiel, seine Hand auf die ihre. »Darin bin ich gut«, sagte er.
Unten wurde krachend die Tür aufgestoßen.
»Phyllis?«, rief Jessica und stapfte geräuschvoll die flachen Stufen zum Gekachelten Raum hinauf. Schnell zog Phyllis ihre Hand weg. »Oh, tut mir leid«, sagte Jessica. »Ich störe doch hoffentlich nicht?«
»Sei nicht albern«, erwiderte Phyllis. »Was machst du überhaupt hier?«
»Dich suchen, wenn du es genau wissen willst. Du sollst ins Haus kommen. Die Männer von Theos Regiment sind hier.«
»Ich dachte, Eleanor …«
»Na ja, sie kann nicht. Will nicht. Was auch immer. Vater sagt, jetzt musst du einspringen.«
Die Schwestern sahen einander an. Schließlich nickte Phyllis. Sie stand auf und nahm Oscars Schal ab.
»Behalt ihn«, sagte er. »Du kannst ihn mir später zurückgeben.« Aber Phyllis rollte ihn zusammen und hielt ihn Oscar hin. Als er ihn ergriff, spürte er die Wärme darin wie etwas Lebendiges.
»Bleib mal kurz stehen.« Jessica bürstete mit der Hand ein wenig Laub vom Pullover ihrer Schwester. »So ist’s besser. Aber du solltest dir die Haare kämmen, bevor du reingehst. Und trag etwas Lippenstift auf. Du siehst ja schrecklich aus.«
»Herr im Himmel, Jess! Sie sind hergekommen, um zu kondolieren, und nicht zu einem idiotischen Tanztee.«
Mit verschränkten Armen beobachtete Jessica, wie Phyllis durch die Dämmerung zum Burgtor eilte. Am Rand des Rasens bellte ein weißer Hund das Gras an.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte Oscar.
»Natürlich ist verdammt noch mal alles in Ordnung mit mir«, blaffte sie. »Es wäre nur nett, wenn nicht jeder in diesem Haus seine Nöte an mir auslassen würde.«
Seit Theos Tod waren die anderen Melvilles älter geworden, grauer, geschrumpft wie abgetragene Mäntel. Nicht jedoch Jessica. Sie zog die Blicke geradezu auf sich, so frisch und strahlend sah sie aus. Selbst im trüben Licht des Gekachelten Raums schien sie zu leuchten, als trage sie den Sonnenschein in sich. Ihr honigfarbenes Haar erinnerte Oscar an die schimmernde sanfte Unterseite des Kinns seiner Mutter, als er ihr einmal eine Butterblume hingehalten hatte, um sie daran riechen zu lassen.
»Eleanor meint, es ist alles sinnlos geworden.« Sie sagte es, ohne sich umzuwenden, als spreche sie mit den Bäumen draußen vor dem Fenster. »Seit Theo tot ist. Zu deiner Mutter hat sie gesagt, die Finsternis sei wie ein Ertrinken, und sie wisse nicht mehr, wie man atmet. Deine Mutter hat erwidert, sie dürfe nicht vergessen, dass sie immer noch Phyllis und mich hat. Und Vater natürlich.« Sie lachte verhalten auf. »Das schien sie nicht sonderlich zu trösten.«
Oscar wusste nicht, was er erwidern sollte. Er blickte zu Boden. In seinem Kopf hörte er wie auf einer endlos spielenden Grammophonplatte die Worte, die seine Mutter immer sang, wenn sie ihn zu Bett schickte: Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht.
»Sie erträgt es kaum, uns anzusehen«, sagte Jessica. »Es ist, als würde die Tatsache, dass wir am Leben sind, Theos Tod noch schlimmer machen.«
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Oscar biss sich auf die Lippen, um die Melodie aus seinem Kopf zu vertreiben. Tomorrow morning, if God wills, you’ll wake up again. Er rief sich ins Gedächtnis, wie seine Mutter in der Bibliothek Sir Aubrey wie ein zerbrochenes Spielzeug in den Armen gehalten hatte.
»Sie steht immer noch unter Schock«, sagte er in seiner Hilflosigkeit. Jessica zuckte mit den Schultern und trat gegen das Bein der Fensterbank.
»Du und Phyllis, ihr habt ziemlich vertraut gewirkt«, sagte sie.
»Wir haben nur geredet.«
»Nur geredet.« Sie sah Oscar an. Dann setzte sie sich neben ihn auf die Bank. Es war schon so düster, dass er die Konturen ihres Gesichts auch aus der Nähe nur noch unscharf ausmachen konnte. Sir Crawford hatte beabsichtigt, den Turm von unten bis oben mit elektrischem Licht auszustatten, aber Trinity House, die staatliche Leuchtfeuerverwaltung, hatte es untersagt. Der Turm befinde sich zu nah an der Küstenlinie, erklärte die Behörde, Schiffe könnten ihn irrtümlich für einen Leuchtturm halten. »Ihr habt Händchen gehalten. Ich habe es gesehen.«
Oscar zwang sich, über modulare Arithmetik nachzudenken, die sein Lehrer als Uhren-Arithmetik bezeichnete, weil wie bei der Zeitangabe nach der Zwölf die Eins kam und nicht die Dreizehn. Wie bei allem, so ließ sich auch in der modularen Arithmetik besser mit Primzahlen rechnen. Jessica griff nach dem Schal auf seinem Schoß. Sie fragte nicht um Erlaubnis, sondern band ihn sich einfach um den Hals. Dann legte sie den Kopf schief und betrachtete Oscar, der sich zwang, Berechnungen anzustellen, beginnend bei eins für modulo 5. 24 = 1, 25 = 2. Er spürte, wie seine Ohren rot anliefen.
»Wolltest du sie küssen?«, fragte Jessica. »Bestimmt. Jungen wollen immer Mädchen küssen, sogar die nicht besonders hübschen. Aber ich glaube eh nicht, dass du merkst, ob jemand hübsch ist oder nicht. Selbst wenn sie aussehen würde wie Mary Pickford, würdest du, vor die Wahl gestellt, die Enzyklopädie vorziehen. Außer sie wäre aus Zahlen zusammengesetzt. Stell dir das mal vor. Ein Mädchen mit Armen aus langen Zahlenkolonnen und das lockige Haar voller quadratischer Gleichungen. Die Augen je ein Malzeichen, und ein Gleichheitszeichen für den Mund. Sieh mal an, schon bei dieser Vorstellung wirst du rot.«
Sie hatte gedacht, es würde ihr guttun, Oscar verlegen zu machen, aber das Loch in ihrem Inneren tat sich immer weiter auf wie ein großes schwarzes Maul. »Und zu jeder Mahlzeit könntest du die Kreiszahl Pi verspeisen«, fuhr sie fort. Das Wichtigste war, nicht mit dem Reden aufzuhören. »Pi und den Kreisumfang, mit dem Rechenschieber als Messer. Weißt du eigentlich, wie ungehobelt das ist? Hier zu sitzen wie ein Stockfisch und nichts zu sagen? Es ist scheißkalt hier. Wärst du ein Gentleman, würdest du mir deinen Mantel anbieten.«
»Wir sollten ins Haus zurückgehen.«
»Nein, noch nicht. Diese Männer sind noch nicht fort.«
»Woher weißt du das?«
»Wegen Jim Pughs Hund.«
Draußen auf dem Pfad zeichnete sich der Hund wie ein weißer Fleck im kurzen grauen Gras ab. Er wälzte sich herum, das Maul weit offen, als würde er lachen. Jim Pugh fuhr den Pferdewagen, der unter anderem als Bahnhofstaxi diente. Sein Hund war bei jeder Fahrt dabei, er setzte sich mit hervortretenden Augen kerzengerade auf den Wagen und ließ die Zunge heraushängen. Niemand beschwerte sich darüber, weil Jim nicht ganz dicht war. Theo hatte sie als die zwei Dorftrottel bezeichnet. Einmal gab er Jim Pugh eine Tüte Vogelsamen und machte ihm weis, wenn er sie aussäe, würden Vögel aus dem Boden sprießen.
Das Loch war jetzt kein Loch mehr, sondern eine fette schwarze Schlange, die immer dicker wurde. Jessica zupfte an den Enden von Oscars Schal und wickelte sich die Fransen um die Finger. »Du bist wohl in Phyllis verliebt?«
»Nein.«
»Das klingt, als würde mit ihr etwas nicht stimmen.«
»Nein.«
Sie überlegte, ob sie Streit mit ihm anfangen sollte, aber die Schlange in ihrem Inneren wog wie Blei. Sie machte ihr das Atmen schwer. »Denkst du manchmal darüber nach?«, fragte sie stattdessen. »Darüber, wie es wäre, im Krieg zu kämpfen?«
Oscar sah sie an. Guten Abend, gute Nacht. Die Melodie spielte weiter und weiter. »Manchmal.«
»Das ist die einzige Möglichkeit, die Leute zu überzeugen, dass du kein Deutscher bist. Indem du selbst ein paar Deutsche tötest.«
»Ich weiß.«
»Worauf wartest du dann noch?«
»Dass ich achtzehn werde.«
»Du könntest ja lügen. Viele Jungs machen das, stand in der Zeitung. Oder bist du feige?«
»Weiß nicht. Wahrscheinlich. Und du?« Er starrte Jessica wütend an. Die Schlange in ihrer Brust ringelte sich um ihr Herz und presste es zusammen. Ihr kamen fast die Tränen.
»Warum muss der Krieg so grausam sein?«, sagte sie flüsternd. Mit geschlossenen Augen rutschte sie auf der Bank näher zu ihm und lehnte den Kopf an seine Brust. Er legte nicht seinen Arm um sie. Der Garten mit seinen Bäumen und Statuen jenseits des Waldes sah unscharf aus wie ein Bild in der Zeitung.
»Es ist nicht Phyllis, die du am liebsten magst, stimmt’s, Oscar?«, fragte sie sanft.
Oscar gab keine Antwort. Am Ende des Pfads, wo das Tor in den Park führte, stand ein Mann, der eine Zigarette rauchte. Trotz des schlechten Lichts und der Entfernung war er zu sehen. Er lehnte an einer Buche und stützte mit der freien Hand den Ellbogen. Er trug Uniform, den gleichen khakifarbenen Mantel und die Stiefelhosen, die Oscar auf dem Bett hatte liegen sehen, nur dass seine Kleidung sauber und gebügelt war. Beim Ausatmen zeichnete der Rauch einen Streifen in die Luft.
Jim Pughs Hund hörte auf, sich im Gras zu wälzen. Er rappelte sich hoch, stellte die Nackenhaare auf und bellte den Soldaten wütend an. Theo Melville drehte sich nicht um. Er ließ den Zigarettenstummel fallen und trat ihn mit dem Stiefelabsatz aus. Dann ging er langsam davon, bis er außer Sichtweite war. Oscar atmete tief aus.
Jessica wandte den Kopf und sah zu ihm hoch. »Was ist?«
»Ich … ich bin mir nicht sicher.«
Im Dämmerlicht hatten ihre Augen die Farbe neuer Penny-Münzen. Verwirrt blinzelnd sah er sie an. Ihm war, als sei er irgendwie aus seinem Körper herausgetreten und wisse nicht mehr, wie er wieder hineingelangen könne. Sie hob die Arme und legte sie um seinen Nacken. »Küss mich«, sagte sie.
Küss mich. Zwei Wörter, ein einziger fester Punkt in einer wirbelnden See aus leuchtendem Staub. Benommen blickte Oscar sie an, ihre leicht geöffneten, geschwungenen Lippen, ihre geschlossenen Augen mit den dichten, gebogenen Wimpern. Sie sah aus wie ein Filmstar.
»Nun?«, sagte sie ungeduldig.
Er schloss fest die Augen und presste seine Lippen auf ihre.