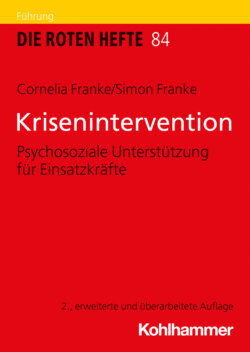Читать книгу Krisenintervention - Cornelia Franke - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5 Stresskaskade
ОглавлениеDie Reaktion des Organismus auf eine mögliche Gefährdung durchläuft die Stresskaskade. Diese besteht aus mehreren, jeweils eskalierenden Stufen. Ob alle Stufen der Kaskade durchlaufen werden, ist abhängig von der Schwere der Bedrohung, den eigenen Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr und früheren Erfahrungen. Da jeder die Gefahr individuell beurteilt, kann es sein, dass unterschiedliche Menschen in der selben Situation verschieden reagieren. Die Stresskaskade gliedert sich nach Schauer, Neuner und Elbert (2011) in folgende Stufen:
Stufe 1 – Freeze: Wenn genügend Zeit ist, durchläuft der Organismus eine kurze Orientierungsphase. Er erstarrt und die Aufmerksamkeit wird auf die Gefahrenquelle gerichtet. Diese Phase wird genutzt, um die Gefahr abzuschätzen und die erforderliche Reaktion vorzubereiten.
Stufe 2 und 3 – Flight und Fight: Wird die erkannte Gefahr als starke Bedrohung wahrgenommen, wird das Verteidigungssystem über den Sympathikus aktiviert (siehe Tabelle 2). Die teilweise als unangenehm empfundenen Sympathikusreaktionen dienen dazu, alle Energiereserven des Körpers zu mobilisieren und den Organismus zu Höchstleistungen bei Flucht oder Kampf zu befähigen. [20]Nicht benötigte Körperfunktionen (z. B. Verdauung) werden verringert, Blase und Darm können sich unwillkürlich entleeren. Auch wenn das den Menschen (aus heutiger Sicht) in eine peinliche Situation bringen kann, geht es dem AVS lediglich ums Überleben durch Vorteile bei der Flucht.
Ob der Organismus versucht zu fliehen oder zu kämpfen, entscheidet das AVS selbständig. Wenn die Flucht möglich erscheint, ist diese meist risikoärmer als der Kampf und wird deshalb häufig gewählt. Ist die Entscheidung für eine Reaktion gefallen, läuft das entsprechende Programm solange ab, bis das AVS entscheidet, dass die akute Gefahr gebannt ist. Allerdings kann das AVS auch in kürzester Zeit seine Entscheidung zwischen Flucht und Kampf revidieren, etwa wenn eine Flucht unmöglich erscheint. Dieses Verhalten kann zu scheinbar widersinnigen Handlungen führen und Betroffene können sich und andere dadurch in Gefahr bringen.
Auch Einsatzkräfte können auf unvorhergesehene Ereignisse wie Explosionen oder Einstürze entsprechend reagieren. Häufig sind bei ihnen Schuld- oder Schamgefühle zu beobachten, wenn sie in solch einer Situation weglaufen und womöglich Kameraden zurücklassen. Allerdings handelt es sich dabei um eine normale Reaktion des AVS, welches intuitiv auf eine unnormale Situation reagiert. Diese Reaktion lässt sich nicht durch die Einsatzkraft beeinflussen.
Stufe 4 – Fright (Totstellen): Wenn die akute Gefahr nicht durch Kampf oder Flucht abgewendet werden kann und der Betroffene keine Möglichkeit mehr sieht, auf das Geschehen einzuwirken, schal[21]tet der Organismus von aktiver Verteidigung auf Immobilität um. Dieses Totstellen ist auch in der Tierwelt verbreitet und hat den Hintergrund, dass scheinbar tote Tiere seltener gejagt und gefressen werden. Aufgrund der scheinbaren Hilf- und Ausweglosigkeit wird diese Situation als besonders bedrohlich erlebt und bildet den Höhepunkt des Angstempfindens.
Dieser Totstellreflex bildet einen Wendepunkt in der Stresskaskade. In den Phasen der aktiven Verteidigung dominierte der Sympathikus, beim Totstellen übernimmt der Parasympathikus (»Ruhenerv«) als sein Gegenspieler. Die Auswirkungen des Parasympathikus sind konträr zu denen des Sympathikus. Die Herzfrequenz und der Blutdruck verringern sich, die Atmung wird langsamer und flacher und der Verdauungsprozess beginnt. Im Normalfall ist der Parasympathikus der Ruhenerv und wird menschheitsgeschichtlich dann verstärkt aktiv, wenn die Beute gejagt ist und verdaut werden muss und keine Bedrohung herrscht. Im Rahmen der Verteidigung bildet das Totstellen also einen Wendepunkt, das AVS sieht keine Möglichkeit mehr, die Gefahr durch Kampf oder Flucht abzuwenden.
Stufe 5 und 6 – Flag and Faint (Erschlaffen und Ohnmacht): Der Organismus erschlafft, Bewegungen werden langsamer und schwieriger bis zur Bewegungsunfähigkeit, das Schmerzempfinden lässt bis zur Schmerzunempfindlichkeit nach. Zunächst werden noch Signale vom Körper ins Gehirn geleitet aber keine Signale und Befehle mehr [22]vom Gehirn in den Körper. Die Fähigkeit der Sprachwahrnehmung und -produktion lassen bis zur Sprachunfähigkeit nach.
Die Reaktionen des Parasympathikus werden stärker, es kommt also zu einer weiteren Verringerung der Herzfrequenz und des Blutdruckes. Zunächst wirken die Betroffenen noch wach und aufmerksam, sind aber nur noch bedingt ansprechbar. Im Verlauf kann es zur Bewusstlosigkeit kommen. In dieser Phase des »Shutdowns« werden Gefühle wie Wut, Angst und Schmerzen nicht mehr empfunden. Diese Gefühlstaubheit führt dazu, dass sich der Organismus nicht mehr wehrt und keine weiteren Fluchtversuche unternimmt. Außerdem entsteht für den Betroffenen das Gefühl, das Geschehen wie durch Nebel, Watte oder eine Milchglasscheibe zu erleben. Der Bezug zur Realität wird konfus, ein Gefühl der Unwirklichkeit entsteht. Wenn im Verlauf der Reaktion keine Signale mehr vom Körper ins Gehirn geleitet werden, haben viele Menschen das Gefühl, nicht mehr in ihrem Körper zu sein und sich selbst von außerhalb zu beobachten. Diesen Zustand nennt man Dissoziation (Schauer, Neuner und Elbert 2011).
Einsatzkräfte werden im Einsatzgeschehen in der Regel nicht von einer Shutdown-Reaktion betroffen, solange sie nicht selbst Opfer eines Unglückes (z. B. verschüttet) werden. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass Einsatzkräfte nach einem Kontrollverlust häufig unter starken Belastungsreaktionen leiden. Solch ein Kontrollverlust kann dadurch entstehen, dass Einsatzkräfte ihrer Tätigkeit nicht nachkommen können. Etwa wenn bei einem Zugunglück die Strecke noch nicht freigegeben wurde. Auch berichten Einsatzkräfte, die während des [23]Einsatzes handlungsfähig geblieben sind, also keine Shutdown-Reaktion erlebt haben, von Wahrnehmungseinschränkungen (»Ich habe gar nicht gemerkt wie die Zeit vergangen ist, wie heiß/kalt es war, wie viele Menschen herumgestanden haben«), Sprachunfähigkeit (»Ich hatte keine Worte mehr«), Gefühlslosigkeit oder einem Gefühl der Unwirklichkeit. Diese Empfindungen können auch nach dem Einsatz eine Zeitlang bestehen bleiben. Bei diesen Reaktionen handelt es sich um Schutzmaßnahmen, um die Psyche vor Überflutung mit Emotionen zu schützen. Zeigen Einsatzkräfte solche Reaktionen, deutet das auf eine hohe psychische Belastung im Einsatz hin und sollte bei den Regenerationsbemühungen berücksichtigt werden.
Abwendung der Gefahr
Wenn die Gefahr abgewendet wurde, werden die Mechanismen des AVS beendet und der Betroffene kann seine Handlungen wieder bewusster steuern. Häufig wird nach dem erfolgreichen Bestehen einer solchen Situation Erleichterung, Freude und Stolz empfunden. Außerdem kann das Selbstbewusstsein gestärkt werden und der Drang nach Herausforderungen steigt. Das Verhalten, das zur Abwendung der Gefahr geführt hat, wird gespeichert. Dadurch lernt der Mensch, in Zukunft auf ähnliche Situationen vergleichbar reagieren zu können. So können sich Routinen ausbilden, die in zukünftigen vergleichbaren Situationen dafür sorgen können, dass diese nicht als Bedrohung wahrgenommen werden und das AVS nicht die Kontrolle übernimmt. Dadurch wird es möglich, zielgerichtet und bewusst, statt instinktiv zu handeln. Deshalb wird Neues auch am besten gelernt und [24]behalten, wenn es eine (emotionale) Relevanz hat und hilft, schwierige Situationen zu bestehen.
Bild 1: Das AVS als einfaches Modell