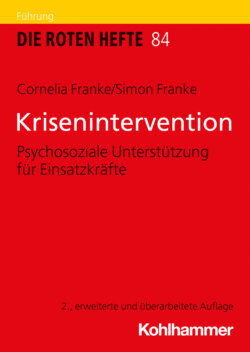Читать книгу Krisenintervention - Cornelia Franke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Reaktion auf Bedrohung
ОглавлениеVon unseren Sinnen werden jede Sekunde Millionen von Reizen aufgenommen oder im Inneren unseres Körpers registriert und an unser Gehirn weitergeleitet. Dort werden die eingehenden Informationen nach den folgenden Kriterien klassifiziert: gefährlich/ungefährlich, bekannt/unbekannt, relevant/irrelevant.
Die für das Individuum scheinbar irrelevanten Informationen erreichen gar nicht erst das eigentliche Bewusstsein, sie werden aussortiert. Die übrigen, als relevant eingestuften Informationen werden danach sortiert, ob sie eine Gefahr signalisieren könnten, also bedrohlich wirken, oder ungefährlich zu sein scheinen. Die scheinbar nicht bedrohlichen (aber dennoch relevanten) Informationen werden an die zuständigen Hirnareale weitergeleitet und dort entsprechend verarbeitet. Sie können unter anderem Handlungen, Gedanken und [14]Gefühle auslösen und treten teilweise ins eigentliche Bewusstsein ein.
Bei Reizen, die als bedrohlich eingestuft werden, wird das Alarm- und Verteidigungssystem aktiv. Das AVS reagiert bereits niederschwellig auf unerwartete Vorkommnisse und eine große Bandbreite an Ereignissen:
Existenzbedrohliche Rahmenbedingungen: Gefährdung des eigenen Hab und Gutes, beispielsweise Geld, Behausung oder Lebensort.
Gefährdung der Bindung an die Gruppe: Obwohl heutzutage der Ausschluss aus einer Gruppe als soziales Gefüge selten den sicheren Tod bedeutet, ist diese Angst menschheitsgeschichtlich durchaus nachvollziehbar. Die Angst ist breit gefächert und kann bereits bei Konflikten mit Familienangehörigen, Freunden, Kollegen und Nachbarn beginnen und reicht bis zum Verlust von Bezugspersonen. Aber auch die Bedrohung des Selbstbildes innerhalb einer Gruppe lässt sich in diese Kategorie einordnen. Dazu gehören peinliche Situationen, Blamagen und (scheinbarer) Gesichtsverlust, etwa durch erlebte Kritik. Aber auch der Verlust von Statussymbolen, deren Bedeutung über den reinen materiellen Wert hinaus geht, kann zum Erleben von Bedrohung führen.
Gefährdung der körperlichen Integrität: Hunger und Durst, Verletzung, Krankheit, Tod, (sexuelle) Gewalt.
[15]Die Gefahr muss dabei nicht einmal zwangsläufig das Individuum direkt betreffen. Häufig reicht es aus, wenn umstehende Personen bedroht sind, um eine Reaktion des AVS hervorzurufen. Das lässt sich nicht mit Mitgefühl erklären, sondern durch reinen Überlebenswillen: Eine Gefahr für andere könnte in Zukunft mich selbst betreffen oder meine Bezugsgruppe schwächen. Da das AVS unter Zeitdruck auf eine Gefahr reagieren muss, kann keine vollständige Lagebeurteilung durchgeführt werden. Deshalb reagiert das AVS auch auf Situationen, in denen keine reelle Gefahr besteht, sondern lediglich angenommen wird. Da dieselbe Situation von verschiedenen Menschen unterschiedlich eingeschätzt werden kann, können diese auch unterschiedlich reagieren.
Selbst der Gedanke an eine Bedrohung kann bereits eine Reaktion des AVS auslösen. Denkt man in einer ruhigen Situation beispielsweise an einen gravierenden Unfall, kann das zu Stressempfinden führen. Aber auch Reize, die eigentlich als neutral eingestuft werden, können durch Erinnerungen an belastende Einsätze Stressreaktionen auslösen. Dazu können beispielsweise bestimmte Gerüche oder Geräusche gehören. Das AVS wird also immer aktiv, wenn es eine Bedrohung wahrnimmt. Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick über mögliche Situationen:
Tabelle 1: Potenziell bedrohliche Situationen
| Alltagssituationen | Geldsorgen, Konflikte, Prüfungen, Stress im Job, Probleme mit der Familie, neue und unerwartete Reize |
| Außergewöhnliche Belastungen | Mobbing, Verlust des Jobs, eigene schwere Krankheit Konfrontation mit Unglücken, Krankheit, Verletzung, Tod, soziales Elend |
| Extremereignisse | Unfall- oder Gewaltopfer sein, lebensbedrohliche Erkrankung, Eigenheimverlust durch Feuer, Miterleben von Großschadenlage, MANV, Naturkatastrophe, Amok- oder Terrorlagen |
Wirklich beachtenswert ist, dass das Miterleben viele dieser Situationen für Einsatzkräfte einen normalen Arbeitsalltag darstellt. Die meisten werden täglich mit Unfall und Krankheit, Tod und sozialem Elend konfrontiert und erleben, zumindest gelegentlich, besondere Schadenlagen. Trotzdem reagiert ihr AVS auf all diese Bedrohungen in gewöhnlichem Ausmaß. Das Problem hierbei ist, dass das AVS als Notfallprogramm ausgelegt ist. Wenn es zu häufig aktiv ist und dazwischen zu wenige Ruhephasen hat, kann das zu schwerwiegenden psychischen und körperlichen Folgen führen. Auf diese Problematik wird in den nächsten Kapiteln noch verstärkt eingegangen (Hüther 2018, Roth und Strüber 2018).