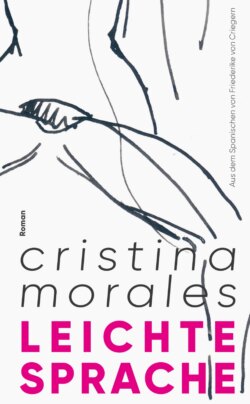Читать книгу Leichte Sprache - Cristina Morales - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAteneo – Autonomes Zentrum Sants.
Sitzungsprotokoll der Okupa-Gruppe. 25. Juni 2018
Aus dem Inventar leerstehenden Wohnraums, der für Hausbesetzungen geeignet ist, bittet die Kameradin Gari Garay die Versammlung um Hilfe bei der Überprüfung der Wohnung in der Calle Duero Nr. 25 und jener in der Calle Viladecavalls sowie des Hauses in der Passage Mosén Torner. Sie benennt ausdrücklich die Hausnummer, die sie in der Calle Duero interessiere, da es – wie die Kameradin erklärt – in dieser Straße mehrere infrage kommende Häuser gebe, und sie betont, dass sie abgesehen von diesem einen Mal die Hausnummern immer und auch während eines jeden Gesprächs geheim gehalten habe.
Die Kameradin Mallorca weist sie darauf hin, dass eine Wohnung zu überprüfen und hineinzugehen, um sie zu okupieren, im Prinzip das Gleiche sei, außer wenn die Wohnung sich in einem so schlechten Zustand befinde, dass sie nicht mehr infrage komme. Das sei so, fährt die Kameradin Mallorca fort, weil das Öffnen einer Wohnung sehr kompliziert und zeit- und planungsaufwändig sei und viele Kameradinnen involviere, weshalb es nicht umsetzbar sei, zunächst verschiedene Wohnungen zu prüfen, um dann eine auszusuchen.
Badajoz stimmt zu und empfiehlt der Kameradin, die besetzen will, sich die Wohnblöcke von außen genau anzuschauen, um deren Zustand einzuschätzen, und zu versuchen, in den Eingangsbereich zu gelangen, zum Beispiel indem sie sich als eine Anwohnerin oder eine Austrägerin von Werbeblättern ausgibt, und dort zu schauen, wie das Treppenhaus oder der Aufzug sind, falls es einen gibt. Badajoz bietet G. G. an, sie zu begleiten und die Immobilien von außen zu inspizieren, und ergänzt schließlich, dass Diskretion bei Okupationen unbedingt vonnöten sei, dass aber unter uns, ob nun während einer Sitzung oder außerhalb, die Hausnummern ruhig genannt werden dürfen.
Murcia bietet an, sie zu begleiten, und fügt hinzu, das Haus in der Mosén Torner sei völlig heruntergekommen und es sei nicht nachzuvollziehen, wie es auf die Inventarliste habe kommen können, wenn doch auf den ersten Blick zu erkennen sei, dass das Dach halb eingestürzt ist.
Coruña entgegnet, man habe alle leerstehenden Wohnungen des Bezirks auf die Inventarliste setzen müssen, wogegen Murcia einwendet, nicht nur die leerstehenden, sondern die auch zur Besetzung geeigneten, worauf Coruña antwortet, dass das Haus in der Mosén Torner absolut zur Besetzung geeignet sei, tatsächlich sei es sogar leichter zu besetzen als viele andere im Bezirk, gerade weil es heruntergekommen und aufgegeben sei, weshalb es gewiss viel länger dauern würde, bis die Besetzung entdeckt und beendet würde. Murcia sagt ihm, es sei kaum zu glauben, dass er schon sein halbes Leben Okupa sei, wenn er immer noch nicht begriffen habe, dass die Räumung eines besetzten Hauses nicht von dessen Zustand abhänge, sondern vielmehr von der städtebaulichen Spekulation, von der die Eigentümer abhängen. Aber es sei noch etwas anderes, fährt Murcia fort, Besetzen sei nicht nur öffnen und reingehen, sondern öffnen, reingehen und in Würde leben, und dafür gebe es diese Versammlung, darum nenne sich das selbstverwalteter Raum, darum verteidige und ermögliche sie die Selbstverwaltung anderer Räume wie eben die Okupas, die besetzten Häuser, worauf Coruña antwortet, dass vielleicht etwas, was für die einen unwürdig, für andere würdig sei und dass vielleicht auch die Würde unter das Prinzip der Selbstverwaltung fallen solle, in dem Sinne, dass jemensch andere Bedürfnisse habe und diese auf unterschiedliche Weise befriedige, denn so brauche zum Beispiel eine fünfköpfige Familie für ein würdevolles Leben eine Wohnung mit mindestens zwei Schlafzimmern, was schon beengt sei, während einer einzelnen Person ein Mansardenzimmer oder eine Einraumwohnung völlig ausreichen könne, um in Würde zu leben.
Oder auch nicht, sagt Ceuta, auch eine einzelne Person könne wegen ihrer besonderen Bedürfnisse drei Schlafzimmer und einen Innenhof brauchen.
Oder einfach aus einer Laune heraus, sagt Tarragona, und Launen seien nicht verkehrt, und wir sind nicht hier, um die Bedürfnisse oder Gründe oder Schrullen von irgendjemandem zu beurteilen.
Murcia sagt, dass wir sehr wohl da seien, um die Bedürfnisse von jemandem zu beurteilen, denn wenn jetzt ein Neonazi käme, der erzählt, er wolle für seine Neonazitreffen ein Haus besetzen, dann werfen wir den doch hochkant hier raus, oder etwa nicht?
Coruña antwortet, dass der eventuelle lebensmüde Neonazi, der sich hypothetisch trauen würde, einen Fuß ins Autonome Zentrum zu setzen, sich niemals als solcher zu erkennen gäbe, und er fragt Murcia, ob wir jetzt vielleicht jede Person, die durch diese Tür kommt, fragen müssten, ob sie Neonazi sei, und was mensch mit dem Haus vorhabe, das mensch mit unserer Hilfe besetzen will.
Oviedo mischt sich ein, um zu sagen, dass nach diesem Dreisatz folglich auch alle Männer, die in das Besetzungsbüro kämen, gefragt werden müssten, ob sie vorhaben, ihre Freundinnen hinter verschlossenen besetzten Türen zu misshandeln, und ergänzt, dass diese Diskussion zwar interessant sei, wir sie aber von der postmodernen Banalität her angingen, wenn wir derart die Bedürfnisse und die Würde der Menschen relativierten, denn zufällig sei es so, dass sogar der Neonazi und der misshandelnde Partner ein Haus brauchen, bei dem nicht das Dach einstürzt, um in Würde zu leben, und in diesem Punkt wären wir wohl sogar mit den Neonazis und misshandelnden Partnern einer Meinung, und Oviedo fragt sich, ob wir uns dann nicht auch untereinander einigen könnten.
Murcia versteht nicht ganz, ob die Meinungsäußerung der Kameradin, die zuletzt das Wort hatte, eine für oder gegen die Entfernung des Hauses in der Mosén Torner aus der Inventarliste besetzbarer Häuser gewesen ist.
Dafür, ganz eindeutig, antwortet Oviedo, aber Murcia hat es noch immer nicht ganz verstanden und fragt, ob sie für das Haus als mögliche Okupa oder für die Entfernung des Hauses als mögliche Okupa sei, und diese Frage verursacht viele durcheinandergehende und gleichzeitig geäußerte Antworten, die nicht im Protokoll aufgeführt werden.
Als nach einigen Sekunden die übliche Ordnung von Redebeitrag und Zuhören wieder hergestellt ist, sagt G. G., dass sie nicht sicher sei, ob sie es richtig verstanden habe, aber sie meine gehört zu haben, dass diese Versammlung die Selbstvertretung verteidige, worauf zahlreiche Kameradinnen antworten, dass sie das sehr richtig verstanden habe und wir ein selbstverwalteter Raum seien, der natürlich für die Selbstverwaltung einstehe. G. G. ergreift erneut das Wort und fragt, ob wir also eine Selbstvertretungsgruppe seien, worauf Coruña antwortet, dass wir dieses Wort nicht benutzten, dass es aber wohl logisch erscheine, oder jedenfalls grammatisch logisch, dass wir, wenn wir uns als Gruppe selbst vertreten, auch eine Selbstvertretungsgruppe seien. Badajoz meint, dass ihr dieses Wort nicht gefalle, weil es nach Bürokratie und Betriebswirtschaft klinge, und dass sie sich nicht Selbstvertreterin nennen würde, sondern schlicht und einfach Anarchistin, denn wenn man Anarchistin sage, dann sage man auch, dass man seine Konflikte und Wünsche selbst vertrete, ohne Teil des neoliberalen institutionellen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Kreislaufes zu sein, der unser ganzes Leben verwalte, und zwar mit Gewalt.
Ceuta schlägt G. G. vor, und zwar gerade weil er an die Selbstvertretung glaube und total dahinterstehe, dass wir uns alle selbstvertreten sollten, und weil G. G. selbst aus irgendwelchen Gründen als Erste auf das Haus in der Mosén Torner aufmerksam geworden sei, darum also sagt dieser Kamerad, dass sie selbst entscheiden solle, ob sich die Mühe lohne, dieses Haus zu öffnen oder lieber eins, das besser aussehe.
G. G. stimmt zu und der zuvor genannte Kamerad sagt, dass sie sich nicht gleich entscheiden müsse, auch nicht morgen oder nächste Woche, dass sie die Immobilien ganz in Ruhe von außen inspizieren und gut darüber nachdenken könne, welche sie wolle, und wann immer es ihr passe, könne sie dann vorbeikommen und der Versammlung ihre Entscheidung mitteilen.
G. G. bedankt sich für das Entgegenkommen und den Rat, sagt aber, dass sie schon jetzt damit einverstanden sei, das Haus in der Mosén Torner zu öffnen, da sie weder Zeit noch Ruhe habe, um viel nachzudenken, denn ihre aktuelle Wohnsituation sei kritisch, und darum habe sie, während sie den verschiedenen Kameraden gut zugehört und verstanden habe, dass Besetzen schwierig sei, aber bei diesem Haus nicht ganz so, ihre Entscheidung getroffen.
Mehrere Kameraden erinnern daran, dass das Haus sich in einem wirklich schlechten Zustand befinde, aber wenn sie sich sicher sei, dann nur zu.
Andere Kameraden warnen noch einmal, dass das Haus in einem so schlechten Zustand sei, dass G. G. – wenn sie die Besetzung in Angriff nehmen – schon beim Betreten des Hauses merken werde, was für eine Ruine das sei, und es bereuen werde, eine so übereilte Entscheidung getroffen zu haben.
Tanger sagt, dass zuvor gesagt wurde, Besetzen sei nicht einfach nur öffnen und reingehen, sondern öffnen, reingehen und in Würde leben; wozu er ergänzen wolle, dass Besetzen nicht nur öffnen, reingehen und in Würde leben sei, sondern öffnen, reingehen, in Würde leben und alle Reparaturen vornehmen, die nötig seien, denn man werde kaum in Würde leben, wenn man sich zum Schlafen in einer Ecke zusammenrollen und Schutz vor Wind und Regen suchen müsse, oder wenn man in einen Eimer scheißen müsse oder nicht einmal morgens Kaffee kochen könne, und er fragt G. G., ob sie sich stark genug fühle, das zu tun, also selbstverwaltet all diese Reparaturen vorzunehmen, zumal sie ja alleine leben möchte.
Palma wendet ein, vor hundert Jahren hätten alle noch in Eimer gekackt, oder genauer gesagt in Nachttöpfe, und dass man daran nicht die Würde einer Person festmachen könne. Es sei auch keine Frage der Würde, ob man einen Kaffee zum Frühstück habe statt beispielsweise ein Croissant und einen Orangensaft, für deren Zubereitung man weder Gas noch Strom brauche, falls sich Tanger auf das Fehlen von Gas oder Strom bezogen haben sollte, als er die Würde des Kaffees anführte.
Vorausgesetzt, man habe das Croissant in einer Bäckerei gekauft oder es geklaut oder im Müll gefunden, antwortet Tanger.
Natürlich, entgegnet Palma, denn ich gehe mal davon aus, dass wir normalerweise keine Croissants bei uns zu Hause backen, wofür man dann Gas oder Strom brauchte.
Oder auch nicht, denn es gebe ja auch Holzöfen, erwidert Tanger, und er fragt, ob die Versammlung es für wahrscheinlich halte, dass das Haus in der Mosén Torner einen Holzofen habe, in dem man zum Frühstück Croissants backen könne.
Ceuta sagt, dass es vielleicht einen Kamin gebe, weil es ein sehr altes Haus sei.
Tanger sagt, das mit dem Kaffee oder in den Eimer scheißen habe Schwung in die Diskussion gebracht, was ihn freue, aber wir hätten trotzdem noch nichts dazu gesagt, wie es darum stehe, wegen der Kälte und des Regens zusammengerollt in einer Ecke schlafen zu müssen, also nehme er an, dass wir darin durchaus eine Frage der Würde sähen und genau darum gehe es im Haus in der Mosén Torner, da es eben ein halb eingestürztes Dach habe.
Oviedo antwortet, dass sie persönlich nicht in einen Eimer, sondern auf die Würde scheiße, und wenn nicht auf die Würde, deren Bedeutung ihr nicht ganz klar sei, dann auf unseren Gebrauch des Ausdrucks »in Würde leben«, der für sie journalistisch und institutionell klinge, also zutiefst kapitalistisch, denn er beziehe sich nur auf die materiellen Bedingungen des Lebens und gehe davon aus, dass jemensch, der schön warm eingekuschelt schlafe, mit mehr Würde lebe als jemensch unter freiem Himmel. Dieser Logik folgend, fährt die Kameradin fort, lebe ein Mensch mit Viskomatratze würdevoller als jemensch mit einer Federkernmatratze, und wer am Hafen Meeresfrüchte zu Mittag esse, habe mehr Würde als jemensch mit Kichererbseneintopf an einem Tisch mit Kohlebecken, oder wer, noch schlimmer, bei McDonald’s oder sogar überhaupt nicht zu Mittag esse!
Tanger antwortet, sie würde die Argumentation ad absurdum führen und dass sie die Annehmlichkeiten der Bourgeoisie mit Grundbedürfnissen verwechsle, und natürlich gebe es auch materielle Grundbedürfnisse, die ja die ebenfalls aus Materie bestehenden Menschen schlicht und einfach zum Überleben sichern müssen; woraufhin die Kameradin einwirft, dass sie in der Tat einen apagogischen Beweis angeführt habe, weil die Argumente ad absurdum geführt werden müssten, um dadurch ihre Fehlbarkeit zu beweisen, also die Last der Vernunft, also ihre Wahrheit, und diese Argumentation über das Leben in Würde halte dem Stoß nicht stand. Und sie fügt an, dass sie die reductio ad absurdum ganz bewusst angewendet habe, dass aber der erste Kamerad, ohne es zu merken, zwei kleinste gemeinsame Nenner gekürzt habe, also zwei Analogien, diese Mütter der Demagogie, indem er – erstens – die materiellen Bedürfnisse von Menschen mit den Menschen selbst gleichgesetzt und – zweitens – den bourgeoisen Materialismus, auf den sie sich zuvor bezogen habe, mit dem Fleisch und Blut, den Knochen und Nerven gleichgesetzt habe, aus denen wir alle bestehen.
Mallorca bittet die Kameradin, die zuletzt gesprochen hat, dies ein wenig genauer zu erklären, eine Forderung, der sich mehrere andere Kameraden anschließen und der Oviedo nachkommt, und zwar, wie sie selbst sagt, sehr gern. Die von Tanger vorgebrachten Analogien seien in argumentativer Hinsicht trügerisch und in ideologischer Hinsicht tendenziös im Sinne einer kapitalistischen Rechtfertigung. Das sei so, weil der Kamerad Würde und materiellen Besitz miteinander in Verbindung setze, womit er den Diskurs des Wohlfahrtsstaates reproduziere, der Würde sage, wo er Wohlstand meine. Und was denn Wohlstand sei?, fragt die Kameradin oder fragt sie vielmehr sich selbst, und sie erklärt, dass sie sich auf den Wohlstand im Wohlfahrtsstaat beziehe, der eigentlich ein Wohlstandsstaat sei. Sie glaube nämlich, dass es das Konzept des Wohlstands nicht gegeben habe, bevor es die westlichen Staaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfunden hätten, und wenn es das schon gegeben habe, dann nicht mit der Konnotation, die ihm diese Staaten ein für alle Mal gegeben hätten. Die Wohlfahrt oder der Wohlstand der Nachkriegszeit würden also als der notwendige Mechanismus ausgestaltet, um im zerstörten Europa die Wirtschaft wieder auferstehen zu lassen, und in den Vereinigten Staaten zum Ruhme des Kapitalismus. Arbeitslosengeld, Krankenversicherung, Sonderzahlungen, bezahlter Urlaub, Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate, subventionierte Industrie, Verbilligung vormaliger Luxusgüter, Ausweitung der öffentlichen Schulen und Universitäten. Die Kameradin sagt, wenn sie von der keynesianischen Konsumfunktion spreche und der Geburt des Konsumismus, entdecke sie nicht den Stein der Weisen neu, und sie fragt, dieses Mal offen in die Runde und nicht sich selbst, ob uns interessiere, was sie erzählt, oder ob wir besser wieder über das Dach des Hauses in der Mosén Torner sprechen sollten, damit wir nicht – und die Kameradin bittet den Scherz zu erlauben, der ihr zufolge sehr passend sei – das Haus vom Dach aufzäumen, indem wir vom blöden Keynes reden, wenn wir uns doch eigentlich fragen sollten, wo wir eine Betonmischmaschine herbekämen.
Coruña antwortet, dass das für ihn durchaus wie die Entdeckung des Steins der Weisen sei, und Ceuta sagt, er würde nicht zwischen Reflexion und Aktion unterscheiden, denn die Aktion, in diesem Falle die Okupation eines verfallenen Hauses, müsse stets von Motiven geleitet sein, und diese seien für uns die Etablierung der anarchistischen Gesellschaft. Andernfalls handele es sich um eine unpolitische Aktion, oder zumindest nicht im radikalen Sinne politisch, und wenn unpolitisch, dann auch harmlos und verwundbar durch die Attacken der Unterdrücker, Attacken, die in diesem Falle von eventuellen Eigentümern ausgehen könnten, die wieder in den Vollbesitz des Hauses gelangen wollten, oder vom Richter, der den Rauswurf der Besetzer anordnet, oder von den Mossos d’Esquadra, den Zivilpolizisten, die die Räumung durchführen. Der Kamerad kommt zu dem Schluss, dass es, damit unsere Aktion kein reiner Aktionismus bleibe, nicht nur gut, sondern entscheidend sei, dass wir über Besetzung sprächen, über Betonmischmaschinen, über den Preis von Kartoffeln, und gleichzeitig über John Maynard Keynes und Paulo Freire, und er bittet Oviedo, fortzufahren, und Oviedo fährt fort, aber sie sagt, dass sie, bevor sie weiter über Würde spreche, einerseits gerne ausdrücken möchte, wie erhellend die Reflexionen des Kameraden gewesen seien, und andererseits zumindest anmerken, dass es die vermeintlich großherzigen Zuschüsse nicht gebe ohne andere Wohlfahrtserfindungen wie die Verschärfung des Strafrechts, die zahlen- und größenmäßige Erweiterung der Gefängnisse und Irrenhäuser, die massive Durchsetzung der Psychiatrie, von Pharmazeutika, von Werbung und Fernsehen, die Vernichtung der Wälder und Urwälder sowie die regelmäßige Provokation von Kriegen in Ländern außerhalb des Fortschrittsgürtels, um deren Rohstoffe auszubeuten, um nur einige wenige der offensichtlichsten Säulen dieses Wohlfahrtswohlstandes zu benennen, der uns alle – einschließlich guter Teile dieser Versammlung von Anarchisten – davon überzeugt habe, dass gutes Leben ein Leben mit leichtem Zugang zu Konsum sei, und der dieses gute konsumistische Leben in die Kategorie des Lebens in Würde gehoben habe und dabei das, was vormals als Würde begriffen wurde, von seinem moralischen Gehalt befreit, ein moralischer Gehalt, den diese Versammlung, so fährt die Kameradin fort, auf den Tisch bringen und sich fragen sollte, ob solche rein materiellen Überlegungen wie das Dach oder das Fehlen von fließendem Wasser Priorität haben sollten, wenn man G. G. bei der Besetzung helfe, oder nicht vielmehr Erwägungen, die nicht das Objekt in den Mittelpunkt stellen, sondern beispielsweise die Notwendigkeit, aus einer familiären und persönlichen Krisensituation zu fliehen, wie G. G. selbst es zu Beginn der Sitzung dargestellt und gerade noch einmal wiederholt habe, und das sei nichts anderes als eine dringliche Notwendigkeit zur Emanzipation, bei der weder Kälte oder Regen noch der Nachttopf eine Rolle spielten.
Tanger antwortet, er sei nicht der Meinung, mit einer Wohnung mit Dach und Toilette mache man sich des Konsumismus oder Kapitalismus verdächtig, im Gegenteil: Den Wunsch nach einem Leben unter minimalen hygienischen Bedingungen als bourgeois zu bezeichnen, sei nicht nur ein Argument des Bürgertums selbst, sondern komme von einem noch viel schäbigeren Unterdrückertypen, nämlich dem Revolutionsführer, der unter Berufung auf solch emanzipatorische Rhetorik das Elend der Stützen der Revolution rechtfertige. Nachdem er dies gesagt hat und noch bevor andere Kameraden das Wort ergreifen, macht der Protokollführer die Versammlung darauf aufmerksam, dass es fast Mitternacht sei und dass die eigentlich Betroffene, G. G., bereits vor über einer halben Stunde gegangen sei und man noch keinen einzigen der anderen Punkte auf der Tagesordnung behandelt habe.
Palma fragt, ob die Versammlung lieber die Debatte über Wohnraum und Würde fortsetzen möchte, auch wenn sie das nicht für sinnvoll erachte, da G. G. bereits habe gehen müssen, oder ob wir in der Tagesordnung weitergehen sollten, oder ob wir alle gehen und in einer außerordentlichen Sitzung morgen oder übermorgen weitermachen sollten, worauf der Protokollführer als Erster antwortet und erklärt, dass er sofort losmüsse, da die letzte Metro in fünf Minuten fahre, wobei er bereits aufsteht, seine Sachen nimmt, den Satz im Stehen beendet, darum bittet, ihm die Entscheidung auf Telegram mitzuteilen, und ankündigt, dass jemand anders das Protokoll fortsetzen müsse.