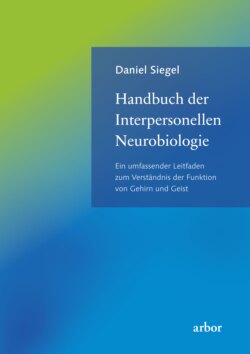Читать книгу Handbuch der Interpersonellen Neurobiologie - Daniel Siegel - Страница 21
Оглавление14
Cortex
Worum geht es?
Als sich in der Evolution das Gehirn* entwickelte, wurden die komplexen wechselseitigen Verbindungen innerhalb dieser höheren Regionen immer weiter verfeinert. Der Cortex* ist der Teil der „äußeren Hirnrinde“, der sich entwickelt hat, als wir zu Säugetieren wurden. Deshalb wird er manchmal auch als „neues Säugetierhirn“, als „Neocortex“ oder zerebraler Cortex bezeichnet. Durch den Cortex konnten wir neuronale Prozesse* bilden, die mittels neuronaler Karten* Dinge in der äußeren Welt repräsentieren. Als Primaten haben wir die frontalen Hirnregionen verfeinert und als Menschen haben wir komplexere präfrontale Bereiche entwickelt, die Aspekte der Welt jenseits der physischen Dimension symbolisieren. Wir können denken, uns etwas vorstellen und Konzepte bilden – Ideen, die von den Randbedingungen der äußeren Welt befreit sind. Die frontalen Anteile des Cortex ermöglichen uns beispielsweise die Vorstellung von Freiheit: Wir sind in der Lage, darüber nachdenken, wie wir die Zukunft verändern und die Welt verbessern wollen, wir können darüber reflektieren, wie wir effektiver lehren oder wir können Gedichte schreiben, die in anderen innere Bilder hervorrufen. Der präfrontale Cortex* liegt über den subkortikalen* Regionen des limbischen* Systems und des Hirnstamms* und trägt dazu bei, diese älteren und weniger konzeptuellen aber genauso wichtigen neuronalen Gebiete zu regulieren*. Auf diese Weise stellen die integrativen Aspekte unseres präfrontalen Cortex möglicherweise die Verknüpfungen* dieser verschiedenen neuronalen Regionen her.
Implikationen: Was bedeutet der Cortex für unser Leben?
Die Evolution hat sich im Laufe der Zeit von niedrigeren zu höheren Hirnregionen bewegt. Diese Richtung zeigt sich auch in der Entwicklung des einzelnen Gehirns. Im Mutterleib spielen Gene eine dominante Rolle wenn es um Befehle geht, wie und wann Neuronen* aus dem Neuralrohr wachsen und zu Rückenmark und zu der Ansammlung von Neuronen werden, aus der dann das im Schädel befindliche Gehirn* wird. Basierend auf dieser Information bildet sich zuerst der Hirnstamm, der zum Zeitpunkt der Geburt schon gut ausgeprägt ist. Die limbischen Bereiche sind zu diesem Zeitpunkt er teilweise ausgebildet, sie wachsen in den ersten Lebensjahren weiter, basierend auf den Informationen der Gene und den Einflüssen aus der Erfahrung.
Zum Zeitpunkt der Geburt sind die kortikalen Bereiche des Gehirns sehr unentwickelt. Obwohl weiterhin auch Gene eine wichtige Rolle dabei spielen, wie sich später im Cortex Synapsen* formen, macht diese geringe Entwicklung vor der Geburt frühe Kindheitserfahrungen besonders wichtig für den weiteren Reifungsprozess des Cortex. Neuroplastizität* ist wahrscheinlich im gesamten Gehirn wirksam, aber der Cortex ist der Bereich, in dem sie bislang am besten untersucht wurde. Dabei hat sich gezeigt, wie sehr der Cortex offen ist für Veränderungen, die sich in Reaktion auf Erfahrungen während der Lebensspanne ergeben. Die kortikale Veränderung basiert auf dem Wachstum und der Stärkung neuronaler Verbindungen durch Synaptogenese und der Reifung von Neuronen und ihrer anschließenden wechselseitigen Verbindungen durch die Differenzierung* der neuronalen Stammzellen durch einen Prozess namens Neurogenese. Zudem führt die Myelinogenese zur Bildung der isolierenden fettigen Myelinschicht entlang der wechselseitig verbundenen Neuronen. Dadurch entsteht ein neuronaler Pfad oder ein neuronales Netz*, das dreitausend Mal effektiver bei der Weitergabe neuronaler Signale ist, als ein Pfad ohne Myelinschicht. Die Bildung von Myelin scheint mit dem Training bestimmter Fertigkeiten in Beziehung zu stehen.
Es gibt noch einen vierten Weg, auf dem die kortikale Architektur durch Erfahrung geformt wird, das ist die Veränderung der Regulierung der Genexpression im Prozess der Epigenese*. Bei jeder dieser Möglichkeiten wird der Cortex von den Erfahrungen, die wir im Leben machen, geformt. Wir verändern ständig unsere kortikale Architektur, nicht nur in der Kindheit oder in der Adoleszenz, sondern während des ganzen Lebens. Erfahrungen in der Familie beeinflussen unsere kortikale Entwicklung und spielen eine Rolle dabei, wie zwischenmenschliche Bindungen* viele Aspekte unseres funktionalen Verhaltens formen, die Emotionsregulation*, die Affektregulation* und unser narratives* Selbst-Verstehen. Auch die Kultur* wirkt auf die Entwicklung des Cortex, weil Energie und Information* durch Beziehungen* und Kommunikationsströme weitergegeben werden, die unsere kortikale Aktivität direkt beeinflussen.
Die Erkenntnis, dass der Cortex ein neuronales System* ist, in dem im Laufe des Lebens Funktionen emergieren, hat die Art und Weise verändert, wie wir die „Lokalisierung“ bestimmter Regionen in diesem Bereich des Gehirns sehen. Wir wissen heute, dass neuronale Prozesse aus einer sich ständig verändernden Sammlung von Interaktionen innerhalb der Verbindungen zwischen unterschiedlich verteilten Regionen entstehen. So enthält der Cortex verschiedene Lappen, die im Allgemeinen dazu dienen, bestimmte Funktionen hervorzubringen. Die hinteren Lappen dienen zur Verarbeitung von Informationen über die äußere Umgebung, wobei der Okzipitallappen (Hinterhauptslappen) Karten des dreidimensionalen Raums schafft, einschließlich des Sehens. Die Temporallappen (Schläfenlappen) verarbeiten Klänge und die Parietallappen (Scheitellappen) kartographieren die Berührung und die Wahrnehmung* der äußeren Bewegungen des Körpers. Der Frontallappen (Stirnlappen) enthält die Bereiche, die unsere selbstgewählten Bewegungen, Pläne und Handlungen vermitteln. Zudem versetzen sie uns in die Lage, zu denken, uns etwas vorzustellen und unsere Aufmerksamkeit* zu fokussieren. Aber um unsere komplexen Fähigkeiten zu bilden, sind komplizierte Prozesse, die auf weit verteilten Bereichen beruhen, nötig. Ein Beispiel: Die Region, in der sich die temporalen und parietalen Bereiche treffen, spielt eine wichtige Rolle in der Bildung von Karten mentaler Prozesse*. Ein umfassenderes Bild des Cortex muss also verschiedene Realitäten einbeziehen: Die weit verteilten Prozesse des ganzen Gehirns ermöglichen die Emergenz komplexer Prozesse, wie die Mindsight-Karten*, exekutive Funktionen* und Bewusstsein*. Darüber hinaus ist das ganze Gehirn während des Lebens in einem ständigen Prozess der Formung und Neuformung. Das Gehirn und im Besonderen der Cortex ist kein statisches Organ, sondern vielmehr ein sich ständig veränderndes interagierendes System von Subsystemen, die schnell und flüssig auf Veränderungen in der Umgebung antworten – zumindest im gesunden* Zustand. Die Erfahrung stimuliert fortwährend die neuronale Aktivierung und das Gehirn antwortet darauf mit einem Fluss* von Veränderungen. Deshalb können wir unseren Cortex als ein adaptives komplexes System* verstehen.
Wir haben auch gelernt, dass die Fähigkeit des Geistes*, durch Aufmerksamkeit die neuronale Aktivierung* auszurichten, die Hirnstruktur tatsächlich verändern kann. Auf diese Weise wird das Gewahrsein* selbst zu einer „Erfahrung“, die die physische Architektur des Gehirns formt. Diese Antwort des sich ständig verändernden Cortex auf den unablässigen Strom von Erfahrungen scheint eine lebenslang bleibende Fähigkeit zu sein. Wichtige regulative Strukturen werden in der frühkindlichen Entwicklung geformt. Aber auch in späteren Jahren besteht unter den richtigen Umständen das Potential, bedeutsame, bleibende und nützliche Veränderungen in der Architektur des Cortex zu schaffen.
Wir sollten hierbei zwar nicht zu vereinfachend vorgehen und denken, dass sich jeder Mensch in beliebiger Weise verändern kann, doch gleichzeitig öffnen diese neuen Studien die Türen für Intervention und Pädagogik, um in kreativer* und bisher nie dagewesenen Weise Strategien zu entwickeln, durch die im Laufe unseres Lebens Veränderungen gefördert werden können. Unsere Beziehungen, unserer Art zu Denken, unsere Absicht* und unser Aufmerksamkeitsfokus können den Gesundheitszustand im späteren Leben beeinflussen. Wir sollten uns immer einen offenem Geist bewahren und die Möglichkeit nicht vergessen, dass das Gehirn aktiv wächst und sich verändert. Diese Erkenntnisse zeigen, dass wir den Geist trainieren können, um die Kraft der Aufmerksamkeit zu nutzen und so das Gehirn während des Lebens in Richtung Integration* und Gesundheit zu bewegen.
Der Cortex bietet uns Möglichkeiten und Herausforderungen. Wenn wir die ausgeprägte Plastizität dieser Hirnregion kennen, dann sind wir in der Lage, andere und uns selbst darin zu bestärken, die Aufmerksamkeit als ein Mittel zu nutzen, um unsere eigene neuronale Architektur absichtsvoll zu verändern. Aus Sicht der Interpersonellen Neurobiologie* ist Integration der grundlegende neuronale Prozess, der in Gang gesetzt werden kann, um unsere Lebensfunktionen zu verbessern. Eine Form des Aufmerksamkeitstrainings, die stark integrativ wirkt, ist die Übung des achtsamen Gewahrseins*. Indem wir absichtsvoll einen neugierigen, offenen, akzeptierenden und liebevollen Zustand* (COAL*-Zustand) während einer Praxisperiode erreichen – dies gelingt durch eine Einkehrzeit* und die Reflexion über die innere Natur des mentalen Lebens –, können wir einen integrierten Zustand neuronaler Aktivierung schaffen. Es konnte gezeigt werden, dass während der Achtsamkeitspraxis Bereiche des mittleren präfrontalen Cortex* aktiviert werden, die weit voneinander entfernt liegende Hirnregionen miteinander verbinden. Bei längerer Praxis konnte gezeigt werden, dass diese Bereiche im präfrontalen Cortex ihre Struktur verändern.
Eine wirkungsvolle Anwendung des kortikalen Verstehens ist das Spüren synaptischer Schatten*, die unsere Kindheitserfahrungen auf die neuronale Architektur werfen. Auf diese Weise hat die Vergangenheit das Gewebe der synaptisch miteinander verbundenen neuronalen Netze geformt, einschließlich des integrativen mittleren Präfrontalbereichs. Wir können diese Schatten darin sehen, dass sich im autobiographischen Narrativ eines Menschen zeigt, wie Kindheitserfahrungen die Funktion und Struktur des Cortex geformt haben.
Das Wissen um die Interaktionen zwischen den älteren subkortikalen Bereichen und der neueren kortikalen Evolution kann auch unsere Auseinandersetzung mit unserem eigenen inneren Erleben beeinflussen. Aus Sicht der Interpersonellen Neurobiologie soll dieses Wissens den Menschen dabei helfen, sich in ihrem Nervensystem* heimischer zu fühlen. Denn dann kann ihr Verstehen zu einem tieferen Gefühl der Zufriedenheit und des Wohlbefindens führen. Der Körper als Ganzes (die Muskeln und Knochen, das Herz, die Lunge und die Bauchorgane), der Hirnstamm (Kampf-Flucht-Erstarrung) und der limbische Bereich (Emotion, Motivation, Einschätzung von Bedeutung*, Bindung, Erinnerung*) sind die subkortikalen Regionen, die zutiefst wichtig sind für alles, was der Cortex „tut“.
Dieser subkortikale Input scheint eine direktere Wirkung auf die Funktion der rechten Hemisphäre* zu haben. Wenn wir also die Unterschiede zwischen den Seinsweisen kennen, die aus der linken, und denjenigen, die aus der rechten Hemisphäre entstehen, können wir für diese subkortikalen Faktoren offener sein. Die zwei Seiten des Cortex, links und rechts, haben nicht nur unterschiedliche Funktionen, sondern ermöglichen dem Menschen auch ganz bestimmte „Seinsweisen“. Diese Lateralität oder Asymmetrie ist ein wichtiges Element in unserer Evolution. Studien haben gezeigt, dass wir Hunderte Millionen Jahre lang Unterschiede in der linken und rechten Hirnhälfte hatten. Dieses Gewahrsein kann uns schließlich in die Lage versetzen, unsere Funktionen zu integrieren. Wir können die Mechanismen vermeiden, durch die wir uns adaptiv für Input aus einer bestimmten Region verschließen, um zu überleben. Das Ziel der Interpersonellen Neurobiologie besteht darin, durch die Veränderung in Richtung Integration von einer Haltung des Überlebens zu einer Haltung der menschlichen Entfaltung zu kommen.