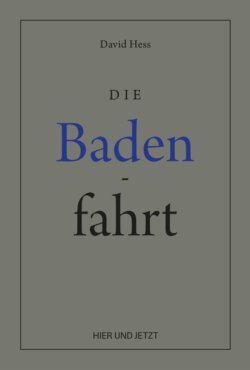Читать книгу Die Badenfahrt - David Hess - Страница 13
ÜBERSICHT ALLER ÄNDERN GASTHÖFE UND BÄDER
ОглавлениеWenn wir aus dem Tor des Hinterhofes treten, könnten wir sogleich links einbiegen und uns an dem grossen Stein vorbei, unter welchem der dorerische Wassersammler verborgen liegt, nach den öffentlichen Bädern wenden; allein dieser Seitenweg ist ein enges, stinkendes Winkelgässchen, voll Mist und Unrat, eine wahre Gurgelschneide (Coupe-gorge). Wir gehen also lieber auf der Hauptstrasse geradeaus, zwischen dem Grossen und Kleinen Bären.
Diese sind keine himmlischen Gestirne, sondern alte Gebäude wie der Hinterhof, nur nicht so geräumig, und müssen die Gäste darin wie in jedem anderen Wirtshaus nahe beisammen wohnen. Das wohltätige Wasser füllt hier 14 geräumige Bäder, welche, so wie jede Kammer, über die Kurzeit alle besetzt sind. Dieser Gasthof hat von alters her einen guten Ruf. Der jetzige Wirt ist auf bedeutende Verbesserungen bedacht und wird bald die Zahl seiner Bäder noch vermehren. Unter dem Kleinen Bären können keine angebracht werden, und um sich derselben zu bedienen, muss man entweder über eine auf dem zweiten Stock neu angelegte Verbindungsgalerie oder über die Strasse in das Haus zum Grossen Bären gehen. Von hier kommen wir an den Ochsen. Dieses Haus ist nach den beiden grossen Höfen eines der reinlichsten und hat gegenwärtig 13 Bäder. Hier kehrt gewöhnlich die wohlhabende Mittelklasse ein. Auf der Bank an der Strasse sieht man noch wie sonst vor Zeiten überall ehrenfeste Herren und Bürger behaglich sitzen, in schönen geblümten Schlafröcken und feinen weissen Tirolermützen. Schade, dass man in diesem Gasthof überall von Gebäuden umgeben ist und nirgends in die freie Natur hinausblicken kann!
Am Ochsen vorbei biegen wir links durch ein enges, schlecht gepflastertes Gässchen hinab und kommen nun auf den Platz der öffentlichen Bäder. Zur Rechten ist das Haus zur Blume, wo sonst nur wohlhabende Landleute und kleine Bürger einkehrten. Der verständige Wirt hat diesen Gasthof kürzlich erneuert, statt der acht ältern nunmehr 17 wohleingerichtete Bäder angelegt und wird von seinen zweckmässigen Veränderungen bald bedeutenden und wohlverdienten Vorteil ziehen.
An der östlichen Seite des Platzes, hinter dem Freibad, steht der Rabe mit 13 Bädern. In diesem Haus sind ein paar empfehlenswerte, reinliche, äusserst bequeme Zimmer, welche sich vor den übrigen vorzüglich auszeichnen. Bedienung und Tafel sollen hier gut, die Gesellschaft gewöhnlich sehr gemischt sein. Hinter diesem Haus gegen die Limmat sind unter den Ablassrinnen der Bäder seit Jahrhunderten grosse Massen von Badstein entstanden, welche wie Stalaktiten aus dem Wasser emporragen.
Der Flor der verschiedenen Gasthöfe stieg und sank abwechselnd, je nach der Industrie der Wirte. Das Haus zum Raben oder, nach schweizerischer Mundart, Rappen stand in der Mitte des 17. Jahrhunderts in solchem Ruf, dass demselben nach alle Bäder und selbst die Stadt im Buch A Complete System of Geography (London 1767) irrigerweise «Rappen» genannt wurden, und auch in Blainvilles Reisen (Lemgo 1764) «die Bäder von im Rappen» als der einzige Namen aller hiesigen Anstalten angegeben ist.
Hinter dem Verenabade bildet der Gasthof zur Sonne einen rechten Winkel, unter welchem das vorhin erwähnte dunkle, stinkende Gässchen gegen den Hinterhof führt. Wenn das Licht dieser Sonne auch nicht blendend leuchtet, so zieht sie doch viel Wasser, denn hier sind schon seit vielen Jahren 14 Bäder zu finden.
Bevor wir in den Staadhof einkehren, wo so viel zu beobachten ist, dass wir uns etwas lang darin verweilen werden, wollen wir noch erst einen Blick auf die beiden öffentlichen Bäder werfen.
Das Heilige oder Verenabad, ist über seiner Quelle selbst gebaut, und das warme, herrliche Wasser sprudelt unaufhörlich aus den Tiefen der Muttererde in dasselbe herauf. Hier können 80 bis 100 Personen beisammen unentgeltlich baden und das wohltätige Heilmittel für so viele Gebrechen aus den Händen der Natur empfangen. Die erste Einrichtung dieses Bades rührt wahrscheinlich noch von den Römern her.
Hier soll in den frühesten Zeiten der Christenheit gegen Ende des dritten Jahrhunderts die fromme Magd Verena, aus Afrika hergekommen, die Armen und Kranken verpflegt und ihnen das Bad bereitet haben; darum trägt es auch den Namen dieser heiligen Jungfrau. Ihr kunstlos geschnitztes Bild steht auf einer Säule mitten im Wasser und wird alljährlich an ihrem Fest, welches die Katholiken am 1. Herbstmonat feiern, mit einem Blumenkranz geschmückt und acht Tage und Nächte hindurch mit fünf geweihten Kerzen beleuchtet. Der Altertumsforscher Herr Professor Altmann in Bern hat zuerst im Jahr 1721 in seinen Observationes philologico-criticae ad varia sacra et profana loca ex antiquitate illustranda behauptet, und viele andere Gelehrte schrieben es ihm auf Treu und Glauben nach, dieses Bild habe ursprünglich die Isis dargestellt. Dass in dieser Gegend einst ein Isis-Tempel gestanden, lässt sich wohl nicht bezweifeln, denn am Kirchturm des benachbarten Dorfes Wettingen sieht man noch jetzt eine Steinschrift eingemauert, welche also lautet:
DEAE ISIDI TEMPLUM A SOLO L ANNVSIVS MAGIANVS DE SVO POSVIT VIR AQVENS B AD CVIVS TEMPLI ORNAMENTA ALPINIA ALPINVLA CONIVNX ET PEREGRINA FIL. XC DEDE RVNT LDD VICANORVM.6
Herr Professor Altmann hat dieses wohlerhaltene, fünf Fuss breite und zwei Fuss hohe Monument beschrieben und erläutert, ging aber in seinen Mutmassungen noch weiter und wollte mit seinen kritischen Augen sogar im Bilde der heiligen Verena noch eine Isis erkennen, weil dasselbe ein Gefäss und einen Kamm trägt. Er führte eine Stelle Virgils an: «lsis sistellam sinistra manu gerit», fügt dann hinzu «in manu dextra pectinem habet» (Aeneid. VIII) und belegt seinen Satz aus dem Apulejus (Metam. XI): «Mulieres in pompa Isidi pectines eburneos ferentes, ut gesta brachiorum, flexusque digitorum, ornatum atque oppexum crinium regalium fingerent.» Nun aber mag die Isis auch noch so oft mit einer Urne dargestellt worden sein, so hat man doch ihr Bild nie mit einem Kamm in der Hand gesehen. In P. Montfaucons Werken, in Caylus’ Recueil d’Antiquités, im pio-clementinischen und dazu gefügten chiaramontischen Museum findet man die Isis mannigfaltig dargestellt, auch eine Nachbildung der in Rom gefundenen Isistafel, aber nirgends die geringste Spur eines Kammes, und wenn auch nach dem Apulejus die das Isisfest begehenden Priesterinnen elfenbeinerne Kämme führten, so beweist dieser Umstand doch nicht, dass der Kamm ein Attribut der Göttin selbst war.
Würden aber auch die ältere Isis und die neuere Verena mit den nämlichen Attributen dargestellt, so hat dennoch Herr Altmann den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und seine tiefe Gelehrsamkeit höchst unnütz an der heiligen Verena verschwendet, denn wenn er sich die Mühe gegeben hätte, das Bild nur in die Hand zu nehmen, so wäre er bald überzeugt worden, dass es sich unmöglich aus den Zeiten, wo die Isis angebetet wurde, bis auf unsere Tage hätte erhalten können, weil es nicht von Stein, Erz oder gebrannter Erde, sondern von Eichenholz verfertigt ist. Ich habe dasselbe aus seinem steinernen Gehäuse nehmen lassen, genau untersucht und möglichst getreu abgezeichnet. Es ist 14 Zoll 6 Linien hoch, mit Ölfarbe grob übertüncht, nicht ganz schlecht, und der ganzen Form nach zu urteilen in der letzten Hälfte des Mittelalters geschnitzt. Das lange Haupthaar ist nicht etwa mit Musa- oder Lotusblättern und Ochsenhörnern, sondern mit einfachen Rosen bekränzt. Die Krone von Golddraht und der Zweig von Flitterblumen sind Einschiebsel neuer Zeit. Das Gefäss, welches die Heilige in der linken Hand trägt, hat eine aus der Mitte derselben hervorstehende Röhre und stellt ohne Zweifel dasjenige dar, aus welchem Verena die Armen von oben bis unten begoss, um sie zu waschen und dann mit ihrem Striegel zu kämmen, wie solches in ihrer Lebensbeschreibung von dem Karthäuser zu Ittingen Heinrich Maurer in seiner Helvetica sancta (Luzern 1648) weitläufig zu lesen ist, wo aber des Aufenthalts der Heiligen in den Bädern zu Baden keine Erwähnung geschieht. Wie und wann dieses Bild hierhergekommen ist, wird schwerlich mehr ausfindig zu machen sein.7 Ob indes die Wohltätigkeit unter dem Bild der Isis, welcher die Ägypter und nach ihnen die Griechen und Römer als Göttin der allwaltenden Natur Tempel und Altäre bauten, oder unter dem einer demütigen, den Armen dienstfertigen, christlichen Jungfrau verehrt werde, ist wohl einerlei. Alles Bildwerk dieser Art, das kunstreichste wie das roheste, ist doch nur Symbol, dessen Zweck ist, an das Göttliche zu erinnern, welches den Menschen in der Natur erfreut und stärkt und erhebt über das Leiden des Lebens. Und so ist dieses Bad mit seinem bescheidenen, veralteten Bild immer ein Heiligtum, ein Tempel der Natur, weil viele Tausend arme, elende, vom Schicksal unbegünstigte Menschen darin Gesundheit und die Kraft wieder finden, sich durchzukämpfen über die Dornenbahn ihres mühevollen Lebens.
In einer Ecke dieses Bades ist eine Tropfmaschine angebracht, welche jedem dient, dem der Arzt diese Kurart verordnet.
Wenn eine veränderte Luftkonstitution dekomponierend auf das Mineralwasser wirkt, dass dasselbe unfehlbar wenige Stunden bevor es Regen gibt, eine milchbläuliche Farbe bekommt, wie wenn Weingeist in Brunnenwasser gegossen wird, so ist diese Entfärbung im Verenabad am auffallendsten bemerkbar, vermutlich wegen der zufälligen Art, wie die Lichtstrahlen sich über die umliegenden Häuser brechen, deren Bewohnern diese Erscheinung immer als ein untrügliches Barometer dient.
Gegenüber ist das Freibad, nur wenige Schuhe kleiner als das der heiligen Verena und ebenfalls den Armen unentgeltlich gewidmet. In diesem Freibad wird geschröpft, was in jenem nicht geschehen darf. Diese Operation wird hier immer in Masse vorgenommen. Die Schröpfkandidaten sitzen in gedrängten Reihen nebeneinander und das Blutvergiessen geht von einem Flügel zum andern wie ein Lauffeuer. Die Schröpfer sind aber höfliche Leute, denn jedes Mal, wenn sie einhauen wollen, warnen sie den Patienten mit dem französischen Wort «Excusez!». Obgleich nun zwar durch diese Formel nichts Französisches in die Masse der Säfte dringt, so möchte doch schon manche schädliche Schärfe hier von einem Nacken auf den andern hinüber geimpft worden sein, weil die Schröpfschnäpper ohne Unterbruch darauflos säbeln, bis die ganze Badegesellschaft blutet, und erst nach ganz vollbrachter Arbeit in einem Stück weichen Talgs abgeschnellt und dadurch wieder gereinigt werden.
Der Schröpfmeister empfängt sein Amt nebst dem dazugehörigen Hause vom Stadtmagistrat auf acht Jahre um den jährlichen Zins von 60 Gulden. Er muss drei bis vier Gesellen halten. Kein anderer darf in den Grossen Bädern schröpfen. In frühern Zeiten gehörte das Recht, dieses Lehen zu vergeben, der Hoheit, welche dasselbe aber schon im Jahre 1430 der Stadt verkaufte.
Das Freibad war einst auch eine Freistätte und genoss das längst eingegangene sonderbare Privilegium, dass, wenn einer sein Leben verwirkt hatte und sich darein flüchtete, er nicht ergriffen werden durfte, solange er sich im Wasser erhalten konnte.
Im Spätjahr, wenn keinerlei Badgäste mehr vorhanden sind, wird die im hiesigen Zuchthaus verwahrte geschlossene Gesellschaft in Abteilungen ins Freibad geführt und dort von Landjägern bewacht, bis alle Züchtlinge sich nach Herzenslust gewaschen und gebadet haben, was eine wohltätige, menschenfreundliche Einrichtung ist und die sonst von Unreinigkeit entstehenden Hautkrankheiten unter diesen Unglücklichen verhüten kann.
Über diese beiden öffentlichen Bäder waltet eine Bad-Armen-Kommission von sechs Mitgliedern,33 unter welchen sich der jeweilige Pfarrer an der reformierten Kirche befindet und die noch über die Kurzeit durch Zuzug von zwei bis vier Ehrenmitgliedern aus der Zahl der angesehensten Badgäste verstärkt wird. Diese Kommission weist den Armen ihre Herberge an, führt über ihr mitgebrachtes Geld, das sie hinterlegen müssen, über die ihnen bestimmte Kost mit den Wirten getreue Rechnung und eine genaue Kontrolle über ihre Ankunft, Kur und Entlassung, versorgt sie mit Rat und Arznei und teilt nach weisen Vorschriften Brot und verhältnismässige Almosen an Geld unter sie aus. Die Kosten dieser vortrefflichen Einrichtung werden aus den Zinsen milder Stiftungen, aus Beiträgen der Stadt Baden und vorzüglich aus der Steuer bestritten, welche jeden Sonntag in allen Gasthöfen gesammelt wird. Wer sich im Bad und an der Tafel gütlich zu tun vermag, wird sein Scherflein zur Verpflegung bedürftiger Kranken umso viel lieber in die verschlossene Steuerbüchse niederlegen, als diese Gaben nicht nur höchst gewissenhaft, sondern ebenso klug und zweckmässig verwendet werden und man dadurch von aller Zudringlichkeit frei bleibt, denn es ist den Armen, welchen der Aufenthalt im Bad von der Kommission bewilligt wird, streng verboten, die Kurgäste mit Bettel irgendeiner Art zu belästigen, und in dieser Hinsicht ist die Polizei hier musterhaft. Auch werden in dieser wohltätigen Anstalt weder Fremde noch Einheimische aufgenommen, welche nicht mit einer Weisung von ihrem Bezirksarzt, einem Armutszeugnis von ihrem Ortspfarrer oder mit irgendeiner anderen amtlichen und gültigen Empfehlung versehen sind. Durch diese Massregel wird der Zudrang liederlichen Gesindels verhindert, welches ohne dieselbe den würdigern Armen und Kranken den Platz verschlagen würde.
Eine bedeutende Stiftung zu so edlen Zwecken erwähnt eine an dem Verenabad eingemauerte, marmorne Tafel, auf welcher die erbaulichen Worte mit goldenen Buchstaben stehen:
DEM ANDENKEN GEORG LÜSCHERS EINEM LANDMANN VON MÖRIKENAMTS LENZBURG DER DEN ARMEN UND NOTHLEIDENDEN IN DIESEM HEILBAD Ao. 1785 SECHSTAUSEND GULDEN VERGABET IST DIESES DENKMAL GEWIDMET.8
Hier sieht man täglich eine Musterkarte menschlichen Elendes, das aber seit wenigen Jahren den Vorübergehenden insofern entzogen ist, dass man die vorher ganz offenen Bäder mit Bretterwänden eingezäunt hat, was besonders am Schröpfbade sehr nötig war, indem der unwillkürliche Anblick einiger Dutzend nackter, mit Hörnchen besetzter blutender Rücken höchst widerliche Empfindungen erregen musste. Indes sind diese beiden Bäder noch immer nur zum Teil mit Dachungen versehen, und so werden die Badenden oft vom Regen verscheucht. In dem Badraume selbst können sie sich, weil der laue Wasserdunst die ganze Atmosphäre darin immer mehr oder minder warm erhält, bei trockenem Wetter zwar nicht erkälten, allein ausser diesem Raum, auf dem kalten Steinpflaster, wo sich die Leute ankleiden, weil sie innerhalb der Umzäunung selten Platz dazu finden und auch nie gehörig trocken gerieben werden, müssen wohl viele elende, ohnehin gelähmte Menschen ihre Übel verschlimmern und in dieser Hinsicht sollte notwendig eine zweckmässigere Einrichtung getroffen werden, was auch der Anstand dringend fordert.
Alle diese Armen finden ihre Herberge in den Wirtshäusern Zum Schlüssel, Zum Halbmond, Zum Löwen, Zur Sägessen, Zum Tiergarten, Zum Gelben Horn und Zum wilden Mann, im Notfall auch in den Privathäusern Zum Stern und Zur Tanne, welche sämtlich keine eignen Bäder besitzen.
Aber nicht nur die Armen setzen sich in das heilige Bad. Von jeher stand das hiesige Mineralwasser und vorzüglich die Verenaquelle in dem Ruf, die Fruchtbarkeit der Frauen zu fördern,9 und noch in unseren Zeiten drückt zuweilen eine vornehme junge, kinderlose Dame, zwischen Scham und Glauben kämpfend, dem Badwäscher verstohlen ein Trinkgeld in die Hand, damit er sie nächtlicherweile, wenn jedes Lauscherauge vom Schlummer geschlossen ist, in den zuvor gereinigten Raume sitzen lasse, wo sie dann, von aussen durch ihre Zofe bewacht, der alten Übung gemäss das Bein in das Verenaloch10 einsenkt und … nach glücklich vollbrachter Kur, von der heiligen Verena (?) erhört und gesegnet nach Hause kehrt. Ob hier der blosse Glaube allein selig mache, ob noch andere Haupt- und Nebenumstände erfordert werden, ob man nicht zuweilen eher die Männer bis an den Hals ins Verenaloch stecken sollte oder ob in Baden sich ohnehin gaukelnde Amorine in Gestalt kleiner Laubfrösche an die seidenen Gewänder der Schönen festklammern,11 darüber erlaube ich mir nicht einmal Vermutungen zu äussern. Und da vielleicht jetzt schon manches sittsame Frauenzimmer wegen dieser blossen Anregung stiller Mysterien erröten und die liebliche Stirn gegen mich in krause Falten ziehen möchte, so wollen wir uns geschwind in den Staadhof flüchten, dessen schöne, neu aufgeführte Fassade uns schon lang einladend entgegenglänzte.
So wie jene schmähliche Benennung Schinderhof in Hinterhof verwandelt ward, ebenso ist auch der eigentliche Name des Staadhofes schon längst unrichtig und Stadthof ausgesprochen und geschrieben worden, wogegen ein ehemaliger Besitzer desselben in einem Reim förmlich protestierte, welcher vor Zeiten in der nunmehr ganz veränderten Wirtsstube an der Wand zu lesen war:
Staad-Hoff und nicht Statt-Hoff tun heissen ich
Weil Conrad am Staad hat bsessen mich.
Conrad am Staad und Salome Schwendin 147012
Dass diese Protestation fruchtlos blieb, beweist Montaigne, der im Jahr 1580 diesen Hof «la cour de la ville» nannte. Man hiess denselben mitunter auch den Vorderen Hof. Eigentlich sollte diese Anstalt jetzt Egloffs-Hof heissen, zu Ehren des gegenwärtigen Besitzers.
Vor 30 und 40 Jahren war dieser Hof eine blosse Bürgerherberge geworden und stand dem Hinterhof in jeder Hinsicht nach, dessen vornehmere Gäste sich nur selten hierher verirrten. Nun verhält sich das anders.
Der jetzige Wirt hat Industrie und versteht seinen Vorteil. Seine Besitzung war längst kein Lehen mehr, denn nachdem Herzog Rudolf von Österreich im Jahr 1304 diesen Hof dem «Heinrich Chouffmann, Purger zu Baden», und Herzog Leupolt «anno 1396 der Anna Koufmann ze Lehen» gegeben, schenkte der nämliche Herzog Leupold «am Mittwoch nach den Oster Feiertagen 1404» mit folgenden Worten «für uns und unser Bruder, Vettern und Erben die zwei Häuser und Hofstatt mit samt den Bädern, mit Runsen und Flüssen des Kessels und auch mit den Gärten darhinder gelegen zu Nider-Baden, die uns getreu Heinrich Koufmann von Baden und seine Vorderen von Uns zu Lehen haben, wegen getreu geleisteten Diensten als Eigentum», und bestätigte diese Schenkung dem Heinrich Kaufmann noch anno 1409 durch einen zweiten Brief mit dem Beisatz: «wegen der getreuen Dienste, die selbiger Uns und Unserem Vater sel. geleistet und noch fürbass tun soll, und zur Ersetzung der grossen Schäden, so er in dem Krieg wider uns Ungehorsamen, die Schwyzer, von unsertwegen genommen hat». Herzog Friedrich von Österreich bestätigte neuerdings im Jahre 1412 die Schenkung «weiland seines Bruders». Alle diese Lehn- und Schenkungsbriefe sind noch in gutem Stande vorhanden. Allein bis auf wenige Jahre war der Staadhof noch wie der Hinterhof ein Fideikommiss. Da indes die Familie Egloff sehr zusammengeschmolzen, benutzte der jetzige Besitzer den Zeitpunkt, sich mit seinen Namensvettern abzufinden und ihnen ihr Anteilsrecht abzukaufen. Es waren viele Hindernisse zu beseitigen. Nach allerlei Umtrieben, Prozessen und bedeutenden Opfern behielt endlich Herr Egloff die Oberhand, und obgleich er keinen Sohn und nur zwei Töchter hat, wovon die eine blind ist, so fing er dennoch an, überall zweckmässigere Einrichtungen zu treffen, die alten Gebäude wegzuräumen, andere dafür hinzustellen und beträchtliche Kapitalien für seinen Hof zu verwenden. In wenig Jahren wird er alles umgeschaffen und in einen für das heutige Baden glänzenden Zustand versetzt haben.
Durch ein weites Tor unter der neuen, gegen die öffentlichen Bäder aufgeführten Vorderseite gelangt man in einen reinlichen Hofraum, welcher, schön geebnet, mit feinem Sande bestreut ist und in der Folge noch mit einigen Bäumen besetzt werden soll.
In einer Ecke ist eine Röhre angebracht, aus welcher die Kurgäste, die das Badwasser trinken wollen, sich nach Willkür durch einen Hahn bedienen können. Ist der Hahn geschlossen, so fliesst das Wasser in die Bäder.
Die den Hof einschliessenden Gebäude, obgleich nicht ganz zusammenhängend, sind doch bei Weitem nicht mehr so unregelmässig wie zuvor, haben alle ein reinliches, heiteres Aussehen und hohe Fenster mit grossen Scheiben. Die Treppen sind breit und bequem.
Die neuesten Zimmer haben Öfen, was bei kühler Witterung, wie sie oft mitten im Sommer hier eintritt, eine wahre Wohltat für Kranke ist, zierliche Gipsdecken, frische und wohlgewählte papierne Tapeten, Wandschränke, Vorhänge von weisser Percale, welche Draperien bilden, einen Schreibtisch, eine Kommode, neue einfache, aber elegante Strohstühle und Canapés. Die Betten sind einschläfrig, freilich ohne Vorhänge, dafür aber haben sie alle Matratzen und leichte seidene Federbetten. Über den Winter werden die Matratzen aufgemacht, das Pferdehaar frisch gezupft und gelüftet und die Überzüge rein gewaschen.
Die Zimmer auf der hintern Seite sind nicht wie im Hinterhof bloss für das Gesinde bestimmt; sie gewähren alle die reizendste Aussicht auf die sich hier nach links biegende Limmat und auf ihre hohen, romantischen, mit Reben, Wiesen und mannigfaltigen Baumarten bekränzten Ufer. Aus einigen wenigen dieser Zimmer gelangt man durch eine eigene Treppe ins Bad.
Ein abgesondertes Gebäude, vor welchem ein Säulengang angebracht ist, enthält den heiteren Speisesaal, der wenigstens 120 Gäste fassen kann und dessen hintere Fensterreihe nach dem Flusse gerichtet ist. Hier sieht man auf die Stelle, wo im Sommer 1815 ein Schiff versank, welches eine Ladung Bomben und Kanonenkugeln zur Belagerung von Hüningen nach Basel hätte führen sollen. Über dem Speisezimmer ist der geräumige Tanzsaal mit einem Nebenzimmer, welche beide den ganzen Tag über von den Gästen zu gesellschaftlicher Unterhaltung benutzt werden können. Bei Veränderung der Häuser wurden die ehemaligen 18 Bäder allmählich bis auf 41 vermehrt. Die neuen sind freilich etwas kleiner als die ältern; allein heutzutage pflegen auch nicht mehr so viele Leute zusammenzusitzen wie vormals, und diese immer mehr überhandnehmende Absonderung hat ihre grossen Vorteile, weil eigentlich jeder Badende einer eigenen, seiner Blutwärme angemessenen Temperatur bedarf. Da das hiesige Wasser so warm aus der Erde hervorquillt, dass das Bad immer sechs bis acht Stunden vorbereitet werden und von seiner Hitze verlieren muss, bevor es gebraucht werden kann, so ist Herr Egloff auf den glücklichen Gedanken geraten, auf dem Hofraum einen grossen, von Backsteinen gemauerten, ganz bedeckten Sammler unter dem Boden anlegen zu lassen, in welchem ein hinlängliches Quantum Badwasser erkalten sollte, um aus demselben durch eigene Röhren die Bäder nach Belieben abzukühlen, wodurch der Kurgast die Temperatur seines Bades richtiger bestimmen und der nämliche Badraum nötigenfalls am gleichen Tage von verschiedenen Parteien benutzt werden könnte. Allein dieser Versuch ist bis jetzt noch nicht ganz gelungen, indem das Wasser in dem bedeckten Sammler nie genug verdunstet.
In den sogenannten Kesselbädern sind zwei ganz neue, sehr gut beschaffene Tropfmaschinen angebracht sowie in einem andern, in zwei Teile unterschlagenen Bade daneben jene zum innerlichen Gebrauch des Wassers unter dem französisch-höflichen Namen Douche-ascendante bekannte, wohltätige Vorrichtung. In der Folge dürfte wohl auch noch ein Schwitzbad hinzukommen. Pumpwerke, vermittelst welcher das Wasser mit Gewalt auf die leidenden äusserlichen Teile gespritzt werden kann und wie es deren zum Beispiel in Aachen und Burtscheid gibt, sind hier nicht üblich.
Da nicht zu bezweifeln ist, dass in der Limmat hinter dem Staadhof sich wenigstens noch eine ganz unbenutzte warme Quelle befindet, so hat Herr Egloff dieselbe fassen und anwenden wollen. Allein unter dem Vorwand, alles Nachgraben könnte den bereits gefassten Quellen Abbruch tun, sie vielleicht gar verschütten, widersetzten sämtliche übrigen Badwirte sich diesem Vorhaben; die Meinung der von der Kantonsregierung zu einer Lokaluntersuchung abgeordneten Experten stand inne und es blieb beim Alten. Herr Egloff wird aber wohl noch in der Folge wieder neue Schritte dafür tun und es wäre sehr zu wünschen, dass es ihm gelingen möchte, diesen von der Natur dargebotenen Schatz zum Besten der Menschheit heben zu können. Mit den Hilfsmitteln, welche die Hydraulik an die Hand gibt, sollte es nicht schwer sein, diese Quelle den übrigen unbeschadet ans Ufer zu leiten.
Solche löbliche Industrie verdient allerdings Beifall. Auch ist der Zudrang in den Staadhof jetzt am stärksten. Die Fremden kehren alle hier ein, wenn sie noch Platz finden; viele Zürcher aller Klassen sind ebenfalls bedacht, sich so früh als möglich ihrer Aufnahme im Staadhof zu versichern. Die Zimmer müssen aber während der drei Sommermonate drei bis vier Wochen vorausbestellt werden, und der aus alter Anhänglichkeit dem Hinterhof treu gebliebene Kurgast kann sich, wenn er seine Bekannten im Staadhof besucht, fast nicht enthalten, mit neidischen Augen auf die eleganten Wohnungen und Gerätschaften und auf so manches andere hinzublicken, was er in seiner Herberge an Bequemlichkeit und Zierat entbehren muss.
Allein alles in der Welt hat seine Kehrseite. In dem erneuerten Staadhof ist jeder Raum besetzt. Es gibt da wenig abgesonderte Gemächer mit eigenen Küchen mehr, wo eine Haushaltung für sich allein abgeschlossen ihr Wesen treiben kann. Hier sind die Dienstboten gewöhnlich etwas weit von ihrer Herrschaft einquartiert und nicht immer gleich bei der Hand. Der Wirt sieht es eben nicht besonders gern, wenn seine Gäste auf ihrem Zimmer speisen, er sucht sie so viel als möglich an der allgemeinen Tafel zusammenzubringen. Er hat zwar in jedem der neuen Gebäude wieder einige Küchen eingerichtet, wo die Gäste ihr Frühstück zubereiten, ihr Teewasser können wärmen lassen, aber der Raum ist im Verhältnis zu klein und die Mägde zanken sich nicht selten um den Feuerherd. Der Staadhof ist ein grosses Wirtshaus, wo über die Kurzeit jedes Zimmer besetzt ist und die Menschen in allen Winkeln neben- und übereinandergeschichtet sind. Auf jedem Gang trifft man fremde Leute an, auf jeder Bank sitzen Bekannte, an jeder Ecke gibt es einen Stillstand. Man kann nicht für sich allein sein, man muss jedem gesprächigen Nachbar herhalten, sich immer zu Ehren der Gesellschaft gekleidet zeigen, den Augenblick erpassen, wo man ungesehen im Schlafrock ins Bad schlüpfen kann; man geniesst die unbedingte Freiheit nicht, welche das Kurleben im Hinterhof so angenehm macht. Zudem ist im Staadhof auch alles teurer. Man bezahlt für ein einziges Zimmer mehr als dort für drei oder vier. Der Wirt muss trachten, sich bald für seine grossen Baukosten bezahlt zu machen, besonders wenn er mit neuen Einrichtungen fortfahren soll. Darüber kann sich nun freilich niemand mit Recht beklagen, aber mancher muss doch auch seinen Beutel zu Rate ziehen und scheut die beträchtliche Ausgabe.
Alles wohl erwogen findet eine ganze, aus mehreren Personen bestehende Haushaltung oder auch der einzelne ruhebedürftige Kurgast, mit Verzichtleistung auf Eleganz und grössere Reinlichkeit, in den vorzüglichsten Gemächern des Hinterhofes ein stilleres und wohlfeileres Unterkommen. Wer aber Gesellschaft und heitere Umgebung liebt und bedarf, sich auch nicht gern mit kleinlichen Gegenständen der Haushaltung schleppen mag, dem wollte ich raten, sich in den neuen fröhlichen Staadhof zu begeben.
Eigentlich möchte ich keinen Gasthof auf Unkosten oder zum Nutzen eines anderen rühmen oder tadeln. Strenge Unparteilichkeit ist Pflicht des Schriftstellers; er soll reine Wahrheit suchen und diese nach seiner Überzeugung aussprechen. Dagegen sollten aber auch die verschiedenen Wirte nie aufeinander eifersüchtig sein, weil jeder nach Massgabe seiner Aufmerksamkeit für die Gäste gut bestehen wird.
Alle Samstage wird im Staadhof getanzt. Vor 20 und 30 Jahren belustigten sich hier nur Bürgersleute und ich selbst habe noch an diesen Sonnabendbällen wackere Fleischer und Müller ohne Ärmel hinter dem Tische sitzen, trinken und ihre Pfeife rauchen sehen. Der Hauptball der vornehmeren schönen Welt fand erst am Sonntagabend in dem sogenannten grünen Saal im Hinterhofe statt. Allein dieser darf jetzt wegen seiner Baufälligkeit nicht mehr dazu benutzt werden, und in der Regel tanzt man nur noch im Staadhof. Die Gesellschaft sämtlicher Höfe und Badanstalten, jeder gesittete, anständig gekleidete Gast kann an diesem Ball teilnehmen. Der Staadhofwirt verrechnet eine Kleinigkeit für die aufgetragenen Erfrischungen und die Tänzer bezahlen die Musik.
Die ganze Woche hindurch freuen sich die jüngeren Frauenzimmer, welche nur für ihr Vergnügen hier sind, auf diese Gelegenheit, ihren mitgebrachten Putz anzuwenden und sich recht satt zu walzern. Zu Pferd, in Wagen und Schiffen strömen an diesen dem Tanz gewidmeten Sonnabenden die jungen Herren herbei, und der gemischte Ball, wo neue Bekanntschaften gemacht, alte erneuert und kleine Liebesromane gespielt werden, dauert meistens länger als die Regeln der Kur es eigentlich gestatten.
Da wir jetzt sämtliche Grossen Bäder auf dem linken Limmatufer kennen, wollen wir uns auf das rechte hinübersetzen lassen, wozu immer eine Fähre bereit ist, und noch einen flüchtigen Blick auf die dortigen Kleinen Bäder in Ennetbaden werfen, welcher Ort zwar sein abgesondertes Gemeindegut besitzt und von jeher eigene Vorsteher zur Besorgung seiner Privatrechte, daneben aber teil am Kirchen- und Armengut der Stadtgemeinde hatte und dieser politisch und polizeilich einverleibt war. Seit Kurzem sitzt ein angesehener Bürger von Ennetbaden im Stadtrat. Allein man geht damit um, diesen Nebenort vermittelst Abreichung einer Kapitalsumme von der Stadt zu trennen und in eine für sich ganz allein bestehende Gemeinde zu verwandeln.
Die Kleinen Bäder, wo gewöhnlich nur Bauern, Handwerker und weniger bemittelte Leute einkehren, bilden eine eigene Kolonie und haben mit den Grossen jenseits keinerlei Gemeinschaft. Die hier dicht am Fluss entspringenden Quellen, eine grosse und vier kleinere, gehören den vier Badwirten Zum Stern, Zum Engel, Zum Rebstock und Zum Hirschen. Ein fünftes Wirtshaus, Zum Löwen, besass ehemals einen fünften Teil an diesen Quellen, und die Gemeinde Ennetbaden hatte einen sechsten Teil angesprochen, woraus ein Prozess entstand, welcher durch ein von den acht alten Orten am St. Ulrichstag 1512 gefälltes Urteil dahin entschieden ward, dass zwar die Bürger von Ennetbaden sich des dortigen Freibades sollten unentgeltlich bedienen dürfen, aber nur wenn sie neben den Gästen der fünf Wirtshäuser Platz fänden, und dann müssten sie noch, eh sie sich ins Bad setzen dürften, ihre Füsse rein waschen. Für diesen Zutritt ins Bad muss die Gemeinde noch heutzutage den sechsten Teil an die Kosten zur Unterhaltung des Freibades und an die Besoldung des Badwäschers zahlen. Im Jahr 1536 brannte das Haus zum Löwen ab, und da dasselbe nicht wieder aufgebaut wurde, fiel sein Fünftel an den Quellenrechten auf die vier übrigen Badhäuser zurück und der Platz ward zum Stern gekauft.
So wie wir aus dem Schiffe steigen, sehen wir zur Linken das grosse gemeinschaftliche Schröpfbad, in welchem selbst eine der vier kleineren Quellen aus der Erde hervorströmt. Es kann gegen 60 Personen fassen und hat zur Seite noch eine besondere Abteilung. Einige Schritte höher zur Rechten des kleinen Platzes steht ein anderes öffentliches Bad, welches sein Wasser zunächst aus der Hauptquelle bezieht. Diese sind aber nicht unbedingte Freibäder, indem jeder, welcher, ohne Bürger von Ennetbaden zu sein, sich derselben bedienen will, für den Tag im Schröpfbad einen, im anderen öffentlichen Bad aber zwei Schillinge bezahlen muss. Hier wird auch kein Almosen ausgeteilt; dagegen sind diese Bäder gehörig eingefasst, bedeckt und gegen Wind und Wetter geschützt. Die Badschillinge fallen in eine gemeinschaftliche Büchse, aus welcher die vier Wirte ihren Kostenanteil an den Unterhalt dieser öffentlichen Bäder und die Besoldung des bei denselben angestellten Badwäschers bestreiten. Das Schröpfrecht, das sie jüngst durch Kauf an sich gebracht, haben sie bereits für 380 Gulden jährlichen Zins verpachtet.
Zum Stern, wo kürzlich nur viere waren, gehören nun durch Anbau von vier neuen acht; Zum Engel nur vier, Zum Rebstock durch vier neu hinzugekommene acht und Zum Hirschen, ebenfalls durch vier neue, acht Privatbäder, welche alle sehr reinlich sind, wovon indes der grössere und ältere Teil für nicht viel mehr als öffentliche Bäder gelten kann, indem wenigstens über den stärksten Andrang die Hausgäste darin so nahe als möglich zusammengesetzt werden. Die auffallend zunehmende Betriebsamkeit der Badwirte wird aber diese Anstalten bald zu gemächlicherem Gebrauch vermehren und erhöhen.
Kraft alter Freiheiten hatten diese Wirte eine Polizeiordnung entworfen, welche ihnen am St. Luzientag 1506 vom Schultheiss und Rat bestätigt ward. Darin heisst es unter anderem: «Fragt ein Gast, wo gut Zehrung wäre, soll und mag ein Knecht und sein Weib wohl reden an allen Orten und Enden» (das heisst in allen Wirtshäusern gleich gut), «fragt aber ein Gast mit Namen in ein Haus, das soll man ihm weisen und sagen.»
Vor Zeiten war den Juden in Ennetbaden ein eigenes, abgesondertes Bad eingeräumt, das aber für sie eingegangen ist. Die Wirtshäuser Zum Kreuz, Zum Rössli, Zum Ochsen, welches letztere sehr fröhlich gelegen und empfehlenswert ist, haben keinen Teil an den Quellen, folglich auch keine eigenen Bäder. Ihre Gäste dürfen sich bloss der öffentlichen bedienen.
Die hier befindliche St. Michaelskapelle wird von den Kapellanen der Stadtkirche versehen.
Früher soll es in Ennetbaden etwas liederlich zugegangen sein und angesehene Leute, die sich schämten, ihre Bacchanalien mit feilen Dirnen in den Grossen Bädern unter den Augen vieler Zuschauer zu begehn, fanden hier Gelegenheit dazu. Dergleichen ist jetzt nicht mehr zu bemerken, und mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, wo benachbarte Landleute sich hier zum Trunk, zu Spiel und Tanz versammeln, herrscht Ordnung und Stille in den Kleinen Bädern. Wir finden weiter nichts zu beobachten, setzen uns wieder in den Nachen und lassen uns auf das linke Ufer zurückführen.
Dort bilden die sämtlichen Grossen Bäder, welche als integrierender Teil zur Stadtgemeinde gehören, einen eigenen Eingang, welcher an der Halde durch das Haupttor beim Landungsplatz am Wasser und bei der Mattenkirche durch Nebentore alle Nacht abgeschlossen wird. Der Hinter- und Staadhof haben noch ihre besonderen Tore. Um nicht eine weitläufige und verwirrende Beschreibung aller auf beiden Flussufern befindlichen Quellen und ihrer Verteilung in die verschiedenen öffentlichen und Privatbäder und aller Gebäude liefern zu müssen, verweise ich auf den hinten beigefügten Grundriss, den ich der Gefälligkeit des Herrn Leonhard Schulthess im Lindengarten zu verdanken habe, welcher auf seinem Originalplan die jedes Jahr vorfallenden Veränderungen mit grosser Genauigkeit nachträgt.13
Über die Quellenrechte und das jedem Eigentümer zukommende Quantum Wasser wachen und ordnen wie vormals Schultheiss und Rat nunmehr der Ammann und die Stadträte, unter deren Aufsicht die Sammler und Leitungen gemeinschaftlicher Quellen in den Grossen Bädern alle Jahre einmal, am Montag in der Karwoche, untersucht und gereinigt werden. Als Grundlage der Ansprüche jedes Teilhabers wird ein altes, die Badschüssel genanntes Modell des Kessels unter dem heissen Stein, mit allen Seitenöffnungen und den auf messingenen Stäben genau verzeichneten Ausmessungen der verschiedenen Wasserausteilung im Stadtarchiv aufbewahrt. Wenn ich den Überfluss und Gehalt dieses wohltätigen Mineralwassers, die schöne Gegend, in der es hervorquillt und das Bedürfnis des Zeitalters betrachte, so kann ich mich des Wunsches nicht erwehren, dass sämtliche Bäder und Gasthöfe in Baden von einer liberalen Regierung gekauft und nach einem einzigen neuen, alles umfassenden Plan von Grund ausgebaut und eingerichtet werden möchten.
Auf beiden Limmatufern sprudeln in einem kleinen Umkreis 17 warme Quellen, die im Fluss noch vorhandenen nicht gerechnet, aus der Erde hervor und liefern nach Scheuchzers schon im Jahr 1732 bekannt gemachter Berechnung in 24 Stunden 463,036 Badener Stadtmasse14 warmen Mineralwassers. Wie mannigfaltig könnte ein solcher Reichtum benutzt werden!
Alle auf dem linken Ufer befindlichen Wirtshäuser und Bäder sollten weggeräumt und dagegen vier bis fünf grosse zusammenhängende, mit Hofräumen versehene Flügelgebäude aufgeführt werden. In den Fassaden Speise- und Gesellschaftssäle, Küchen und eine Apotheke, nebst Reihen abgesonderter Zimmer für einzelne Gäste. In den Flügeln Wohnungen von mehreren zusammenhängenden Zimmern und Kabinetten für ganze Familien, mit kleinen Küchen, womöglich mit eigenen Seitentreppen (escaliers dérobés) in das jeder Abteilung zustehende Bad. Im ersten und zweiten Stock könnte mit einiger Abwechslung, kleiner oder grösser, wohlfeiler oder kostbarer, je nach dem Bedürfnis ungleich begüterter Menschen eine ähnliche Einteilung stattfinden. Auf jeder Türe müsste neben der Nummer der Mietpreis angeschrieben stehen. In kleineren Seitengebäuden eigene Einrichtung und Wirtschaft für Bauern oder andere weniger bemittelte Leute, die doch noch im Fall wären, ihre Kur zu bezahlen. Ein geräumiges, aber einfaches Schauspielhaus. Für die ganze Anstalt müsste ein geschickter Arzt als Oberaufseher, für jedes Hauptgebäude ein Wirtschaftsverwalter vorhanden sein. Die Umgebungen könnten, wenn der Natur auch nur einigermassen nachgeholfen würde, in die reizendsten Anlagen verwandelt werden.
Die reichhaltigen Quellen des rechten, mit dem linken durch eine Brücke verbundenen Ufers würde ich ausschliessend wohltätigen Zwecken widmen. Dort sollte in Form eines grossen Hospitals ein weitläufiges Gebäude aufgeführt werden nebst geräumigen Bädern, jedes zu 30 bis 40 Personen, wo beide Geschlechter voneinander getrennt baden, schröpfen und ihre Kur unter der Aufsicht eines vom Oberarzt abhängigen Chirurgen gebrauchen könnten. Hier müssten alle Armen und Kranken unentgeltlich verpflegt werden.
Doch, was nützt es, dergleichen nur auszusprechen? Wie und woher sollten sich die zu einer solchen Unternehmung erforderlichen Summen zusammenbringen lassen? Unsere Vorfahren zeichneten sich durch milde grosse Stiftungen auf Jahrhunderte aus und pflanzten Linden, deren Schatten den spätesten Enkeln zugutekommen. Wir werfen den Armen einen Kreuzer in den durchlöcherten Hut, nehmen hochgepriesenen Teil an wohltätigen Subskriptionen, deren Ertrag auf das Bedürfnis des Augenblicks verwendet wird, und pflanzen Akazien, die vor unserem Tod verdorren. Die Welt ist nicht zu ändern, und mein Plan für Baden wird ewig ein frommer Wunsch, eine müssige Träumerei bleiben.
So wollen wir denn froh sein, dass wenigstens Herr Egloff nach dem Verhältnis seiner Kräfte etwas Besseres als das bisher Bestandene aufgestellt hat.
Und nun, da wir nach einem langen kritischen Spaziergang durch alle Bäder und Anstalten endlich spät und müde wieder in unserem Hinterhof angelangt sind, wollen wir uns auskleiden, auf unsere Betten hinlegen, und unter den Schreck- und Finsteraarhörnern unserer Federdecken so sanft als möglich dem kommenden Tag, mit welchem unser Badleben eigentlich erst beginnen wird, entgegenschlummern.