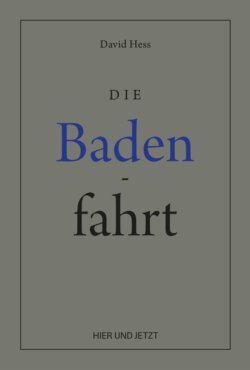Читать книгу Die Badenfahrt - David Hess - Страница 15
DAS BAD
ОглавлениеIch möchte jedem, der sich am frühen Morgen ins Bad begeben will, die bequeme Kleidung empfehlen, deren ich mich seit Jahren zu diesem Behuf bediene. Sie hält warm, ist in einem Augenblick an- und ausgezogen und besteht einzig in einem Kamisol von feinem englischen Flanell für den blossen Leib, einem weiten Strumpfpantalon von dichterem Flanell und einem Schlafrock von ähnlichem Stoff mit weiten Ärmeln, der vermittelst eines hinten befestigten Gürtels vorn mit einem Knopf geschlossen werden kann und einen aufstehenden Kragen hat, der unter dem Kinn eingeknöpft wird. Bei dieser aus nicht mehr als drei Stücken bestehenden Kleidung braucht man weder Hemd noch Strümpfe noch Unterhosen noch Halstuch mitzunehmen, was alles sonst im Badgewölbe herumhängen und nur mühsam wieder angezogen werden müsste. Nach dem Bad ist es auch besser, in lauter Wolle eingewickelt zu sein, deren sanftes Reiben besonders wohltätig auf die Haut wirkt. Den Frauenzimmern würde ich eine ähnliche Bekleidung anraten, wenn sie sich über dergleichen ins Toilettenfach einschlagenden Gegenstände etwas vorschreiben liessen.
Das Fälklein im Hinterhof.
So gegen die kühle Morgenluft geschützt, schlüpft man hinab ins Badgewölbe, in welchem selbst man sich unmöglich erkälten kann, weil da die Luft vom Dunst des Wassers immer angenehm erwärmt ist.
Dem Badwäscher ist deswegen zu empfehlen, dass er die Fenster nur so lange offen lasse, bis die Luft erneuert ist, welches über die Zeit geschehen kann, wo er das Bad bereitet, und da dieses wohl auf der Stelle wärmer, aber nicht kälter gemacht werden kann, wenn man nicht gewöhnliches Wasser aus der Limmat beimischen will, so muss es sechs bis acht Stunden, ehe man sich desselben bedienen will, gefüllt sein, und sich bis auf etwa 23 Grad Réaumur durch Verdunstung abkühlen können.
Ob das Bad in der Zwischenzeit von keinem ungebetenen Gast gebraucht worden, lässt sich an einem dünnen Häutchen erkennen, welches vermutlich von der Einwirkung der atmosphärischen Luft auf das Wasser gebildet, auf dessen Oberfläche schwimmt und von der leisesten Berührung verletzt wird. Es sieht demjenigen ähnlich, welches auf dem künstlichen Kalkwasser entsteht, wenn dieses einige Zeit der Luft ausgesetzt war, und mag einige äusserst feine Schwefelblumenteilchen enthalten.
Da man bei verschiedener Lufttemperatur den Wärmegrad des Wassers unmöglich durch das blosse Gefühl bestimmen kann, so ist es nötig, ein Badethermometer bei sich zu haben, das man während des Auskleidens ins Wasser senkt und so viel warmes aus der Röhre nachlaufen lässt, bis die Wärme auf den Grad, dessen man bedarf, gesteigert ist. Vermittelst dieser Massregel kann man sicher sein, immer in der gleichen Temperatur zu baden.
Auf den Thermometern nach Réaumur ist der 25. Grad für die Bäder bezeichnet. Allein nicht alle solche Instrumente sind gehörig reguliert, und die Körperwärme der Menschen ist sehr verschieden. Das beste Regulativ für jeden möchte folgendes sein: Man stecke das Thermometer in einem Augenblick, wo man weder erhitzt ist noch friert, unter die Achselhöhle auf den blossen Leib und knöpfe die Kleider wieder zu; nach Verfluss von höchstens fünf Minuten wird der Weingeist oder das Quecksilber genau die Blutwärme dessen bezeichnen, der sich das Thermometer anpasste. Man merke sich bestimmt und ein für allemal den Grad und bade immer in dieser Temperatur, wenn der Arzt nicht verordnet hat, dass man wärmer oder kälter als der Blutgrad baden soll.
Bauern und viele andere unberatene Leute wähnen, nie warm genug baden zu können, je heisser das Wasser, desto kräftiger glauben sie, sei es. Dies ist aber gar nicht der Fall und wer im Bade geschwitzt und sich rotgebrüht hat, wird Kopfschmerzen und Schwindel bekommen, sich geschwächt fühlen und, zumal bei kühler Luft, sich im Freien bald erkälten. Ob man nur bis an die Brust oder bis ans Kinn im Wasser sitzen müsse, darüber herrschen verschiedene Meinungen. Salomon Hottinger sagte drollig genug und Scheuchzer hat es ihm nachgeschrieben: «Dass der Nabel so viel als der Marchstein, wie des Menschen unteren und oberen Leibs, also auch des Sitzens in dem Bad sei.» Wer indes keine schwache Brust hat und überhaupt keine Unbequemlichkeit davon spürt, tut meines Erachtens wohl daran, wenn er das heilsame Element so viel als möglich auf die ganze Oberfläche seines Körpers wirken lässt.
Wer nach des Arztes Verordnung durch längeres Baden den so manchen Krankheitsstoff durch die Poren ausführenden, oft äusserst wohltätigen Ausschlag bekommen soll, fängt mit zwei Stunden vormittags und einer des Abends an, steigt bis auf fünf Stunden im Tag, und wenn der Ausschlag sich gehörig gebildet hat, so badet man denselben, die Stundenzahl allmählich vermindernd, wieder weg, welches alles in 21 Tagen möglich ist. Viel Bewegung im Freien und an der Sonne fördert diese Krisis; allein man soll sich dabei sorgfältig vor jeder Erkältung hüten, welche den Ausschlag immer richtig wieder zurücktreibt und schwerere Krankheiten verursachen kann, als die war, wegen der man ins Bad kam.
Wer es hingegen zu keinem Ausschlag soll kommen lassen, darf nicht länger als vormittags eine ganze und abends eine halbe Stunde im Bade verweilen.
Auf keinen Fall darf der Badende sich im Wasser dem Schlaf überlassen. Alle Ärzte raten das wohlmeinend und schon vor drei Jahrhunderten schrieb Alexander Sytz: «Man soll allenthalben im Bad etwas Kurzweil haben mit Fabulieren und dergleichen, um damit dem Schlaf zuvorzukommen, denn der Schlaf zieht die Geister hinein und das Bad heraus.»
Die meisten Kurgäste gebrauchen das zweite Bad nachmittags um vier oder fünf Uhr und gehen dann wieder aus und dem Vergnügen nach. Manche setzen sich, nur um bald fertig zu sein, gleich nach dem Essen ins Wasser, was aber höchst schädlich ist, weil die Verdauung dadurch gestört und das Blut nach dem Kopf getrieben wird. Ich habe mich immer am besten dabei befunden, wenn ich erst abends nach vollbrachtem mässigem Spaziergang noch ein halbes Stündchen in der Dämmerung badete. Dann hatte ich mich zu keinem Ausgang mehr anzukleiden, lief nicht Gefahr, mich an der Nachtluft zu erkälten und legte mich, vom Bad angenehm abgekühlt, nach einer leichten Nachtsuppe früh zu Bett. Die Stille beim matten Schimmer einer Kerze hat etwas Trauliches im tiefen Badgewölbe, und nicht selten erhebt darin das einsame Heimchen seine zirpende Stimme.
Aber auch zu jeder anderen Tageszeit ist es eine wahre Wollust, sich hier zu baden. Man befindet sich kaum ein paar Minuten im Wasser, so empfindet man eine sanfte Abspannung, eine unbeschreibliche Behaglichkeit und kann sich frei und bequem in dem weiten Raum herumbewegen.
Zwar sind hier die in den Boden eingesenkten Bäder weder mit Marmor noch mit Zinn oder Porzellan wie in Pyrmont, sondern lediglich mit Holz ausgefüttert und haben ringsumher etwa fusshohe Bänke; dagegen aber sind die meisten derselben und besonders die älteren so tief und weit, dass eine ganze Familie darin Platz findet. Die Kinder überlassen sich in diesen Wassern meist einer ausgelassenen Freude. Sie jubeln, kreischen, spritzen einander, tauchen unter und schwimmen, ihre Schiffchen vor sich herschiebend wie Fische in dem Behälter herum. Oder wenn sie allmählich ruhiger werden, bilden sie mit den Badhemden grosse Blasen, drücken diese aus und treiben allerlei mutwilliges Spiel.
Was enthält aber dieses herrliche Wasser? Welche Wunderkraft ist ihm gegeben, so mancherlei Elend zu mildern, so viele Krankheiten zu heilen? Seitdem Herr Morell im Jahr 1788 seine Analyse desselben bekannt werden liess, sind bedeutende Fortschritte in der Chemie und besonders in der Wasserscheidekunst gemacht worden. Herr Bauhof, Direktor einer Vitriolölfabrik in Aarau, ein ausgezeichneter Chemiker, hat kürzlich eine neue Analyse vorgenommen, aus welcher sich folgendes Resultat ergab:15
Temperatur der Quelle 37 Grad über Null, Réaumur Eigentümliche Bestandteile in 300 Unzen Wasser (ungefähr 6 Mass)
48 Kubikzoll kohlensaures Gas Schwefel-Wasserstoff-Gas in geringer, unbestimmter Quantität
233 Gran schwefelsaurer Kalk (Gips)
186 Gran salzsaures Natrum (Kochsalz)
51 Gran salzsaure Bittererde
48 Gran schwefelsaures Natrum (Glaubersalz)
36 Gran kohlensaurer Kalk
31 Gran schwefelsaure Bittererde (Bittersalz)
11 Gran kohlensaure Bittererde (Magnesia)
5 Gran Extraktiv-Stoff
1 Gran Eisenoxyd
Bestandteile des Selenits oder Badsteins
In tausend Teilen desselben:
790 kohlensaurer Kalk
117 schwefelsaurer Kalk
51 kohlensaure Bittererde
2 salzsaure Bittererde
3 Eisenoxyd
37 Wasser und etwas Extraktiv-Stoff
Diese Analyse erwähnt keinen in konkreter Gestalt vorgefundenen Alaun, womit doch zuweilen die Mündungen der Teichel überzogen sind. Herr J. J. Irniger, Kantons-Apotheker in Zürich, ein trefflicher Chemiker, hat eine solche von einer Wasserröhre in den Kleinen Bädern abgebrochene Kruste mit heimgenommen, welche sich bei chemischer Prüfung als reiner Alaun bewährte. Der Kern des Badsteins unter den Ablassrinnen hinter dem Raben könnte vielleicht darüber einige Resultate liefern, wenn einer dieser jahrhundertealten Stalaktiten zu diesem Behuf zerschlagen und genau untersucht würde.16 In Hinsicht auf die Temperatur der Quellen scheint Herr Bauhof einen Mittelschlag angenommen zu haben, indem er dieselben im Allgemeinen auf 37 Grad über Null nach Réaumur bestimmt. Allein wenigstens vier Quellen sind um einen ganzen Grad wärmer, nämlich die unter dem grossen heissen Stein, die unter dem kleineren daneben, die Verenaquelle und die auf dem rechten Limmatufer. Diese allein treiben den Weingeist oder das Quecksilber auf 38 Grad, wovon ich mich selbst überzeugte, indem ich den Beobachtungen meines verewigten Freundes, Herrn Doktor Zwingli, beiwohnte, welcher die sorgfältigsten Untersuchungen mit drei verschiedenen Thermometern darüber anstellte. Die Wärme der übrigen Quellen ist von ihm nicht gemessen worden.
Herr Doktor Dorer hat also in seiner Beschreibung der Bäder von Baden, worin derselbe der eigenen Quelle des Hinterhofs und derjenigen unter dem vorderen heissen Stein 125 Grad, der Verenaquelle sogar 127 Grad nach Fahrenheit zuschreibt, dagegen die Temperatur der Quelle in den Kleinen Bädern auf 115 Grad herabsetzt, sich ganz bestimmt geirrt, was zumal mit mangelhaften Instrumenten sehr leicht geschehen kann. 127 Grad Fahrenheit betragen ungefähr so viel als 42 Grad Réaumur, und so warm ist nicht einmal die Hauptquelle in Leuk; 115 Grad Fahrenheit sind nicht völlig 37 Grad Réaumur, und dass die Hauptquelle in den Kleinen Bädern eine Wärme von vollen 38 Grad habe, ist durch obenerwähnte Prüfung unumstösslich erwiesen. Johann Jakob Scheuchzer hat im Jahre 1730 seine Untersuchungen dieses Wassers an allen Quellen und mit jeder besonders vorgenommen; allein die neueren Chemiker, welche uns Beschreibungen desselben lieferten, scheinen anzunehmen, dass alle Quellen die nämlichen Bestandteile in gleichen Verhältnissen enthalten, weil sie nicht sagen, aus welcher derselben sie das Wasser, das sie untersuchten, genommen haben und doch kann nicht bezweifelt werden, dass zum Beispiel die Quelle unter dem grossen heissen und diejenige unter dem daneben liegenden kleineren Stein von verschiedenem Gehalt sein müssen. Beim jährlichen Ausreinigen der Leitungen findet man in dem Teiche, der das Wasser aus der Quelle unter dem kleineren Stein in das Freibad führt, immer gegen zwei Pfund wirklichen, schön brennenden Schwefel, indes man diesen in den Teicheln, welche das Wasser aus der Quelle unter dem grossen heissen Stein in verschiedene Bäder leiten, gar nicht oder doch nur in geringem Masse vorfindet. Dagegen scheint in dieser letzteren die Schwefelleberluft im Verhältnis zu jener vorzuherrschen. Es würde sich also der Mühe lohnen, jede Hauptquelle besonders zu analysieren, damit der Arzt jedem Kranken bestimmt diejenige empfehlen könnte, welche ihm am besten dienen wird.
Sehr wahrscheinlich wird das Wasser in den verborgenen Tiefen des Lägernberges gekocht. Die Kleinen Bäder erhalten dasselbe zunächst, der grössere Teil fliesst wohl unter der Limmat durch den Grossen Bädern zu, ohne deswegen kälter zu werden, denn auf beiden Flussufern sind die Hauptquellen gleich warm, und wenn mitunter behauptet werden will, das Wasser im Freibad des rechten Ufers sei wärmer als das im Verena- und Freibad des linken Ufers, so rührt dieser scheinbare Unterschied bloss daher, dass jenes ganz bedeckt und eingeschlossen ist und die Wärme deswegen länger darin zurückbleibt. Es ist über die Zubereitung dieses Wassers in den Eingeweiden der Erde und über die Ursachen seiner Wärme in älteren und neueren Zeiten manche Hypothese aufgestellt worden. Von dem vor einigen Jahrhunderten durch die damaligen Naturforscher allgemein verbreiteten abenteuerlichen Gedanken, als brenne ein unterirdisches Feuer im Schosse des Lägernberges, ist man allerdings schon längst zurückgekommen und es wird angenommen, dass diese Erhitzung des Wassers durch seine chemische Mischung mit Kalkerden, Schwefelkiesen, Alaunschiefern und anderen Bestandteilen, vielleicht durch ein noch unerörtertes elektrisches oder galvanisches Fluidum verursacht werde. Wir lächeln über das, was unsere guten Alten davon fabelten. Allein wer bürgt uns dafür, dass alles, was die Neueren darüber zu erforschen trachten, nicht immer nur Fragment bleiben werde? Die heilige Natur wirkt hinter undurchdringlichem Schleier und gestattet keinen Zutritt in ihre unterirdische Werkstätte, wo sie den Sterblichen, die auf sie hoffen und an sie glauben, geheimnisreich waltend, so manches Labsal bereitet.17
Für welche Krankheiten diese Bäder dienlich seien, mögen die Ärzte bestimmen, welche alljährlich so viele Leute herschicken, die an den verschiedenartigsten Übeln leiden. Wer alle Schriften durchgeht, welche von Conrad Gessner bis auf unsere Tage über diesen Gegenstand erschienen sind, findet ein so ungeheures Verzeichnis menschlicher Gebrechen darin aufgestellt, dass man daraus schliessen möchte, das Wasser zu Baden sei eine Universalarznei, was es doch schwerlich sein kann.
Man sollte denken aus seinen Bestandteilen, ihrem Verhältnis zueinander und ihrer Mischung liesse sich genau angeben,* welche Krankheitsursachen vorzüglich dadurch könnten gehoben werden. Allein es gibt entweder noch keine hinreichenden chemischen Mittel, die feinsten Bestandteile aller Mineralwasser zu erörtern oder die Natur treibt hier sonst ihr Spiel mit den Meistern der Kunst, denn indes öfters ein Übel im Körper eines Patienten geheilt wird, verschlimmert sich dasselbige in den nämlichen Teilen eines anderen, bei gleicher Anwendung des Mittels. Darüber muss man die Kurgäste erzählen hören, von denen oft einige über Verstopfung, andere über Durchfall klagen, von denen oft solche, die nur ein paar Tage baden wollten, den Ausschlag bekommen und viele Wochen brauchen, bis er wieder abgebadet ist, indes andere diese Krisis erzwingen wollen und nie dazu gelangen. Das Einzige, was sich aus diesen verschiedenen Wirkungen abnehmen lässt, ist, dass es darüber keine allgemeine Regel gebe, dass die Anwendung des Bades in Temperatur und Zeit genau nach dem individuellen Bedürfnis des Kurgastes bestimmt werden sollte und dass die Abweichungen verschiedener Naturen ins Unendliche gehen.
Unstreitig wird durch den flüchtigen, durchdringenden Reiz dieses Wassers die Tätigkeit des Hautorgans und durch die natürliche Wärme des Bades die eigene Wärme des Körpers erhöht. Verstopfungen, nicht nur in den Hautdrüsen, sondern auch in den inneren Teilen werden dadurch erweicht und aufgelöst und der ganze Organismus durch die Befreiung von hemmenden Stoffen gestärkt. Alte, von Schlagflüssen gelähmte Leute erlangten hier wieder den freien Gebrauch ihrer Glieder. Krätze, Flechten, eiternde Geschwüre, verjährte Rheumatismen, Gicht, Epilepsie, Leberverstopfungen, Gravel- und Steinbeschwerden und anderes mehr wurden hier geheilt, besonders weibliche Krankheiten, weswegen dieses Bad vor Zeiten auch das Weiberbad genannt ward. Nach überstandenem Wochenbett richtet es fast immer schwächliche Frauenzimmer wieder auf, und kleineren Kindern verleiht es die früher unentwickelte Kraft, gehen zu lernen.
Wer hingegen die Schwindsucht oder schleichendes Fieber mit in das Bad bringt, der wird seinen Zustand bald verschlimmert fühlen und wohl tun, sich gleich wieder daraus weg zu flüchten.
Ich selber bedurfte des Bades schon oft, um Rheumatismen und Leberbeschwerden zu vertreiben, und habe mich immer am besten dabei befunden, wenn ich meine Kur in zwei Hälften teilte und dieselbe eine Woche im Heumonat und ebensolang im Herbstmonat gebrauchte.
In den Privatbädern wird auch häufig geschröpft, und viele Leute glauben, nichts gehörig vollbracht zu haben, wenn sie nicht die mystische Zahl von sieben oder neun Wundmalen auf dem Rücken mit heimtragen. Sie wähnen damit ihrer Kur das Meistersiegel aufzudrücken. In der Tat leistet diese übrigens ziemlich unangenehme und fast ekelhafte Operation bedeutende Dienste bei Schärfen in den Lymphen, bei rheumatischen Beschwerden, Flüssen und Zahnschmerzen, und nach vorher gebrauchten Bädern desto leichter, weil die Haut weicher geworden und die Schweisslöcher offener sind.
Seit einigen 20 Jahren wird das Wasser auch häufiger getrunken als vor Zeiten.18 Es löst in der Regel viel zähen Schleim im Magen und in den Eingeweiden auf. Man trinkt es entweder im Bad so warm, wie es aus der Röhre fliesst, oder auf- und niedergehend an dem Brunnen im Staadhofe, fängt mit zwei Gläsern an und steigt bis auf sechs oder acht. Allein, es gibt Leute, denen dieses Trinken eher übel als wohl bekommt, weil es manchmal, statt zu eröffnen, verstopft. Man kann zwar, um diese verkehrte Wirkung zu hindern, auflösende Mittel damit verbinden, allein dann wird es durch den Beisatz eine andere Arznei, um derentwillen man nicht nach Baden zu reisen braucht.
Manchen Ärzten ist vielleicht noch nicht bekannt, dass die kleinere Quelle, welche in das Freibad fliesst, vielen Leuten, die vom Trinken aller übrigen Quellen verstopft wurden, Öffnungen verschafft. Ob mehrere Bestandteile sich in verstärktem Mass darin befinden, das mögen die Gelehrten untersuchen. Dem Geschmack nach zu urteilen, scheint sie mehr Mittelsalz zu enthalten. Es gibt aber manche, die vom Trinken auch an dieser Quelle dennoch hartnäckig verstopft bleiben. Die eigentümliche Natur jedes Menschen modifiziert auch bei dieser Anwendung die Wirkungen des Wassers ins Unendliche. Es möchte wohl am besten getan sein, den empirischen Satz aufzustellen: «Wem das Trinken des Mineralwassers zu Baden gelinde Öffnung verschafft, der fahre damit fort, es wird ihm wohl bekommen; wen es aber verstopft, der soll es unterlassen.19
Indes dahle ich in meiner Laieneinfalt wie ein Blinder von Farben und streiche demnach bescheiden meine unbehilflichen Segel vor den Meistern des Stuhles, welchen über dergleichen wissenschaftliche Gegenstände zu sprechen das Recht allein zusteht. Weiss ich doch nur, dass es mir immer unbeschreiblich wohl und behaglich im Bade zumute war, wenn ich ein Glas Wasser nach dem andern einschlürfte, dessen Geschmack, wenn auch etwas salzig, mir nie zuwider war und das mir nach weiten Abendspaziergängen immer den Durst löschte, ohne dass ich zu befürchten hatte, mich durch den Trunk zu erkälten.
Freilich mögen nicht alle Leute gleich fröhlich im Bade sitzen, zumal solche, die viele Wochen hintereinander täglich fünf bis sechs Stunden darin zubringen müssen, um den Ausschlag hervorzulocken. Zum Zeitvertreib für diese rücke ich hier ein witziges Liedchen ein, das der geistreiche Baron von K. gedichtet hat. Man kann es nach beliebiger Melodie singen, und jeder Widerhall einer reinen Stimme klingt doppelt angenehm im Badgewölbe: