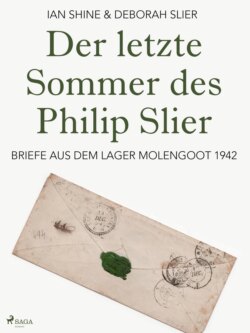Читать книгу Der letzte Sommer des Philip Slier: Briefe aus dem Lager Molengoot 1942 - Deborah Slier - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Judenrat
ОглавлениеIm Februar 1941 stachelten die Deutschen die niederländischen Nazis in Rotterdam, Den Haag und Amsterdam zu Übergriffen auf Juden an. Die Juden setzten sich nach Kräften zur Wehr, und nach einem Vorfall in Amsterdam erlag ein SS-Mann seinen Verletzungen. Daraufhin verhafteten die Deutschen Ernst Cahn und Alfred Kohn, die beiden Besitzer der Eisdiele Koco, von der aus die jüdischen Kämpfer ihre Verteidigungsaktionen lancierten. Am 3. März 1941 wurde Cahn von einem Erschießungskommando unter der Leitung von Klaus Barbie exekutiert. Da die Deutschen nicht hinnehmen wollten, dass auch die andere Seite sich bewaffnete, forderten sie von den Juden die Bildung eines Judenrates, der seine Leute entwaffnen und kontrollieren sowie die Verordnungen der Besatzungsmacht ausführen sollte. Abraham Asscher, der Direktor einer großen Diamantengesellschaft, und David Cohen, Professor für alte Geschichte an der Universität von Amsterdam, führten gemeinsam den Vorsitz. Cohen war Präsident des Flüchtlingshilfsausschusses gewesen, der Juden zur Flucht vor den Nazis verhalf und nach der Reichskristallnacht den Transport von zehntausend Kindern aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei nach England mit Zwischenstation in den Niederlanden mitorganisierte (den sog. Kindertransport). Ins Leben gerufen hatte dieses Projekt Gertrude Wijsmuller, eine nichtjüdische Holländerin.
Asscher und Cohen forderten bekannte jüdische Persönlichkeiten aus verschiedenen Berufsverbänden und religiösen Organisationen auf, im Vorstand mitzuarbeiten, und die meisten waren dazu auch bereit. Der Rat sollte die jüdischen Interessen vertreten und eine Verbindungsinstanz zwischen Deutschen und Juden bilden, da es den Juden verboten war, sich direkt an die deutschen Behörden zu wenden.
Von Anfang an verlangten die deutschen Besatzer vom Rat, dass er für die Einhaltung und Umsetzung aller Bestimmungen sorgte, die in der wöchentlich erscheinenden Zeitung Het Joodsche Weekblad (Jüdisches Wochenblatt) bekanntgegeben wurden, deren Herausgeber, Jacques de Leon, von den Deutschen eingesetzt worden war. Es war dies die einzige zugelassene jüdische Zeitung. Das Blatt schrieb ausschließlich über jüdische Angelegenheiten und das in einer Weise, die der Obrigkeit genehm war. Alle Texte wurden verordnet und zensiert. Man verlangte vom Rat, eine Liste mit den Namen und Adressen aller Juden zusammenzustellen und dafür zu sorgen, dass sich die von den Deutschen angeforderte Anzahl Personen zur Arbeit oder zum »Abtransport nach Deutschland« meldete. Die Deutschen überließen es dem Rat, darüber zu entscheiden, wie er sicherstellen wollte, dass den Anforderungen Folge geleistet wurde. Wenn Asscher und Cohen sich einmal darüber beschwerten, dass die geforderte Anzahl zu hoch war und nicht bereitgestellt werden konnte, erinnerten die Deutschen sie nur an Mauthausen.1 Der Rat bemühte sich, die Auswirkungen der Verordnungen so weit wie möglich abzumildern. Er beschäftigte ca. achttausend Mitarbeiter, die bis auf weiteres von der Deportation freigestellt waren. Außerdem sorgte er dafür, dass für bestimmte Gruppen Ausnahmeregelungen galten, und schuf Hintertürchen. Zudem erleichterte er die Postzustellung und versorgte Bedürftige mit Nahrungsmitteln und Kleidung.
Der Rat verfügte über ein Zentralbüro in Amsterdam sowie über einige regionale Außenstellen, die 1942, als man alle Juden zwang, nach Amsterdam umzusiedeln, geschlossen wurden. Der Amsterdamer Zweig des Judenrates forderte die Menschen dringend auf, den Einberufungsbefehlen Folge zu leisten. Sollten sie sich nicht melden, hätten sie »mit den härtesten Strafen zu rechnen«, ließ er verlautbaren. Der lokale Zweig von Enschede dagegen riet den Juden, den Stellungsbefehlen nicht nachzukommen und in den Untergrund zu gehen. Mit Hilfe eines protestantischen Geistlichen, Pfarrer Leendert Overduin, überlebten 38 % der Juden von Enschede den Krieg, das waren ungefähr doppelt so viele wie der nationale Durchschnitt. Die Vorsitzenden des Judenrates von Enschede waren Sig Menco, Gerard Sanders und Isidoor van Dam. Als die Deutschen dem Warschauer Judenrat im Juli 1942 befahlen, sechstausend Juden täglich zur Deportation auszuliefern, beging der Vorsitzende des Rates, Adam Czerniaków, Selbstmord. Als die Deutschen indes vom Großrabbiner von Athen, Elios Barzilai, verlangten, ihnen eine Liste aller Juden auszuhändigen, vernichtete dieser die Liste und riet seiner Gemeinde zu fliehen oder unterzutauchen. Der Athener Erzbischof Damaskinos gab seinen Priestern die Anweisung, den Juden zu helfen.
Nach dem Krieg fragte Jacob Presser, der Autor von Ashes in the Wind – The Destruction of Dutch Jewry, den deutschen Polizeichef von Amsterdam, Willy Lages:
»Wie wurde der Judenrat benutzt?«
»In jeder nur denkbaren Weise.«
»Fanden Sie die Zusammenarbeit mit dem Rat einfach?«
»Ja, ausgesprochen einfach.«
1946 wurden Asscher und Cohen verhaftet und der Kollaboration mit dem Feind angeklagt. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt und es kam nicht zur Gerichtsverhandlung. 1947 wurde ein jüdisches Ehrengericht (Ereraad) eingesetzt, das Asscher und Cohen wegen Kollaboration mit dem Feind und Beihilfe bei der Identifizierung, Verhaftung und Deportation der niederländischen Juden verurteilen sollte. Das Gericht befand sie für schuldig und gelangte zu der Entscheidung, dass ihr Verhalten in vier Anklagepunkten zu verurteilen und in einem Punkt schwer zu verurteilen war. Bis an ihr Lebensende war es ihnen untersagt, in irgendeiner jüdischen Organisation ein Amt zu bekleiden, ganz gleich ob ehrenamtlich oder bezahlt.
Nach dem Krieg kritisierten L. de Jong und Jacob Presser, beide Experten auf diesem Gebiet, den Judenrat, weil der sich nur um seine eigenen Interessen gekümmert und den Reichen auf Kosten der Armen geholfen habe. Jane Fresco, Bernard Cohens Schwester, sagt, die meisten Leute hätten den Judenrat (Joodse Raad) »Judenverrat« (Joods Veraad) genannt. Professor Houwink ten Cate hingegen, der niederländische Fachmann für den Judenrat, war der Meinung, der Rat habe alles getan, was ihm unter den schwierigen Bedingungen möglich gewesen sei.2