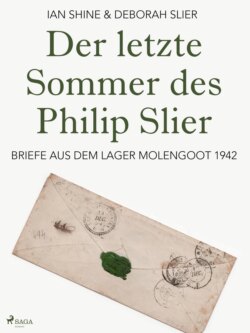Читать книгу Der letzte Sommer des Philip Slier: Briefe aus dem Lager Molengoot 1942 - Deborah Slier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Оглавление1997 stieß Manus de Groot, der Vorarbeiter der Abrissfirma Deegen & Sohn, bei den Abbrucharbeiten eines Hauses in der Vrolikstraat 128 in Amsterdam auf ein Bündel Briefe, das in der Zwischendecke des Badezimmers im zweiten Stock versteckt war. Er nahm an, sie seien wichtig, denn es waren so viele – 86 Briefe und Postkarten sowie ein Telegramm. Sie stammten von Flip (Philip) Slier, der sie 1942 aus einem Zwangsarbeitslager an seine Eltern geschrieben hatte. Er war damals achtzehneinhalb Jahre alt. Manus de Groot nahm die Briefe an sich. Bei der Lektüre konnte er die wachsende Angst des Jungen spüren. Er war zutiefst bewegt. Da er früher einmal für das NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie, das nationale Institut für Kriegsdokumentation in den Niederlanden) gearbeitet hatte, beschloss er, die Briefe diesem Institut zu übergeben, mit der Bitte, ihn über das weitere Schicksal des Jungen und seiner Familie zu informieren und ihm mitzuteilen, ob es Überlebende gebe. Dieses Buch ist die Antwort.
Die Bedeutung der Briefe lag für David Barnow, den Experten für Anne Frank am NIOD, sofort auf der Hand, und deshalb machte er Elma Verhey auf sie aufmerksam, eine Expertin auf diesem Gebiet, Journalistin und Autorin der Bücher Om het Joodse Kind und Kind van de Rekening. Diese stellte Recherchen über den Hintergrund der Briefe an, schrieb sie ab und veröffentlichte einen Artikel dazu in dem niederländischen Wochenblatt Vrij Nederland.
In meinen Besitz gelangten die Briefe dann im Jahr 1999. Damals sagten mir Flips Anspielungen und die Dinge, auf die er sich bezog, rein gar nichts, doch ich wollte ihn verstehen und mehr erfahren, und deshalb habe ich schließlich dieses Buch verfasst. Ich habe mich bemüht, die Menschen ausfindig zu machen und die Umstände neu erstehen zu lassen, unter denen der Junge während der Besatzung der Niederlande durch die Deutschen vor mehr als sechzig Jahren gelebt hat. Und je weiter und tiefer ich mit meinen Nachforschungen vorstieß, umso deutlicher trat mir allmählich Flips Welt vor Augen. Als ich erst einmal Fotografien und Dokumente in den Händen hielt und über Ortskenntnisse verfügte, wurde es für mich leichter, seine Angst zu begreifen und vor allem seine seelische Verfassung, seinen Mut und seinen Optimismus und seine Großherzigkeit wertzuschätzen. Der liebenswerte und bewundernswürdige Mensch, der sich mir erschloss, sollte mir für die kommenden sieben Jahre zu einem engen Gefährten werden.
Ich habe die Briefe nur gering editorisch überarbeitet. Flips Eigenarten in Orthografie und Grammatik, seine Fehler, durchgestrichene Passagen sind nicht beibehalten worden, Hervorhebungen indes werden wiedergegeben, um die Originalaussage der Briefe, ihren Charakter und ihre Form zu bewahren. Die ungewöhnlichsten oder charakteristischsten Teile seiner Briefe – all die »daaags!« [Tschüss], die uns wie ein Barometer seine jeweilige Stimmung verkünden – haben wir gescannt, kopiert und unter die Übersetzungen gesetzt, so wie sie auch unter jedem der originalen Briefe standen.
Wenn einmal eine Korrektur notwendig wurde, haben wir sie in eckigen Klammern hinzugefügt. Erklärungen finden sich in Fußnoten oder im Anhang.
Mein Vater und Flips Vater waren Brüder; beide wurden in Amsterdam geboren. Im Jahr 1922 verließ mein Vater die Niederlande und wanderte nach Südafrika aus, von wo aus er in einem regen Briefwechsel mit seiner Familie gestanden haben muss, denn mir waren die Namen und Gesichter vieler holländischer Verwandter vertraut, deren Fotos die Seiten seines grünen Albums füllten. Ich erinnere mich noch gut an jenen Tag im Jahr 1940, an dem ich aus der Schule nach Hause kam und meine Mutter in Tränen aufgelöst fand, weil die Deutschen in die Niederlande einmarschiert waren. Und ich erinnere mich an eine Postkarte, die uns etwa zwei Jahre später erreichte. Ein Onkel schrieb, er befinde sich in einem Lager, es gehe ihm gut, aber wir möchten doch bitte etwas zu essen schicken. Nach dem Krieg erhielten wir ein Schreiben vom Roten Kreuz, in dem uns mitgeteilt wurde, dass alle Brüder und Schwestern meines Vaters in Konzentrationslagern umgekommen waren und dass meine Großmutter im Lager Westerbork gestorben war. Es war das einzige Mal, dass ich meinen Vater je weinen sah.
Im ersten Jahr nach dem Einmarsch der Deutschen vom 10. Mai 1940 ging das Leben in der Vrolikstraat zunächst seinen gewohnten Gang. Die Deutschen zogen die Schlinge so langsam und so geschickt zu, dass der Vorsitzende des Judenrates, Abraham Asscher, später sagte, bei der Einrichtung des Judenrates im Februar 1941 sei »die Haltung der Deutschen gegenüber den Juden keineswegs offen feindselig gewesen«. A. J. Herzberg zufolge behandelte der Lagerleiter von Westerbork, Oberstleutnant Gemmeker, die Juden im Allgemeinen höflich: »... gelegentlich vermittelte er den Eindruck, als hasse er die Juden nicht mehr als ein Schlachter die Kühe«.1
Ziel der deutschen Politik in den Niederlanden war es, die Küste gegen eine Invasion der Alliierten zu befestigen, das Land in das großdeutsche Reich einzubinden, Nahrungsmittel, Geld und Vermögen zu stehlen, die Niederländer zu Arbeitssklaven zu machen und das gesamte Land von Juden zu säubern. Bis 1942 durften die Juden so gut wie keinen Beruf mehr ausüben. Waren sie dann erst einmal arbeitslos, wurden sie in eines von circa fünfzig Arbeitslagern geschickt, die über die ganzen Niederlande verteilt lagen und die in Wirklichkeit nichts anderes waren als provisorische Gefängnisse. Im Frühjahr 1942 war der achtzehnjährige Flip einer von siebentausend Juden, die in ein niederländisches Arbeitslager eingewiesen wurden. Von dort aus schrieb er fast täglich an Freunde und an seine Familie, und seine Briefe stellen für uns heute einen einzigartigen Augenzeugenbericht über das Leben im Lager Molengoot dar.
Im Oktober 1942 wurden die Lager geräumt. Die Insassen wurden im Durchgangslager Westerbork zusammengefasst, von wo aus die Transporte nach Polen abgingen. Von 1941 bis 1944 wurden circa 104 000 Juden deportiert, 24 000 gelang es indes, sich zu verstecken; sie wurden, wie die Holländer sagen, zu onderduikers, d.h. tauchten unter. Ab 1943 zogen die Deutschen 800 000 nichtjüdische Niederländer zum Arbeitsdienst in Deutschland ein, viele meldeten sich auch freiwillig zur Wehrmacht, doch sehr viele weigerten sich, dem Befehl Folge zu leisten, und tauchten ebenfalls unter. Sie wurden daraufhin von der Polizei steckbrieflich gesucht. Die onderduikers erfuhren Unterstützung von Hunderten und Tausenden ihrer Landsleute, die diesen Fremden bereitwillig Tür, Geldbeutel und Speisekammer öffneten und so ihren eigenen Wohnraum, ihre Privatsphäre und das Essen mit ihnen teilten, und das, obwohl sie härteste Strafen vonseiten der Deutschen riskierten, wenn sie onderduikers bei sich versteckten, nämlich Konzentrationslager oder gar die Todesstrafe. Leider aber befolgten nicht alle das biblische Gebot, »jene zu erretten, so man töten will«, und viele onderduikers wurden verraten. Im Herbst 1944 verhängten die Deutschen als Vergeltungsmaßnahme für einen landesweiten Eisenbahnerstreik eine Lebensmittel- und Brennstoffsperre, durch die 22 000 Menschen hungers starben. Unter diesen Umständen bedeutete ein zusätzlicher Esser eine schwere Last.
Als ich 1953 das erste Mal in die Niederlande reiste, wohnte ich bei meinem Cousin Arthur Philips und seiner Frau Willy (Wilhelmina Magdalena). Wir verstanden uns gut und ich verbrachte die meiste Zeit mit Willy. Wir redeten und redeten, doch der Krieg, der ja erst wenige Jahre zuvor zu Ende gegangen war, bildete nie ein Gesprächsthema. Willy erzählte mir nicht, dass sie und Arthur während des Krieges im Versteck gelebt hatten oder dass ihre drei Schwestern und ihr Bruder umgebracht worden waren. Ja, eigentlich erwähnte sie nie, dass sie Geschwister gehabt hatte, allerdings berichtete sie mir, wie es war, als die Polizei kam, um ihre Mutter abzuholen, die deportiert werden sollte. Willy hatte die Beamten angefleht, auch sie mitzunehmen, doch die hatten sich geweigert, weil ihr Name nicht auf ihrer Liste stand. Erst als ich ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 2005, mit Jules Arthur sprach (Willys und Arthurs Sohn), erfuhr ich, dass Arthur 1940 beim Einmarsch der Deutschen in der niederländischen Armee gedient hatte, dass er von einer Kugel in die Schulter getroffen worden war und deshalb zur Genesung ein Jahr in einem Krankenhaus verbringen musste. Eine der Krankenschwestern dort, Johanna Vink, hatte den Vorschlag gemacht, Minke Honij solle ihn verstecken, was diese auch für die gesamte Zeit des Krieges tat. Willy selber wurde von Johannas Eltern versteckt, doch wie so viele untergetauchte Menschen wechselte Willy unzählige Male das Quartier. Zu den Personen, die ihr Unterschlupf gewährten, gehörte auch eine junge Frau namens Betje Bosboom. Betje wurde bei den Deutschen denunziert und sofort standrechtlich erschossen. Nach dem Krieg heiratete Johanna Willys Bruder, der, in einem Hühnerstall verborgen, überlebt hatte.
In seinen Briefen spielt Flip sein Leid herunter. Aus ihnen erfahren wir, wie seine guten Freunde Karel und Dick van der Schaaf dazu beitrugen, ihm das Leben leichter zu machen. Als Mittelsmänner überbrachten sie Flip und etlichen seiner Kameraden in den Arbeitslagern Nahrungsmittel, Kleidung, Geld, Botschaften und gute Wünsche. Schließlich sollten die beiden selber als Zwangsarbeiter nach Deutschland geschickt werden, tauchten jedoch als onderduikers in Friesland unter. Ich hätte nie geglaubt, dass es für mich eine so große Freude bedeuten würde, Karel und seine Frau Sippy kennenzulernen. Sie strahlten so viel Güte aus, dass ich sie, als ich ihnen 2004 begegnete, sofort ins Herz schloss. Nun konnte ich mir gut vorstellen, was die Van der Schaafs für Flip bedeutet hatten. Seitdem haben wir viele glückliche Tage, ja Wochen miteinander verlebt und über Flip und ihre gemeinsamen Freunde in Amsterdam gesprochen. Karel holte Dutzende von Fotos hervor, und zusammen verbrachten er, Sippy und ich Stunden damit, die darauf abgelichteten Personen zu identifizieren und seine Fotos mit denen aus dem Album meines Vaters zu vergleichen.
Flip schrieb häufig über seine beiden engsten Freunde im Lager, über Nico Groen, der wahrscheinlich nicht überlebt hat (Truus Sant hörte, er sei in Den Haag festgenommen worden), und über Simon Loonstijn, der am 30. Januar 1944 aus Monowitz (einem Nebenlager von Auschwitz) eine Postkarte an Freunde in Den Haag geschickt hatte. Mir war das große Glück vergönnt, die Freundschaft von Simons Schwester Tootje Loonstijn und die ihres Mannes Gerrit Renger zu genießen. Sie waren außerordentlich hilfsbereit, stellten mir all ihre Fotos und Simons Briefe zur Verfügung und berichteten mir viel über das Leben unter der deutschen Besatzung. Sie erzählten mir auch von Professor R.P. Cleveringa und von jenen beiden Lehrerinnen in Amsterdam, M.L. Hoefsmit und C.W. Ouweleen, die zwölf Kinder bei sich versteckt hatten und bei denen einmal ein Nachbar spät in der Nacht an die Tür geklopft und sich beschwert hatte: »Ihre onderduikers machen so viel Lärm, dass meine onderduikers keinen Schlaf finden können.«
Flip, Simon und andere erfuhren großzügige Hilfe von einigen Bauern aus der Gegend, besonders von den Familien Vrijlink und Veurink, deren Hof nur etwa zweihundert Meter vom Lager entfernt lag. 1942 schrieb Greet Vrijlink an die Loonstijns: »... wir können doch nicht danebenstehen und zusehen, wie jemand anders Hunger leidet.« Flip schrieb: »Mama und Papa, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nett die Vrijlinks sind ... sie sind so lieb zu uns ... wie eine Mutter.« Am 27. Oktober 2005 traf ich die Familie Vrijlink und konnte ihnen für all das danken, was sie getan hatten. Es war mir auch eine große Freude, Hermina Vrijlink persönlich zu ihrem 77. Geburtstag zu gratulieren und die Gesellschaft ihres Bruders Seine zu genießen, der sich seit damals, als vor dreiundsechzig Jahren das Foto von ihm und Flip aufgenommen wurde, kaum verändert hat. Es fällt nicht schwer, zu verstehen, wie sehr Flip die Herzlichkeit schätzte, die er und alle anderen Vrijlinks ausstrahlten.
Flip kehrte 1942 nach Amsterdam zu seiner Familie und seinen Freunden zurück, obwohl er das Angebot der Vrijlinks hätte annehmen können, die ein Versteck für ihn gefunden hatten. Möglicherweise hätte er in Nieuwlande untertauchen können, einer kleinen, etwa fünfzehn Kilometer nördlich des Lagers gelegenen Gemeinde, wo ein Freund der Vrijlinks, Pastor Frits Slomp, zusammen mit dem Gemeinderat Johannes Post und dessen Bruder Marinus die Bewohner aufforderte, onderduikers bei sich aufzunehmen.2 Fast jeder Haushalt in Nieuwlande erklärte sich dazu bereit und versteckte einen oder mehrere Juden, insgesamt betrug deren Zahl dreihundert. Wir wissen nicht, wie viele andere Slomps, Posts, Van der Schaafs, Veurinks und Vrijlinks überall in den Niederlanden ebenso gehandelt haben, denn solche Menschen stellen ihr Licht gern unter den Scheffel. Viele Geschichten werden niemals erzählt werden, manch eine Heldentat wird unbesungen bleiben und manche Freundlichkeit keinen Dank erfahren. Ja, wären Flips Briefe nicht gefunden worden, hätten wir auch von dieser besonderen Geschichte niemals erfahren. Doch Manus de Groot haben wir es zu verdanken, dass neben den lauteren, an die Öffentlichkeit gedrungenen Protesten des Studenten Van Hasselt, von Professor Cleveringa, Richter Visser, Erzbischof de Jong und den Hafenarbeitern von Amsterdam auch der Mut einiger weniger Menschen nicht in Vergessenheit gerät (siehe Seite 32 ff.).
Ich habe mich entschlossen, dieses Buch herauszugeben, weil ich das Bedürfnis verspürte, Flips Welt aufzuzeigen und all seine Anspielungen und Hinweise zu verstehen. Was ich dabei nicht voraussehen konnte, war, wie befriedigend es sein sollte, all die Schichten freizulegen und die Einzelheiten, auch die schmerzlichen, aufzudecken. Wie beglückend war es, seinen Fingerabdruck zu entdecken und den Witz über die Barackenfenster zu verstehen oder zu begreifen, warum er wohl drei seiner Briefe nicht unterschrieben hat. Aus mir unerfindlichen Gründen vermittelte es auch eine gewisse Befriedigung, mit eigenen Augen den Heuhaufen zu sehen, in dem er sich versteckt hatte, oder aber das Schreiben, aus dem hervorgeht, dass er in Vught verhaftet wurde. Ich hatte erwartet, dass sein Schicksal und das seiner Freunde und seiner Familie entsetzlich und quälend sein würde, und ich hatte mich nicht geirrt. Immer wieder musste ich daran denken, dass neben Flip auch ich, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und meine Schwester auf den Fotos in diesem Buch zu sehen wären, hätte mein Vater 1922 nicht das große Glück gehabt, arbeitslos zu sein. Es war mir eine große Freude, zu entdecken, wie liebenswert Flip und wie liebenswert seine Freunde waren und noch heute sind. Ich habe ihn kennengelernt, und ich schätze seinen Optimismus, sein Mitgefühl und seinen Humor, und es beglückt mich, dass ihm jeglicher Hass abging und er seine Familie und seine Freunde liebte, ganz gleich, ob diese nun Juden oder Christen waren. Und es freut mich, zu sehen, wie vergnügt er neben der hübschen Tochter der Vrijlinks steht, der er, und damit auch ihrer ganzen Familie, seine aufrichtige Dankbarkeit ausspricht: »Gees können wir gar nicht genug danken!«
Deborah Slier
New York, 2007