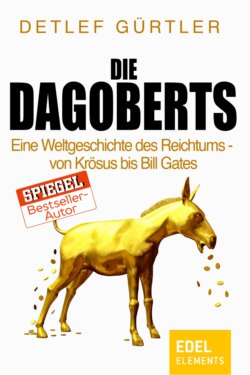Читать книгу Die Dagoberts - Detlef Gürtler - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеChina: der Beamtenstaat
Jeder Grashalm gehört dem Kaiser
Ginge es nach seiner eigenen Rechtsauffassung, kann niemand jemals reicher gewesen sein als der mongolische Großkhan Kubilai, dank seiner ausgiebigen Eroberungstätigkeit seit 1280 auch offiziell Kaiser von China und Begründer der Yüan-Dynastie. Denn dann wäre jeder Grashalm in China sein Eigen gewesen. Der Venezianer Marco Polo (1254-1324), Ende des 13. Jahrhunderts unser Mann in Peking, erzählt davon: »Der gegenwärtige Großkhan hat alle Glücksspiele, denen die Leute dieses Landes mehr als alle anderen in der Welt zugetan sind, streng verboten, und um sie davon abzuschrecken, sagte er: Ich habe euch durch die Gewalt meines Schwertes unterworfen, und folglich gehört mir alles, was ihr besitzt; wenn ihr also spielt, so spielt ihr um mein Eigentum.« Bei damals etwa 60 Millionen Einwohnern in Kubilais Machtbereich würde sich daraus ein Vermögen von fast Dagobert’schen Dimensionen errechnen.
Diesmal ersparen wir uns das Rechenexempel, denn der sehr weit gefasste Eigentumsbegriff wird hier eindeutig eher aus volkspädagogischen Gründen verwendet als zur Durchsetzung eines Rechtsanspruchs. In der Praxis beschränkte sich Kubilai wie die meisten anderen Herrscher auf die Erhebung von Steuern und Abgaben aller Art, um daraus die kaiserliche Hofhaltung, den bürokratischen Apparat und Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren.
Die direkten Einkünfte Kubilais, also die Aufwendungen für den Kaiserhof im engeren Sinne, bezifferte Marco Polo auf zehn bis 15 Millionen Golddukaten pro Jahr. Davon mussten allein im Palastbezirk Pekings bezahlt werden: 12 000 Mann kaiserliche Leibwache, etwa die gleiche Anzahl an Dienern sowie 5000 kaiserliche Beamte - vom Astrologen bis zum Schreiblehrer. Die 25 000 Prostituierten, die Polo in der Millionenstadt Peking zählte, dürften nur zum geringsten Teil direkt aus der Staatskasse bezahlt worden sein.
Die gesamten Staatseinnahmen übertrafen nach den Schätzungen des Venezianers die Ausgaben der Hofhaltung um mindestens das Zehnfache: »Allein aus der Stadt Quinsai1 und den Städten unter ihrer Gerichtsbarkeit flossen dem Großkhan an Einkünften zu: 6,4 Millionen Golddukaten durch die Salzsteuer und 16,8 Millionen Dukaten durch alle anderen Steuern und Zölle.«
Konfuzius sagt: Privater Grundbesitz ist verboten
Doch auch wenn wir Kubilai Khans Eigentumsbegriff nicht so wörtlich nehmen, dass wir alle Schätze Chinas seinem Privatkonto gutschreiben, müssen wir noch einmal auf ihn zurückkommen. Denn er repräsentiert nicht einfach die merkwürdige Vorstellung einer barbarischen Besatzungsmacht, sondern eine seit Urzeiten in China verbreitete Auffassung: Alles Land gehört dem Kaiser. Und diese ist wiederum Ausfluss der sozialen Gesinnung des Konfuzianismus: Die Bibel und der Koran verbieten es, Zinsen zu nehmen – der Konfuzianismus verbietet das Privateigentum an Grund und Boden. Der Herrscher als oberste irdische Autorität kann Lehen vergeben, und die Lehnsherren können Teile ihres Lehens anderen gegen Bezahlung zur Bearbeitung überlassen, aber Grundbesitz selbst ist nicht vorgesehen.
Diese Vorschrift ist natürlich gut gemeint. Die Landwirtschaft stellt das ökonomische Herzstück Chinas dar: »Wenn du die Bauern gewinnst, kannst du Herrscher über alle werden«, schrieb der Philosoph und Konfuzius-Schüler Mencius den Kaisern ins Stammbuch, und die meisten hielten sich daran – einschließlich des roten Kaisers Mao Tse-tung. Jegliche Wirtschaftsordnung, die sich an den Existenzgrundlagen der Landwirtschaft vergriffe, wäre eine tödliche Bedrohung für das Reich, und die Institution des Privateigentums an Grund und Boden könnte durchaus eine ökonomische Dynamik in Gang setzen, die zugunsten einiger superreicher Familien die Existenz von Millionen Kleinbauern gefährdet.
Aber gut gemeint bedeutet mitunter das Gegenteil von gut gemacht. Denn so recht im konfuzianischen Sinn funktionieren kann dieses System nur, wenn es ein zentrales Anliegen des Herrschers ist, die Lebensbedingungen der einfachen Bauern zu verbessern oder zumindest ihre Verschlechterung zu verhindern. Solche wohltätigen Anwandlungen hatten die Kaiser allerdings nicht oft. Und wenn, dann nicht lange. Dafür sorgten im Allgemeinen Hofstaat und Bürokratie, bei deren Mitgliedern es sich definitionsgemäß eben nicht um Bauern handelte. Während der Hofstaat die Probleme der Landbevölkerung möglichst fern vom Herrscher hielt, konnten sich die Bürokraten in der Provinz als fast allmächtige Stellvertreter des allmächtigen Kaisers aufspielen. Trotz des theoretischen Absolutheitsanspruchs des Staates bildete sich dadurch in ganz China eine Klasse von Großgrundbesitzern heraus, deren gemeinsames Charakteristikum darin bestand, dass sie Beamte waren.
Kaufleute wurden diskriminiert
China ist das einzige der großen Reiche der Welt, in dem über viele Jahrhunderte hinweg die reichsten Menschen des Landes der Beamtenschaft angehörten. Warum konnten ausgerechnet Beamte Vermögen anhäufen? Zuerst einmal, weil niemand anders dafür infrage kam:
◇ Private Unternehmer gab es über lange Strecken der Reichsgeschichte praktisch nicht: Die wichtigen Rohstoffindustrien der Eisen- und Salzgewinnung waren verstaatlicht, die Warenproduktion kam trotz der schon früh sehr beachtlichen Einwohnerzahl über das handwerkliche Stadium nicht hinaus.
◇ Militärs spielten gesellschaftlich kaum eine Rolle, denn die humanitären Lehren des Buddhismus und des Konfuzianismus hatten nicht viel für Soldaten übrig. So war die militärische Ausbildung nicht besonders angesehen, es konnte sich keine eigene Kriegerkaste entwickeln. Oft nahmen sogar Nicht-Chinesen die wichtigsten militärischen Funktionen ein.
◇ Händler hatten einen schlechten Leumund: Der Beruf des Kaufmanns war etwa so angesehen wie bei uns der Beruf des Staubsaugervertreters. Unter Liu Pang, dem Begründer der Han-Dynastie (um 250 – 195 v. Chr.), wurde den Kaufleuten sogar verboten, Seide zu tragen – dafür mussten sie unterschiedlich gefärbte Schuhe anziehen, um schon auf den ersten Blick als Händler erkennbar zu sein. Denn während die Erzeugnisse des Bauern der übrigen Menschheit Nutzen und dem Staat Einnahmen bescherten, seien die Kaufleute nur dazu da, von ihren Mitmenschen Profit zu ziehen oder gar ihr Vermögen auf Kosten des Staates zu mehren.
Die chinesische Gesellschaftsphilosophie zementierte solche Wertungen durch einen beruflichen Dualismus. Sie achtete die Tätigkeiten, die fundamental waren (ben), und schätzte all das gering, was es an sonstigen Erwerbsmöglichkeiten gab (mo, Schluss, äußerstes Ende). Nun bestehen in vielen Gesellschaften ideologisch oder religiös motivierte Rangstufen der Berufe. Mal sind, wie im hinduistischen Kastenwesen, die Priester ganz oben, mal, wie in der kommunistischen Ideologie, die Arbeiter. Aber die chinesische Kombination war einzigartig. Ben waren zum einen die Bauern, weil sie den nationalen Reichtum produzierten, und zum anderen die Beamten, weil sie das Funktionieren der Gesellschaft garantierten.
In einem so definierten Beamten- und Bauernstaat blieb sowohl für Kaufleute als auch für Handwerker nur noch mo übrig, weil sie keine eigenen materiellen Werte hervorbrachten. Was die Kaufleute angeht, so gibt es in unseren Breiten am rechten und linken Rand des politischen Spektrums eine ähnliche Position, die zwischen »schaffendem« und »raffendem« Kapital unterscheidet. Aber die Auffassung, dass Handwerker keine Werte hervorbringen, ist uns völlig fremd. Die chinesische Begründung dafür: Handwerker würden nichts Neues schaffen, sondern lediglich bereits Vorhandenes transformieren.
Der Kaiser versenkt die eigene Flotte
Die Geringschätzung jeglicher kaufmännischen Aktivität galt sogar für den Fernhandel, und das, obwohl China stets über begehrte Exportprodukte verfügte. Bis zur Expedition des Offiziers Zhang Qian, der 126 vor Christus bis an die Ostgrenze des persischen Partherreiches vorstieß, hatten die chinesischen Kaiser überhaupt keine Ahnung, auf welche Weise einheimische Produkte das Land verließen und ausländische Produkte nach China hereinkamen. Und auch als sie es wussten, interessierte es sie nicht weiter. Die Warenströme entlang der Seidenstraße flossen zwar nicht gegen den Willen der chinesischen Herrscher, aber doch ohne deren Anteilnahme. Nicht zuletzt auf dieses Desinteresse an Handel und Kulturaustausch geht die Entscheidung der Ming-Kaiser zurück, Mitte des 15. Jahrhunderts die eigene, gerade erfolgreich zurückgekehrte Flotte zu zerstören. Admiral Cheng Ho, der chinesische Kolumbus, war auf sieben Reisen unter anderem nach Java, Sumatra, Ceylon, Indien, Arabien und Ostafrika gelangt – und das nicht, wie die europäischen Entdecker ein halbes Jahrhundert später, mit ein paar Schiffen, die eher Nussschalen glichen: Seine fünfte Reise zum Beispiel unternahm er mit 200 Schiffen und einer Besatzung von insgesamt 27 800 Mann. Gegen solche Konkurrenten hätte ein Vasco da Gama den Kürzeren gezogen; aber als sich die Portugiesen den Seeweg nach Indien erschlossen, hatte sich China bereits wieder von der Entdeckung ferner Welten verabschiedet. Was sollte einem die Welt noch bieten können, wenn man China hatte?
Nun kam es zwar sogar in China gelegentlich vor, dass ein Händler es durch seine Tätigkeit zu Reichtum brachte. Aber dieser Reichtum verhalf ihm nicht automatisch zu einem besseren Image, weil die Reihenfolge falsch war: Ansehen sollte zu Reichtum führen, nicht umgekehrt. Also bemühten sich reich gewordene Kaufleute schleunigst darum, auf die Seite der geachteten Mitglieder der Gesellschaft zu wechseln. Sie legten ihr Vermögen in Grundbesitz an, ergingen sich im Studium der klassischen Literatur, und vor allem: Sie setzten alles daran, einen ihrer Nachkommen in die Beamtenlaufbahn zu katapultieren. Innerhalb von spätestens zwei Generationen verwandelte sich damit ein unternehmerisch gewonnenes Vermögen in einen bürokratischen Status.
Der chinesische Traum: vom Schweinehirten zum Bürokraten
Wer etwas auf sich hielt, wer etwas werden wollte, wer Möglichkeiten zur Bereicherung suchte, ging also in den Staatsdienst. Wenn er denn die Prüfungen bestand. Und die hatten es in sich: Die traditionelle Ausbildung für den Staatsdienst hob auf die Beherrschung der schönen Künste, der Schriften der Ahnen und der Kalligraphie ab. Ob die über mehrere Jahre in immer neuen Examen geprüften Anwärter etwa Fähigkeiten hatten, die sie in ihren zukünftigen Positionen gebrauchen konnten, wurde nicht geprüft, geschweige denn, dass die Vermittlung solcher Kenntnisse Teil der Ausbildung gewesen wäre. Lediglich für Ärzte und Juristen enthielt der Lehrplan auch die Vermittlung von Fachkenntnissen. An den entscheidenden Abschlussprüfungen, deren Fragen vom Kaiser selbst ausgesucht wurden, nahm die Bevölkerung ähnlich regen Anteil wie die Deutschen an der Fernsehsendung »Wer wird Millionär?«.
Die Chinesen zogen sich so über die Jahrhunderte eine Führungsschicht heran, deren Bildungsniveau weltweit beispiellos war – nirgends kam Platons Traum vom Philosophenkönigtum der Verwirklichung so nahe wie in China. Die Chinesen waren stolz darauf, dass ihr System es theoretisch jedem Schweinehirten erlaubte, durch Studium und Begabung bis zu den höchsten Ämtern im Staate aufzusteigen. So wie in den USA theoretisch jeder Tellerwäscher Millionär werden kann.
Faktisch funktionierte das System natürlich anders. Welcher Bauer konnte es sich schon leisten, seinem begabten Sohn mehrere Jahre Literaturstudium zu finanzieren? Für Beamtenkinder hingegen existierten eigene Schulen, die auf die Beamtenlaufbahn vorbereiteten. Es entstand so eine Art Kaste, deren Angehörige es als selbstverständlich ansahen, dass der Staat zwar auf dem Papier dem Kaiser, in der Realität aber ihnen gehörte.
Chinas Robin Hood kämpfte gegen Korruption und Vetternwirtschaft
Selbst wenn ein Kaiser dies ändern wollte, waren ihm die Hände gebunden. Denn wie kann ein Herrscher seinen Willen anders durchsetzen als mithilfe seiner ausführenden Organe, also der Beamten? Und wer würde erwarten, dass diese ihren Amtseid auch dann noch ernst nehmen, wenn sie sich ihre eigenen Privilegien beschneiden sollen?
Dieses Schicksal prägte zum Beispiel die letzten Jahre der Westlichen Han-Dynastie in der Zeit um Christi Geburt. Im Jahre sechs vor Christus wurde ein kaiserlicher Erlass verkündet, der die Größe des Landes, das ein Einzelner besitzen durfte, einschränkte. Aber die Durchführung dieses Erlasses lag in den Händen ebenjener Verwaltungsbeamter mit Großgrundbesitz, gegen deren private Interessen er gerichtet war. Deshalb blieb das Dekret ein totes Papier, bis im Jahre neun nach Christus die Dynastie abgelöst wurde.
Die klassischen Nebeneffekte jeder bürokratischen Organisation, also Korruption und Vetternwirtschaft, machten auch China immer wieder zu schaffen. Es wurde versucht, durch Gesetze gegenzusteuern: Kein Beamter durfte in seiner Heimatprovinz tätig sein, auch ein Posten in der Heimatprovinz seiner Ehefrau war ihm verboten. Außerdem durften nicht mehrere Mitglieder einer Familie hohe Ämter in einer Provinz oder in einer Zentralabteilung innehaben.
Wir dürfen allerdings davon ausgehen, dass sich mit solchen Maßnahmen Korruption genauso wenig verhindern ließ, wie uns das heute gelingt. Wie wenig das tatsächliche Auftreten der Bürokratie mit den hehren Idealen gemein hatte, zeigt sich schon daran, dass auch der traditionelle Volksheld der Chinesen ein Beamter ist. Bao Zheng (999 – 1062) brachte es als unbestechlicher und unbeugsamer Richter und Provinzpräfekt zu Berühmtheit, sein Leben und seine Taten wurden in Büchern, Filmen und Opern verarbeitet. Dabei vereinigt er in sich die Qualitäten von Robin Hood und Sherlock Holmes: Bao Zheng löst die kompliziertesten Kriminalfälle und verhilft dem Gesetz ohne Ansehen der Person zu seinem Recht. Er setzt korrupte Beamte in Serie ab und lässt (natürlich nur in einer Oper) sowohl den Schwiegersohn des Kaisers als auch seinen eigenen Neffen hinrichten, weil das Gesetz es so will. Wenn alle Beamten sich an die Vorschriften gehalten hätten, ohne auf ihren eigenen Vorteil zu achten, hätte China wohl kaum einen solchen Helden gebraucht.
He Shen: Der Favorit des Kaisers beutet das Reich aus
Wie weit es ein Beamter bei der Mehrung seines Reichtums bringen konnte, bewies am Ende des 18. Jahrhunderts ein gewisser He Shen (1750-1799), der Besitzer des größten dokumentierten Privatvermögens der chinesischen Kaiserzeit. He Shen war ein hübscher, begabter junger Mann, als 1775 der vier Jahrzehnte ältere Kaiser Qian-Long (1711-1799) auf ihn aufmerksam wurde. Manche flüsterten damals, der sehr feminin wirkende Jüngling erinnere den Kaiser an ein Mädchen, dem er sich in seiner Jugend zu ungestüm genähert habe und das sich ob dieser Schmach erhängte. Andere flüsterten zurück, dass der Kaiser keinen Umweg über eine solche Erinnerung machen müsse, um sich für einen jungen Mann zu begeistern.
Sei dem, wie es wolle, He Shen errang das blinde Vertrauen Qian-Longs – und nutzte die nächsten 20 Jahre, um das Reich nach allen Regeln der Kunst auszubeuten. Er wurde der höchste Beamte am Kaiserhof, unter anderem zuständig für das Finanzwesen, die Verwaltung des Kaiserhofs, die Innen- und die Außenpolitik. Er erhöhte die Steuern und leitete den Mehrertrag in seine Kasse um, er kassierte Provisionen für jeden staatlichen Auftrag und ließ sich für die Ernennung jedes höheren Beamten bezahlen.
Besonders ergiebig waren dabei für ihn die Ämter der Flussinspektoren. Da diese über den Etat für Hochwasserschutz verfügten, setzte He Shen den Kaufpreis für diese Ämter so hoch an, dass den Inspektoren gar nichts anderes übrig blieb, als sich durch Veruntreuung dieser Gelder zu refinanzieren. Die unvermeidliche Folge: Die Dammbauten entlang dem Gelben Fluss wurden vernachlässigt und konnten der nächsten großen Überflutung nicht standhalten – 1798 brachen viele der Dämme, und He Shens Maß war voll. Solange Qian-Long noch lebte, war sein Favorit zwar in Sicherheit, aber direkt nach dessen Tod wurde He Shen aller Ämter enthoben und vor Gericht gestellt.
800 Millionen Taels (1 Tael entsprach etwa 200 Gramm Silber) habe er so zusammengerafft, befand 1799 der staatliche Untersuchungsrichter. 800 Millionen Taels, das wären 160 Millionen Kilogramm Silber und damit mehr als das Fünfzigfache dessen, was Cäsar an Beute aus Gallien mitgebracht hatte – und auch zehnmal mehr, als die gesamten chinesischen Staatseinnahmen pro Jahr ausmachten. Ganz so viel dürfte es denn doch nicht gewesen sein: Wenn es darum geht, ein Exempel an einem Emporkömmling zu statuieren, kann es schon einmal passieren, dass auch der entstandene Schaden eher exemplarisch als realistisch angegeben wird. Das zeigt sich zum Beispiel am 17. der 20 Vorwürfe, die gegen He Shen zusammengetragen wurden: »Er hat Hunderttausende von edlen Kleidungsstücken«, hieß es dort, wobei das Zahlwort lediglich eine Umschreibung für »viel mehr, als sich für einen Menschen gehört« darstellen dürfte.
Durch die Anklageschrift zieht sich der Vorwurf, He Shen habe den Kaiser an Reichtum übertrumpft. Er besitze »200 Perlenketten, ein Dutzend mal so viele wie im Kaiserhof«, ja, manche Perlen seien sogar »noch größer als die auf der Krone des Kaisers«, und er habe »zahlreiche große Edelsteine, die es selbst im Kaiserhof nicht gab«. Besonders deutlich, im chinesischen Sinn, war der 16. Anklagepunkt: »Seine Amtshüte waren mit großen Edelsteinen geschmückt, was sich aber nicht gehörte.« Und weil sich so etwas nicht gehörte, wurde He Shen selbstverständlich zum Tode verurteilt. Kaiser Jiaqing milderte das Urteil großmütig ab: Der reichste Mensch, den China je hervorbrachte, musste nicht auf den Scharfrichter warten – er durfte sich selbst umbringen.