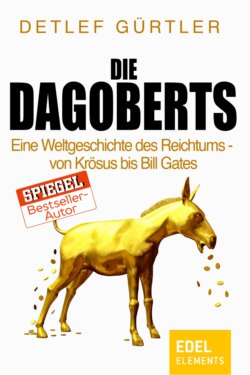Читать книгу Die Dagoberts - Detlef Gürtler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеRom: die Maden im Speck
Für das über tausend Jahre bestehende Römische Reich fiele es weit schwerer, mildernde Umstände zu finden. Die riesigen Geldsummen, die aus dem ebenso riesigen Reich in die Hauptstadt flossen, wurden verschlungen, verschleudert, bestenfalls verbaut. Die Athener erfanden das Theater, die Römer den Gladiatorenkampf. In Athen wurde beim Gastmahl philosophiert, in Rom kitzelte man sich mit einer Feder das Essen wieder aus dem Magen, um Platz für noch köstlichere, noch erlesenere Speisen zu schaffen.
Aber die Römer brauchen keine mildernden Umstände. Sie haben schließlich nie behauptet, es solle für die unterworfenen Völker und Staaten von Nutzen sein, dass sie all ihre Reichtümer dem Moloch Rom in den Rachen werfen mussten. The winner takes it all – dafür stand eben Rom, die größte Ballung von Reichtum, die es bis dahin gegeben hatte.
Die Landmacht aus dem Wilden Westen
Der entscheidende Faktor für diese Konzentration des Reichtums war die militärische Überlegenheit des Römischen Reiches. Es verfügte über disziplinierte Truppen, eine ausgefeilte Logistik und (nicht immer, aber immer wieder) über brillante Feldherren. Rom konnte sich in den Jahrhunderten nach seiner Gründung 753 vor Christus relativ ungestört von den damaligen Großmächten entwickeln, weil es gleich in zweifacher Weise abseits lag. Es befand sich im ökonomisch wenig interessanten Westteil des Mittelmeers, und dort auch noch auf der ökonomisch uninteressantesten Landmasse: Italien verfügte über wenige Rohstoffe, seinen Bewohnern mangelte es an herausragenden Kulturtechniken. Im mittelmeerischen Warenaustausch hatte es also nichts anzubieten, was exportierbar gewesen wäre, und zog deshalb auch keine beutegierigen Eroberer oder gewinnorientierten Fernhändler an – einzig auf Sizilien und in Süditalien gab es ein paar griechische Kolonialstädte. Und die zweite Abseitsposition: Rom lag nicht am Meer. Es war und wurde keine Seemacht, sondern blieb stets eine bäuerlich-soldatisch geprägte Landmacht. In dem Kulturraum, der sich vor allem entlang den zerklüfteten Küstenstreifen des Mittelmeeres erstreckte, war eine Landmacht von vornherein gegenüber den seefahrenden Mächten der Phönizier und der Griechen hoffnungslos im Hintertreffen, man brauchte sich also nicht um sie zu kümmern. Der Gedanke, dass jemand rund um das Mittelmeer befestigte Straßen anlegen könnte, um auf diesem Weg fremde Völker zu erobern, musste damals absurd erscheinen.
Erst im dritten Jahrhundert vor Christus erreichte Rom erstmals eine Stärke, durch die es für eine der Großmächte zur Gefahr wurde: für Karthago, die Seemacht des westlichen Mittelmeers. In den frühen Seeschlachten des Ersten Punischen Krieges (264 – 241 v. Chr.) waren die Römer der Flotte Karthagos noch hoffnungslos unterlegen, sie konnten aber ab 260 vor Christus ihren Nachteil dadurch wettmachen (und schließlich den Krieg für sich entscheiden), dass sie die Enterbrücke erfanden. Damit ließen sich das eigene und das gegnerische Schiff so fest miteinander verbinden, dass sich der Kampf auf See beinahe wie an Land abspielte.
Nach dem verbissenen, am Ende nur knapp gewonnenen Kampf gegen Karthago profitierte Rom bei seinem Aufstieg zur Weltmacht 100 Jahre später von einem zufälligen Aussetzer der Weltgeschichte: Es gab im östlichen Mittelmeerraum gerade kein starkes und selbstbewusstes Reich, das den Kampf gegen Rom hätte aufnehmen können. 500 Jahre früher gab es die Babylonier, 400 Jahre früher hätten sich die Griechen vehement zur Wehr gesetzt, 300 Jahre früher die Perser, und 200 Jahre früher wäre es sehr spannend gewesen, Alexander den Großen gegen ein römisches Heer kämpfen zu sehen. Aber in den zwei Jahrhunderten vor Christi Geburt laborierte der östliche Mittelmeerraum noch an den Konflikten, die aus der Teilung des alexandrinischen Reiches resultierten, sodass dem Auf marsch aus dem wilden Westen kein adäquater Widerstand entgegengestellt werden konnte: Die Schätze (und nach und nach auch die Weisheiten) des Orients wanderten in die Arme Roms, der neuen Supermacht des Mittelmeers.
Die Umverteilung aus dem Reich in die Hauptstadt Rom ruhte auf drei Säulen:
◇ Raub: Frisch unterworfene Länder wurden geplündert, Teile der Bevölkerung versklavt.
◇ Tribut: Staaten und Städte konnten einer drohenden Zerstörung durch Strafzahlungen entgehen. Die regelmäßigen Abgaben gingen entweder direkt an die Staatskasse oder an den Feldherrn, dessen Heer vor den Toren stand.
◇ Steuern und Abgaben: Hier hatte die römische Republik eine Art Doppelbesteuerungsabkommen entwickelt, das ganz ohne weiteren staatlichen Eingriff dafür sorgte, dass alle Gesellschaftsschichten Roms in den Genuss der Reichtümer des Reiches kamen. Und das sollten wir uns einmal genauer anschauen.
Doppelte Steuern für die Provinz, null Steuern für die Hauptstadt
Die erste Variante des Abgabensystems bestand darin, dass die Steuererhebung auf Steuerpächter übertragen und somit privatisiert wurde. Die Steuerpächter entstammten meist dem Ritterstand, also dem niederen Adel. Sie zahlten an den Staat im Voraus eine festgelegte Pacht und bekamen dafür die zeitlich begrenzte Steuerhoheit für eine Region des Reiches. Je mehr sie also an Steuern aus ihrem Gebiet herauspressten, desto höher wurde der Gewinn. Also pressten sie.
Die zweite Variante begünstigte verblüffenderweise gleichzeitig die oberste Schicht, die Patrizier, und die unterste, die Proletarier. Es war die römische Variante der Demokratie. Die höchsten Ämter in Rom wurden jedes Jahr von der Volksversammlung neu besetzt. Wer Quästor, Ädil, Zensor oder Konsul werden wollte, musste also Wahlkampf führen. Und Wahlkampf in Rom hieß: Brot und Spiele. Gratis-Getreide, Gratis-Öl, Volksfeste und Gladiatorenkämpfe, je mehr, desto besser. Der Staat delegierte also die sozialstaatliche Funktion an die Wahlkämpfer – die sich dafür heillos verschuldeten. Aber im Normalfall nur für kurze Zeit, denn die Gewählten bekamen nach ihrer einjährigen Amtszeit die Verwaltung einer Provinz zugewiesen, um mit den Einnahmen aus dieser Pfründe ihre Schulden abzahlen und ein Vermögen ansammeln zu können.
Sicher, es gab Reibungspunkte im System. Das Nebeneinander von Steuerpächtern und Provinzgouverneuren führte häufig zu Reibereien und Prozessen um den jeweiligen Anteil an der Beute. Ciceros Anklage gegen den sizilischen Gouverneur Verres aus dem Jahr 70 vor Christus malt ein plastisches Bild der damaligen Zustände: Von Diebstahl über Erpressung bis hin zum Mord an Einheimischen und sogar an römischen Bürgern reichte die Liste der Vorwürfe. Und die Wahlverlierer, die auf ihren Schulden sitzen blieben, stellten zumindest für ihre Gläubiger ein Problem dar. Einer von ihnen, Catilina, versuchte sogar einen Staatsstreich, nachdem er zum dritten Mal bei einer Wahl durchgefallen war. Aber insgesamt profitierten doch Staat, Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht Roms von diesem Steuersystem, das für die Römer selbst natürlich nicht galt. Es konnte »so viel Geld in den Staatsschatz überführt werden, dass das Volk [Roms] keine Steuern mehr zu zahlen brauchte«, berichtet Plutarch über diese Zeit. Der Rest des Reiches zahlte die Zeche.
Wenn sich Bewerber für Staatsämter haushoch verschulden, muss ja auch jemand da sein, bei dem sie sich verschulden können. Und weil es noch keine Banken gab, gingen diejenigen, die den Wahlkampf nicht von ihrer Familie bezahlt bekamen, mit ihrem Anliegen zu den reichsten Männern der Stadt, also den reichsten Männern der Welt. Diese Geldelite traf eine Vorentscheidung darüber, wer für die politische Karriere tauglich war. Wer nicht finanziert wurde, konnte auch nicht gewählt werden.
Crassus: Roms skrupellosester Unternehmer
Der berühmteste dieser »Königsmacher« war Marcus Licinius Crassus (etwa 115 – 53 v. Chr.), nach Cäsar und Pompeius wahrscheinlich der drittreichste Mann im republikanischen Rom. Sein Vermögen wurde auf 200 Millionen Sesterze geschätzt. Während die typischen Vermögensquellen – neben der Steuerpacht — Großgrundbesitz (altes Geld) und Mietwucher (neues Geld) waren, entsprang Crassus’ Reichtum aus einer ungewöhnlichen und aus einer einzigartigen Wurzel: aus Proskription und Feuerwehr.
Die Proskription war eine im von Bürgerkriegen geschüttelten Rom des ersten Jahrhunderts vor Christus gelegentlich angewandte Methode der Vermögensumverteilung: Die zwischenzeitlich siegreiche Bürgerkriegspartei erklärt die Anhänger der Gegenseite für vogelfrei, beschlagnahmt deren Vermögen und lässt es unter ihren eigenen Anhängern verteilen oder versteigern. Kurzfristig konnten sich dadurch viele bereichern, nur ging dieser blutbefleckte Reichtum unter Umständen schnell wieder verloren – das Bürgerkriegsglück wechselte hierhin und dorthin.
Der Erfinder dieser Proskriptionen war Marius. Er wandte sie 87 vor Christus gegen die Anhänger seines Rivalen Sulla an, der gerade im Orient den Partherkönig Mithridates bekämpfte. Ein Jahr später starb Marius, und als Sulla 83 vor Christus nach Rom zurückkehrte, drehte er den Spieß um: Täglich fand man auf dem Forum Romanum die Namen der Männer angeschlagen, die gerade für vogelfrei erklärt worden waren. 40 Jahre später, während des Triumvirats von Marcus Antonius, Octavian und Lepidus, wurde die Methode noch ausgefeilter. Die Anhänger Marcus Antonius’ (83 – 30 v. Chr.) proskribierten Anhänger des Mitregenten Octavian (63 v. – 14 n. Chr.), der dafür im gleichen Ausmaß Anhänger Marcus Antonius’ auf die schwarze Liste setzte. Und damit es sich nicht zu sehr lohnte, neutral zu bleiben, gaben beide Seiten nach Belieben vermögende Römer jeglicher oder gar keiner Anschauung zum Abschuss frei – auf diese Weise verlor auch Cicero (106 – 43 v. Chr.) sein Leben. Nur wenige konnten sich damals so sicher fühlen wie Gaius Maecenas, der engste Berater Octavians, der an seinem Hauseingang die Notiz anbrachte, dass er sich jede Störung durch Kopfjäger verbitte, da er nicht proskribiert worden sei.
Mit der Feuerwehr zum Millionär
Crassus legte bei Sullas Proskriptionen gegen die Marius-Anhänger den Grundstock seines Vermögens – machte sich dann aber mit einer für die damalige Zeit erstaunlichen unternehmerischen Energie an dessen Vergrößerung. Denn den »Riecher« für Geld besaß er wie kein Zweiter in Rom. Kein Geschäft konnte ihm zu langweilig sein, wenn es nur genug Profit versprach. Nicht umsonst bedachten ihn seine Zeitgenossen mit dem Beinamen Dives, der Reiche. Er war der wichtigste Finanzier des Jahrhunderts, er gebot über eine Vielzahl von mit Sklaven betriebenen Manufakturen für Gebrauchsgüter aller Art – und eben über seine private Feuerwehr, die bis dahin wohl genialste Geschäftsidee der Weltgeschichte.
Die Stadt Rom der späten Republik war zwar bereits ein Moloch, aber einer aus Holz. Die Mietskasernen (übrigens eine Erfindung des Erzfeindes Karthago), die bis zu sieben Stockwerke in die Höhe schossen, waren billige Fachwerkkonstruktionen, jede einzelne ständig vom Einsturz bedroht. Auch dem Immobilienspekulanten Marcus Tullius Cicero (ja, genau der Cicero) stürzte ein Mietshaus ein, und zwei andere waren so wacklig, dass sie von allen Mietern verlassen wurden. Die weit größere Gefahr aber stellte das Feuer dar: Dutzende von Mietparteien auf engstem Raum, jeder hantierte mit offenem Feuer – da war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Brand ausbrach.
Doch die Stadtverwaltung erachtete die Brandbekämpfung nicht als öffentliche, sondern als private Aufgabe. Im Prinzip konnte also jeder, der sich dazu berufen fühlte, als Feuerwehrunternehmer auftreten. Aber Crassus sorgte dafür, dass es vor allem einer tat, er selbst. Und das ging so: Crassus’ 500 Mann starke Feuerwehr war bei jedem Brand schnell vor Ort – böse Zungen sagten, manchmal so schnell, als seien sie schon beim Ausbruch des Brandes dabei gewesen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, die Brandstelle so zu sichern, dass keine anderen Löschtrupps in ihre Nähe gelangen konnten, die Crassus’ Feuerwehr die Preise hätten verderben können. Danach begannen noch lange nicht die Löscharbeiten. Die Feuerwehrleute wurden erst tätig, wenn der Eigentümer sein gerade brennendes Haus billig an Crassus verkauft hatte. Und selbst dann kam es vor, dass dieser sein soeben erworbenes Eigentum noch ein wenig weiterbrennen ließ und mit dem Löschen wartete, bis auch die Nachbarn verkauft hatten; denn wenn ein Haus brannte, wurden meist sehr schnell die Nachbarhäuser und gewöhnlich der gesamte Block von den Flammen erfasst. So besaß Crassus bald ganze Stadtviertel. Zudem verschaffte ihm sein Hausbesitz auf preiswerte Weise großen Einfluss in der Volksversammlung: Seine Mieter wussten auch ohne Brot und Spiele, wie sie abzustimmen hatten.
Mit den so kassierten Multimillionen wurde Crassus eine der zentralen politischen Figuren in den letzten Jahren der römischen Republik. Er hatte mit Bürgschaften sowie 4 Millionen Sesterzen in bar Cäsars Karriere finanziert und bildete dann sogar 60 vor Christus mit diesem und Pompeius (106 – 48 v. Chr.) zusammen ein Triumvirat, das, ganz ohne in der Verfassung vorgesehen zu sein, die Macht im Römischen Reich unter sich aufteilte. Aber obwohl Crassus in diesem Triumvirat zweifellos derjenige war, der am meisten unternehmerisch dachte, war er doch nicht viel mehr als ein Anhängsel der beiden anderen. Denn ein begabter und rücksichtsloser Feldherr konnte in jenen Zeiten ein Vielfaches dessen an Reichtum anhäufen, was ein begabter und rücksichtsloser Unternehmer wie Crassus zu schaffen vermochte. »Wirklich reich ist nur, wer eine eigene Armee hat«, sagte er einmal. Pompeius und Cäsar hatten sie – und dürften beide in Sesterzen gerechnet Milliardäre gewesen sein.
Aber man muss eine Armee nicht nur haben, man muss auch damit umgehen können. Sowohl Cäsar als auch Pompeius waren hervorragende Heerführer. Als Crassus hingegen an der Spitze eines römischen Heeres im Osten des Reiches gegen die Parther kämpfte, half ihm sein unternehmerisches Talent nicht weiter. Der Feldzug endete 53 vor Christus mit einer der verheerendsten Niederlagen der römischen Geschichte, und Crassus’ Leben endete gleich mit.
Ein Jahrhundert später hatte sich nicht nur die Regierungsform, sondern auch die ökonomische Struktur grundlegend gewandelt. Es gab einen Kaiser, und dessen Aufgabe war es nun, das Volk zu ernähren und zu bespielen. Die Wahlkämpfe fielen weg, an ihre Stelle traten Intrigen am kaiserlichen Hof. Und die reichsten Römer waren – ehemalige Sklaven! Was war geschehen?
Maecenas: Gönner und Steuerreformer
Der unternehmerische Ehrgeiz eines Crassus fand in Roms Oberschicht nur wenige Nachahmer. Das Ziel war nicht, Geld möglichst geschickt zu verdienen, sondern es möglichst geschickt auszugeben. Da unterschied sich das Rom des ersten Jahrhunderts nach Christus kaum vom Versailles Ludwigs XIV. So verdanken wir einem Römer der frühen Kaiserzeit den Gattungsnamen für Menschen, die großzügig privates Geld für die Förderung schöner Künste oder des öffentlichen Wohls ausgeben: Gaius Maecenas (69 – 8 v. Chr.). Er hatte seinen Reichtum teils ererbt, teils als Vertrauter Octavians, des späteren Kaisers Augustus, zusammengerafft – und betätigte sich dann als Förderer der Poesie, um dem Förderer seines Vermögens, Augustus eben, eine Freude zu machen: ein Landgut für Vergil, ein üppiger Landsitz für Horaz, finanzielle Sicherheit für die besten Dichter des Reiches, damit sie bleibende künstlerische Werte schaffen und ganz nebenbei noch ein wenig Augustus verherrlichen konnten.
Während die Schützlinge des Maecenas der Nachwelt die erste römische Hochkultur bescherten, die den Namen verdiente, brachte er selbst den zeitgenössischen Untertanen des Reiches eine deutliche Verringerung ihrer Abgabenlast. Denn als Augustus’ oberster Berater setzte Maecenas eine Neuorganisation der Provinzverwaltung durch: Sowohl die Gouverneure als auch die Steuereintreiber wurden verbeamtet und bekamen Gehalt. Danach gab es praktisch keine Klagen mehr über eine Willkürherrschaft der römischen Abgesandten, die Steuerlast wurde sowohl erträglicher als auch kalkulierbarer – das goldene Zeitalter des Augustus erstrahlte nicht nur in Rom, sondern auch in den Provinzen. Das Steuerwesen und die Feuerwehr sind also Belege dafür, dass es der Volkswirtschaft auch einmal nutzen kann, wenn eine bislang privatwirtschaftlich organisierte Branche verstaatlicht wird.
Aus freigelassenen Sklaven werden neureiche Protze
Die reichen römischen Familien machten sich über die Einnahmeseite ihrer Haushaltsrechnung weit weniger Gedanken als darüber, wie sie das Geld möglichst kunstvoll ausgeben konnten. Für Hege und Pflege von Einkommen, Liquidität und Vermögen waren meist Sklaven zuständig – während ansonsten in der Weltgeschichte Sklaven die dreckigen, gefährlichen, harten Arbeiten verrichten mussten, übernahmen sie bei den Römern schlicht alle Arbeiten. Die Finanzsklaven verfügten über eine gute Ausbildung und weit reichende Entscheidungsbefugnisse. Sie waren die eigentlichen Manager der römischen Familienkonzerne. Die besten von ihnen, die Topmanager also, wurden zum Dank für geleistete Vermögensvermehrung von ihrem Herrn freigelassen. Und als Freigelassene konnten sie ihr Können und ihre Kontakte auf eigene Rechnung nutzbar machen.
Die Geschichtsschreibung hat uns weder Namen noch Vermögensaufstellungen dieser neureichen Freigelassenen hinterlassen – es war den Römern nicht so wichtig, wer gerade wie viel Geld in seinem Haus hortete, solange genügend Geld aus den Provinzen in die Hauptstadt strömte. Und dieser Strom versiegte noch lange nicht. Auf uns gekommen ist dagegen ein kleines Fragment einer großartigen Satire auf das Rom der frühen Kaiserzeit. Dieses Satyricon des Petronius Arbiter (27—66 n. Chr.), eines engen Beraters von Kaiser Nero, sprüht von einem boshaften Witz, den man dem Hof dieses Kaisers nicht zugetraut hätte (dass Petronius sich die Pulsadern aufschnitt, als er bei Nero in Ungnade fiel, versöhnt uns wieder mit dem Klischeebild, das wir uns von Nero machen). Aus diesem Werk stammt das »Gastmahl des Trimalchio«. Trimalchio ist eben ein solcher Freigelassener – neureich und stolz darauf. »Mein früherer Herr, er ruhe sanft, wollte, dass ich ein kultivierter Mensch unter kultivierten Menschen werde«, bekennt er der Tischrunde – das hat nicht ganz geklappt. »Mit nichts fing er an und hinterließ ein Vermögen von 30 Millionen Sesterzen. Nie folgte er irgendeinem Philosophen«, lautet sein eigener Vorschlag für seine Grabinschrift. Einer der Gäste vertraut dem Erzähler an: »Trimalchio selber hat Grundbesitz, so weit wie ein Habicht fliegt; Zaster über Zaster.« Weiter: »In seiner Portiersloge liegt mehr Silber, als ein Wohlhabender besitzt. Und erst sein Gesinde! Ich glaube, keine 10 Prozent von ihnen kennen ihren Boss. Kurz und gut, er kann jeden von den schicken Lebemännern hier ins Mauseloch hauen.«
Wie sehr Trimalchio mit seinem frisch erworbenen Reichtum angibt, zeigt sich zum Beispiel daran, dass er mitten im verschwenderischen Gastmahl seinen Buchhalter zum Rapport antreten lässt: An einem einzigen Tag seien auf Trimalchios Besitzungen 30 Knaben und 40 Mädchen geboren, 500 000 Scheffel Weizen geerntet und 500 Ochsen eingefangen worden. Die gesamten Bargeldeinnahmen desselben Tages beliefen sich auf 10 Millionen Sesterze. Selbst wenn wir diese Zahlen nicht ganz so ernst nehmen dürfen (10 Millionen Profit pro Tag wären nach einem Jahr schon mehr, als Cäsar in acht Jahren in ganz Gallien zusammenraubte), sind die Quellen damaligen Megareichtums doch hinreichend klar beschrieben: Großgrundbesitz, Land- und Viehwirtschaft, Finanzgeschäfte. Um industrielle Produktion machten die reichen Römer dagegen einen großen Bogen. Das meiste, was die Stadt benötigte, kam ohnehin aus den Provinzen, und die in Rom ansässigen Manufakturen waren großteils in kaiserlichem Besitz.
Aber auch der Fernhandel spielte eine auf den ersten Blick erstaunlich kleine Rolle. Was allerdings gar nicht mehr überrascht, wenn man die Handelsströme des Reiches betrachtet: Alle Handelsstraßen führten nach Rom, denn nur dort war genügend Kaufkraft vorhanden. Aber keine Handelsstraße führte genau genommen wieder von Rom weg – die Stadt und ihr Umland produzierten nichts, was im übrigen Reich hätte abgesetzt werden können. Jede Lastenkarawane, jedes Handelsschiff musste also für den Rückweg eine Leerfuhre in Kauf nehmen und verlor damit auch die Chance, beim Weiterverkauf dieser Waren einen zweiten Gewinn einzustreichen. Das machte den Fernhandel vergleichsweise unattraktiv und erhöhte die Profitraten der um Rom herum liegenden landwirtschaftlichen Großbetriebe, die wesentlich geringere Transportkosten hatten.
Die Großagrarier verbünden sich mit den germanischen Invasoren
Das Festhalten an der Landwirtschaft als einzig standesgemäßer Einnahmequelle für die herrschende Klasse entsprach durchaus den bäuerlichen Wurzeln des Römischen Reiches. Und während des langen Niedergangs des Reiches ab dem Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts waren die Großgrundbesitzer die meiste Zeit ein Garant der Stabilität. Denn jeder von ihnen herrschte praktisch über einen Staat im Staate. Alles, was sie brauchten, erzeugten sie selbst – und die Städte waren vom Reichtum des Landes abhängig, nicht wie heute umgekehrt. Damit konnte in weiten Teilen des Reiches business as usual betrieben werden, als in Rom im dritten Jahrhundert nach Christus die Zentralgewalt verfiel. Soldatenkaiser kämpften um die Macht, einzelne Armeen versuchten, ihren Feldherrn als Herrscher durchzusetzen, Kaisermord, Putsch und Chaos waren an der Tagesordnung. Selbst die starken Kaiser Diokletian und Konstantin ließen die Stadt Rom links liegen. Diokletian vierteilte 293 das Reich, aber keiner der Reichsteile wurde von Rom aus regiert. Konstantin schuf sich gleich seine eigene Hauptstadt Konstantinopel (ab 330), die mit der Reichsteilung von 395 Hauptstadt des Oströmischen Reiches wurde und später als Istanbul weiter Karriere machte.
Im Weströmischen Reich hingegen kam im vierten und fünften Jahrhundert zur inneren Auszehrung noch die Bedrohung von außen hinzu. Goten, Vandalen und andere Germanenstämme drangen von Norden und Osten in das Reich ein und konnten vom Militär nicht mehr zurückgeworfen werden. In dieser Situation beschleunigte die einseitige Machtfülle der Großagrarier den Untergang des Reiches. Als dem Land Gefahr drohte, verrieten diese bereitwillig den Kaiser, um ihre Güter zu retten, und einigten sich mit den barbarischen Kriegsherren, die sich im Weströmischen Reich häuslich einzurichten gedachten. Man arrangierte sich, gab ein Drittel des Grund und Bodens an die Zugereisten ab und verschwendete weiter keine Gedanken mehr an Rom, von dem man sich auch in den Wirren seit Anfang des dritten Jahrhunderts möglichst fern gehalten hatte.
Das Oströmische Reich baute sich ab dem sechsten Jahrhundert, vor allem in der Regierungszeit Justinians I. (482-565), ein stabileres politisches System auf. Den unzuverlässigen Grundbesitzern wurden die einflussreichsten Posten in der Bürokratie vorenthalten. Stattdessen erhielten Fachleute aus dem Mittelstand diese Ämter – die Dominanz der Juristen im öffentlichen Dienst hat ihren Ursprung im byzantinischen Reich. Sie besaßen, unabhängig von der persönlichen politischen Überzeugung, ein ganz handfestes Interesse daran, sich patriotisch zu verhalten: Bei einem Zusammenbruch des Staates drohte auch die Vernichtung ihrer beruflichen Existenz.
Aber wir greifen vor und haben das Römische Reich schon vernichtet, bevor wir seinem berühmtesten Sohn in den Geldbeutel schauen konnten. Das sollten wir nun schleunigst nachholen.