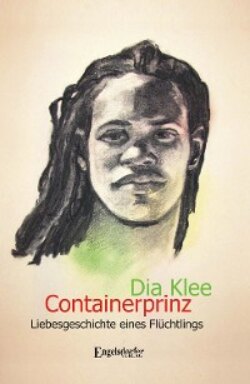Читать книгу Containerprinz - Dia Klee - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einzelgängerin
ОглавлениеEs war eben so, dass Berna durch Dylan aus ihrem Einsiedler-Dasein herausgeholt wurde. Berna war nämlich eine Einzelgängerin, einziges Kind eines umher tingelnden Elternpaares, Schausteller ohne festen Wohnsitz. Während sie meist allein in deren Wohnwagen war, die Eltern auf Tour, gewöhnte sie sich ans Alleinsein und glaubte, das sei das Normale. Diese Gewöhnung führte später, als sie in die Schule kam, dazu, dass sie extrem schüchtern und zurückhaltend war und kaum Kontakt mit anderen Kindern bekam. Niemand bemerkte ihr Problem, weil sie immer bald weiterzogen, und so ging sie damit durchs Leben. Sie war nicht glücklich dabei, hatte keine Freundinnen, wusste aber auch nicht, was oder wie sie es ändern sollte …
So verlegte sie sich aufs Fantasieren und Nachdenken. Auch aufs Angsthaben davor, dass die Eltern von einer ihrer Touren nicht zurückkämen … Lange Abende verbrachte sie so allein. Am meisten aber kamen zu ihr die Größenfantasien: Wie sie, die klein, dick, ungelenk und unbedeutend war, plötzlich groß, schön und bedeutend wäre, wie sie tanzen könnte auf einer Bühne, so schön wie nie ein Mensch getanzt hätte … Auch singen würde sie vor allen, alle wären begeistert … Später, als sie monatelang zu einem Turnverein ging (sie waren einmal so lange an einem Ort geblieben), gab sie in ihren Fantasien die tollsten Artistikvorstellungen. Wie würden alle klatschen und johlen – wie würden sie sie lieben und auf ihren Schultern herumtragen wie eine Heldin! Und das war es ja, was die kleine Berna wollte: geliebt werden. Geliebt für ihre großartigen Darbietungen, für ihre einmalige Leistung. Gab es etwas anderes, wofür man geliebt werden konnte? Oder wofür es sich lohnte zu leben? Berna wusste es nicht, sie kannte nur diese Möglichkeit. Ihre Eltern waren ja Schausteller und bekamen Geld für ihre Vorstellungen. Hieß das nicht, dass sie beliebt – also geliebt! – waren? glaubte Berna als Kind. Aber auch von dieser Art des Geliebtwerdens war sie Millionen Jahre entfernt.
Sie wollte aber wissen, ob es noch andere Arten gab, denn wenn sie andere Familien kennenlernte, schien es ihr so. Sie schienen ihre Kinder anders zu lieben. Aber sie war sich noch nicht einmal klar über die Frage. Es war ein Geheimnis. Und so blieb ihr nur übrig, sehr früh lesen zu lernen, um in den Büchern zu suchen. Sie wollte alles wissen. Schon lange, bevor sie zur Schule kam, lernte sie lesen mittels dem Alphabet, das der Vater ihr aufgeschrieben hatte, und dem einzigen Buch, das im Wohnwagen zu finden war: einer alten Bibel. Ob sie eine Antwort fand? Vielleicht nicht in den Büchern. Tatsache ist, dass ihre Suche nach Liebe – der Wahren Liebe – weiterging, ihr Leben lang.
Bald nach ihrem ersten Container-Besuch bei Dylan fand Berna fast jeden Abend irgendeinen Grund, ihr Haus zu verlassen, um in den Nachbarort zu fahren. Was sollte sie auch zu Hause? Die Kinder im Bett, ihr Gatte studierend und diktierend …
Sie fuhr los ins Nachbardorf, und sowie sie das Haus im Rückspiegel verschwinden sah, war das Champagner-Gefühl wieder da im Bauch, sprang ihr das Abenteuer auf den Schoß, das Abenteuer Liebe, es hatte schon im Wagen auf sie gewartet. Wenn sie Schuldgefühle hatte, verdrängte sie sie sofort. Jetzt war sie dran!
Nur einmal ging ihr am Horizont ihres Schuldbewusstseins eine Ahnung auf, dass es für ihn, den Ehemann, etwas Ähnliches bedeutet haben könnte, dem ewigen Einerlei von Pflicht und Routine für kurze Zeit zu entkommen, mithilfe irgendeiner anderen Frau … Aber sie wehrte diese Einsicht ab mit aller Kraft, denn das hätte ja geheißen, dass es nicht gegen sie gerichtet war, sein – vermutetes – Fremdgehen. Dann hätte sie davon kein eigenes Recht herleiten können. Nein, die Kränkungen saßen zu tief, sie schrieen nach einem Ausgleich. Verständnis hätte ihr diese Möglichkeit zunichte gemacht. Er musste schon weiter als Symbol ihrer Unfreiheit herhalten. Und außerdem – es war einfach so prickelnd, sich wie ein Teenager zu fühlen und keine volle Verantwortung für sich selbst zu tragen.
Nie konnte sie vorhersagen, wie es heute dort sein würde. Meistens war er allein, rauchend und Musik hörend. Manchmal war das ganze Zimmer voller Männer, nicht nur Afrikaner, auch Griechen, die er am Kiosk getroffen hatte und die gar keine Flüchtlinge waren. Ein Kurde. Auch Armenier, Serben. Der Mitbewohner, ein Chinese, war wohl den weitesten Fluchtweg gekommen. Sie alle gehörten nirgends dazu, hatten keine Verwandten in Deutschland. Alle außer dem Chinesen, den sie Tschingtschong nannten, rauchten und tranken Bier. Wenn es Moslems waren, tranken sie meist Wasser aus Dosen, oder Cola. Wozu sie sich trafen, war ihr am Anfang nie ganz klar, denn sie redeten in gebrochenem Deutsch und Englisch unverständliches Zeug, diskutierten Politik, erzählten, was ihnen mit deutschen Behörden passiert war. Ob sie einander verstanden? Sie trafen sich, weil sie niemand anders hatten und auch kein Geld für Kneipenbesuche, aber unbedingt reden wollten. Es musste dieser Informationsaustausch sein, der für alle diese aus der Heimat Fortgelaufenen lebenswichtig war. Der eine wusste von einem freien Job, ein anderer hatte von einer Polizei-Razzia in einem Heim gehört. Sie versuchten, sich in diesem für sie so fremden, ungastlichen, ja bedrohlichen Land zurecht zu finden.
Sie, die einzige Frau, noch dazu Deutsche, wurde trotzdem toleriert, das hieß, kaum beachtet. Aber verstohlene Blicke der Männer verirrten sich zu ihr, heimlich fragend – was wollte sie hier? Was suchte sie, die reife Frau, die Deutsche ohne Probleme, in dieser Elendsbehausung von lauter Menschen am unteren Rand der Gesellschaft?
Naja, es war schon klar, was sie suchte, es war ganz offensichtlich, und das war ihr auch ein wenig peinlich. Aber für sie, die Männer aus den Schwellenländern, die wussten, worauf es ankommt, war es sicher ein Grund, stolz zu sein: Die deutschen Männer schaffen es nicht, ihre Frauen glücklich zu machen. Aber wir, wir Nigger, wir können das!
Eines Tages hatte einer, ein junger Somalier, ein mehrseitiges Formular dabei, was er ausfüllen sollte: ein Antrag zu einer Fahrt außerhalb seines Bezirks. Jedes Verlassen des Gebietes musste genehmigt werden. Nur zweimal pro Monat wurden genehmigt. Lebhafte Diskussion, das Dokument geht von Hand zu Hand, ungläubiges, missbilligendes Kopfschütteln, Lachen, Vortäuschen von Zerreiß-Bewegung. Sie schnappte sich das Papier und füllte es in drei Minuten mit dem Jungen zusammen aus. Name? Adresse? Wohin willst du fahren? Warum? Ausweis? Der Rest sind nur Vorschriften, brauchst du nicht zu lesen. Hier, unterschreib.
Wieder das ungläubige Lachen der Gruppe, diesmal begleitet von respektvollem Nicken. Sie war froh, helfen zu können, froh, wichtig zu sein. Plötzlich war sie wer, und Dylan legte seinen Arm um sie, besitzanzeigend!
Von da an verging fast kein Tag, an dem nicht jemand mit solchen Formalitäten zu ihm kam: Kann deine Frau vielleicht …?
„Deine Frau“ – das ging ihr runter wie Öl. In den Augen der Kumpels gehörten sie zusammen. Auf Anfrage hatte sie einigen der Asylanten einen Job verschafft, den Frauen einen Putzjob, den Männern Gartenarbeit oder ähnliches. Sie gab einfach in der Wochenzeitung eine Kleinanzeige auf mit ihrer Telefonnummer. Wenn Anfragen kamen, sprach sie mit den Auftraggebern und fuhr das erste Mal mit den Bewerbern hin. Meistens klappte es, und sie bekamen den Job. Die Ausländerfeindlichkeit der Leute war gar nicht so groß, wie Dylan immer meinte. Sie brauchten nur eine deutsche Vermittlerin, eine Fürsprecherin.
Bei all dem bekam nun auch er eine Sonderstellung, wurde so etwas wie ein Häuptling. Der Glanz von Bernas Beliebtheit fiel auch auf ihn. Sie würden sich revanchieren, das war so üblich, wenn sie auch selbst nichts hatten.
So schlug ihr, wenn sie jetzt zu ihm kam, schon an der Tür der süßlich-schwere Geruch vom „Gras“ entgegen. Er hatte nun seine Bezugsquellen. Aber war es nicht riskant, hier zu rauchen, praktisch unter den Augen der Obrigkeit?
„Nee, hier kommt keiner her, jedenfalls nicht abends“, beruhigte er sie. „Wenn sie kommen, suchen sie jemand, weil er Schlägerei gemacht oder geklaut hat. Oder einen Illegalen. Oder weil in den Nachbarwohnungen eine Frau und ein Mann sich ankeifen. Im Moment ist aber alles ruhig … Kein Risiko!“
Durch das Rauchen besserte sich scheinbar seine Laune, die in letzter Zeit immer mehr zum Gefrierpunkt tendiert hatte. Und so bekam sie auch wieder mehr von dem, was sie wollte … was nur er ihr geben konnte. Ihr ganz persönliches Suchtmittel.
Eines Abends, als sie in den Container kam, war er nicht da. Auf ihre Nachfrage sagten die Nachbarn, sie hätten ihn schon den ganzen Tag nicht gesehen.
Beunruhigt fuhr sie die kleinen Kneipen und Kioske ab, die sie als seine Stammlokale kannte – nichts! Wieder zum Container, außen ans dunkle Fenster geklopft, aber drinnen rührte sich nichts. Schließlich musste sie einsehen, dass er weg war, einfach weg, ohne ihr oder irgend jemandem etwas davon zu sagen. Die Panik stieg wieder in ihr auf, wie immer in solchen Fällen – Panik, verlassen zu sein, der Geliebte fort, vielleicht für immer, vielleicht abgeschoben von der Behörde? Manchmal ging sowas schnell … Oder vielleicht war er bei einer neuen Frau? Der Gedanke legte sich wie ein Stein auf ihr Herz. Wie wenig wusste sie über ihn, sie vertraute ihm nicht, er war ihr noch immer ein Rätsel.
Aber vielleicht hatte er auch nur seinen Bruder in der nächsten Stadt besucht und dort den letzten Bus verpasst. Sie kannte aber die Adresse nicht, hatte keine Telefonnummer. ,Oh Mann!’ dachte Berna unglücklich, ich kann nichts machen, schrecklich!’
Sie fuhr nach Hause und dachte die ganze Zeit an ihn, voller Unruhe. Durchforschte ihre Erinnerung, ob es irgendeine Andeutung gegeben hatte in den letzten Tagen, etwas, was sie übersehen oder überhört hatte. Aber sie kam auf nichts, und es war dann auch eine schlaflose Nacht, in der sie sich wie verrückt Sorgen machte. „So würde ich mich um eines meiner Kinder sorgen, wenn es plötzlich verschwunden wäre“, dachte sie in einem lichten Moment. Zum Glück lagen beide Kinder schlafend nebenan in ihren Betten, wie sie wusste. Und dieser Gedanke brachte ihr endlich etwas Ruhe.
Am Morgen beim Weckerklingeln war die Unruhe wieder da, die Angst, ihren Lover verloren zu haben. Vor allem die völlige Hilflosigkeit, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, nichts tun zu können, war unerträglich. Berna tat ihre Hausarbeit routinemäßig wie immer, begleitet von der Empfindung kalter und heißer Schweißströme in ihrem Nervensystem, aber dieses Mal war es das Gegenteil von Glück.
Als das Telefon ging, stürzte sie sich darauf:
„Ja, Hallo?“
„Hi, Bi!“, sagte die heisere Stimme am anderen Ende, und Bi fiel fast in Ohnmacht vor Glück, obwohl er noch gar nichts gesagt hatte.
„Wo … wo bist du?“, stammelte sie.
„Oh, ich bin gestern nach O. gefahren, weißt du“, er sprach ruhig und deutlich. „Da ist was passiert. Ich dachte, ich sag dir Bescheid, es kann noch ein, zwei Tage dauern …“
„Was passiert?“, antwortete sie schrill, die Panik stieg wieder hoch. „Was ist denn passiert? Kann ich dir helfen?“
„Nein, dank dir, ich glaub nicht, dass du was tun kannst. Ich brauche etwas Geld, aber das kannst du mir hier nicht herschicken.“ Er lachte kurz auf, sein heiseres Lachen, was bedeutete, er hatte einen Scherz gemacht. Es ging ihm also nicht so schlecht, dachte sie.
„Ich habe hier einen Verwandten, weißt du“, fuhr er fort. „Es ist der Sohn meiner Halbschwester, Molly. Er ist hier in der Psychiatrie. Erst war er bei Dickson, meinem Bruder, mit einem Touristen-Visum für drei Monate. Bevor es ablief, ist er abgehauen, zu einem Freund von mir. Er wollte nicht nach Afrika zurück. Dann hat er dumme Sachen gemacht und wurde von der Polizei geschnappt. Jetzt ist er hier. Er hatte meine Adresse und wollte als nächstes zu mir. Sie haben sich bei mir gemeldet, ich soll mit ihm reden, deshalb bin ich gestern hergefahren …Sorry, gleich ist mein Geld durch, ich ruf später wieder an …“ „Wann kommst du wieder?“, fragte sie aufgeregt, aber da kam schon das ,Klick’ und dann das schnelle Piepsen, und sie wusste, er hatte ihre Frage nicht mehr gehört.
Immerhin. Also in O. war er. Ziemlich weit weg. Ja, von diesem Jungen hatte er ihr erzählt – wenn er das war. Douglas, das uneheliche Kind von Molly und einem Briten, der bald nach der Zeugung verschwunden war, wie so viele aus Sambia verschwunden waren, seit der Unabhängigkeit. Die Mutter hatte das Kind alleine aufgezogen – allgegenwärtiger Alltag in Afrika. Douglas war ein Albino, hatte Dylan erzählt. Ein Junge mit afrikanischen Zügen, breiter Nase, dicken Lippen, aber völlig hellhäutig. Sogar seine Wimpern und Augenbrauen waren weiß. Hellrotblonde „Negerkrause“ auf dem Kopf. Musste als Kind viele Hänseleien der anderen Kinder ertragen. Ein Leben ohne Vater – wie so viele. Er war ein wildes, unerzogenes Kind, das schon früh Probleme machte. Er hörte auf niemanden, lernte nichts in der Schule, schlug sofort zu, wenn jemand ihm komisch kam. Da seine Mutter, Molly, arbeiten musste, gab sie ihn bei der Oma ab, der Einzigen, die mit dem Jungen zurechtkam.
Soso, und dieser Wildfang war also nach Deutschland gekommen. Berna war beruhigt. Alles hatte also einen Grund, und er hatte bei ihr angerufen, um sie zu beruhigen – das war ja schon unglaublich toll, fand sie. Sie glaubte ihm. Erleichtert gab sie sich ihrer täglichen Routine hin. Er würde ihr alles erzählen, wenn er wieder da war.