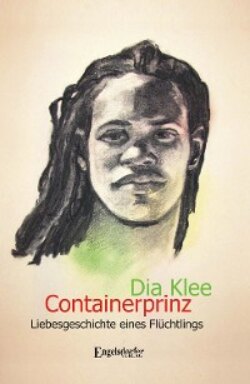Читать книгу Containerprinz - Dia Klee - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hitze
ОглавлениеEr kam nun öfter, das heißt ungefähr jeden zweiten Tag, am Morgen, wenn Berna allein zu Hause war. Seit es angefangen hatte, und auch schon vorher, konnte sie an nichts anderes mehr denken. Sie war wie im Fieber die ganze Zeit, heiße Wellen durchfluteten ihren Körper von unten nach oben, sie hatte keinen Appetit, kein Hungergefühl, wartete auf ihn wie auf Wasser, das ihren unstillbaren Durst löschen sollte. Essen war völlig unmöglich. Etwas Ähnliches hatte sie nie erlebt, noch nicht einmal bei ihrer ersten Liebe mit 13. Das hatte nichts mit den wohlbekannten Hitzewallungen der Menopause zu tun. Oder etwa doch? Es fühlte sich jedenfalls ganz anders an, und es ging auch nicht vorbei. Wie Coca Cola im Blut. Sie konnte nicht klar denken, alles was sie tat, ihre tägliche Routine – zum Glück gab es sie, alles das, was sie tun musste und seit Jahren tat – nahm sie wie in einem Nebel wahr. Wenn die Kinder ihr etwas erzählten, musste sie sich zwingen, darauf einzugehen, denn meist hörte sie gar nicht zu. Ein qualvoller Zustand – nur warten, überleben, bis er wieder da war, bis es wieder stattfand, das, was sie immer gesucht hatte.
„Am Ende meines Lebens finde ich den perfekten Liebhaber!“ hatte sie überwältigt zu ihm beim ersten Mal gesagt. Und das Wunderbare war, er, der viel Jüngere, ließ sich anstecken von ihrer Liebe, erwiderte sie, gab sich völlig hin, gab alles, was er konnte.
Aus der Gartenarbeit wurde erst einmal nichts mehr, die ließ sich damit nicht vereinbaren. Außerdem regnete es ohne Unterlass. Er wollte aber trotzdem arbeiten, klar, er brauchte das Geld – nicht nur die Liebe. Aber – war er so erschöpft oder so unkonzentriert? – er rutschte auf dem nassen Gras mit der Schubkarre aus, fiel hin und brach sich den rechten Mittelfinger.
Da war dann natürlich Pause mit allem. Berna musste ihn zur Notaufnahme fahren. Er bekam seine Hand in Gips, trug sie in der Schlinge, und konnte nicht mehr arbeiten. Er blieb in seinem Container und kam auch nicht einmal zu ihr. Berna litt entsetzlich. Sie brauchte ihn dringend, für diese berauschenden Stunden in dem kleinen Gartenzimmer … Die Gartenarbeit war ihr auf einmal nicht mehr wichtig. Sie überlegte, ob sie ihm nun den Verdienstausfall ersetzen müsse. Damit er wenigstens keinen finanziellen Nachteil hätte. Wie sollte sie damit umgehen? Und vor allem: wie konnte sie sich seine Gesellschaft verschaffen?
Nach drei Tagen hielt sie es nicht mehr aus und fuhr am Abend, die Kinder waren im Bett, unter einem Vorwand weg, fuhr nach H., ging zum Container. Zwar war sie noch nie dort gewesen, aber sie wusste genau, wo das war. Klopfte an der Eingangstür, lange und laut, bis jemand aus der ersten Wohnung kam. Ein Mann, schwarzhaarig, großer Schnurrbart, im Trainingsanzug, öffnete. „Bitte, wo wohnt Dylan“, fragte sie schüchtern. Da hinten, zeigte der Schnurrbärtige, breit grinsend mit dem Daumen über die Schulter, letzte Tür links. Irrte sie sich, oder hatte sie ein kleines Augenzwinkern bei dem Mann gesehen?
Ein langer, schmaler Gang, Linoleumfußboden von undefinierbarer Farbe. Zehn Türen links, acht Türen rechts, wohl wegen der Bäder. Fast unlesbar, abgeblättert, ein D auf der einen Tür, auf der anderen ein H. Den ganzen Gang entlang ein Geruch von stark gewürztem Essen, von Fußbodenreiniger und Zigarettenrauch.
Sie klopfte also hinten links. Ein schwaches „Yes“ von drinnen, hinter der einst blau gewesenen, abgenutzten Tür. Sie öffnete und sah.
Zwei Doppelstockbetten. Auf dem vorderen Bett unten, gleich rechts hinter der Tür lag er, angezogen, niemand sonst im Zimmer. Reggaemusik lief halblaut in einem kleinen Kassettenradio auf dem Fensterbrett. Das Zimmer mit der Küchenzeile – ein totales Durcheinander von ungespültem Geschirr, vollen Aschenbechern, herumliegenden Kleidern und Schuhen. Ungeordnete Papiere auf dem einzigen Tisch, einem niedrigen Couchtisch. Einen ziemlich hoffnungslosen Eindruck machte das alles.
Sie hatte erwartet, hatte gehofft, er würde sich freuen, sie zu sehen, doch als sie in der Tür stand, reagierte er kaum. Er sprach nicht, lag nur teilnahmslos da und starrte an die Decke. „Hi Dylan!“, sagte sie zaghaft und kniete sich an sein Bett. „Hi“ erwiderte er heiser, ohne sie anzusehen.
„Wie … Wie geht’s dir?“
Statt einer Antwort hob er die rechte Hand mit dem Gips ein wenig in die Höhe, ließ sie kurz vor ihrem Gesicht stehen und dann zurückfallen auf seine Brust.
„Es tut mir so leid“, flüsterte sie und ließ sich auf den Fußboden vor seinem Bett nieder, weil er ihr auf dem Bettrand keinen Zentimeter Platz machte. Er zuckte mit den Schultern und sah an ihr vorbei in den Raum. Während sie seinem Blick ins Nirgendwo folgte, überlegte sie fieberhaft, was sie sagen könnte, was ihn trösten würde. Und versuchte zu verstehen, was eigentlich los war.
„Kann ich dir irgendwie helfen?“, fiel ihr ein zu fragen. „Hast du heute schon was gegessen?“
„Nicht wirklich“, seufzte er nun und schien zu sich zu kommen. „Ja, du könntest mir was machen. Da sind ein paar Eier auf dem Regal …“
Sie sprang auf, froh über die Aufgabe. Das würde ihr Zeit geben, sich etwas zu überlegen. Und sie konnte ihm ihren guten Willen zeigen, und dass sie ihn nicht hängen ließ. „Wo ist denn eine Pfanne …“, sah sie sich etwas ratlos um.
„Em – sorry! Ist alles benutzt!“, er klang etwas patzig. „Ich konnte nicht spülen, weißt du!“
„Oh, ja – natürlich!“
Und sie machte sich erst mal ans Geschirrspülen. Heißes Wasser gab es aus dem Boiler. Aber einige Töpfe wirkten, als seien sie seit Monaten nicht gespült worden.
Stumm schrubbte sie seine Töpfe und die Pfanne, keiner von beiden sprach.
„Oh, Berna, weißt du was?“, sagte er schließlich aus seinem Bett. „Könntest du mir vielleicht etwas Tee machen? Die Schachtel ist auch dort auf dem Regal. Ich hab heute noch keinen gehabt …“
„Kein Problem!“, sagte sie mit einem Lächeln in seine Richtung, spülte den Heißwasserbereiter aus, füllte neues Wasser ein und drückte den Knopf. Ja tatsächlich, zu all dem brauchte man zwei Hände, sagte sie sich. Und fühlte sich schuldig an seinem Unglück.
Dann waren die Eier gebraten, der Tee aufgegossen, und sie sah sich nach einem Tablett um, ihm die Sachen ans Bett zu bringen … Die Kratzspuren auf dem undefinierbaren Fußboden sagten, dass man den Tisch jeweils dahin zog, wo man ihn brauchte. Also vor sein Bett. Sie half ihm hoch.
Aber als dann der Teller vor ihm stand, merkte sie, dass er ja nicht schneiden konnte. Hilfesuchend sah er sie an, und da nahm sie Messer und Gabel und schnitt ihm alles in kleine Stücke (,Wie für ein Kind’, dachte sie mitleidig, aber leicht genervt), die konnte er mit der Gabel mit Links aufpieksen … Und die ganze Zeit wurde sie von einer heimlichen Panik behaust: Der Panik davor, dass Schluss wäre, dass er sie nicht mehr wollte, nicht mehr kommen würde …
Er trank seinen Tee, in sich gekehrt, und sprach nicht. Sie lächelte ihn fragend an, und als er nickte, räumte sie das Geschirr weg. Er schien das alles selbstverständlich zu finden.
„Wo ist dein Mitbewohner?“, fragte sie von der Spüle her. Sie wusste, dass er nur einen hatte.
„Der? Keine Ahnung! Er ist öfter mal ein paar Tage fort. Er ist Chinese, arbeitet in einem Chinarestaurant in der Küche. Wenn es spät wird, schläft er dort, glaube ich.“
Es war die längste zusammenhängende Rede von ihm während der ganzen Stunde, seit sie hier war. Danach verstummte er wieder und sank auf sein Bett zurück, vor sich hinbrütend. „Könntest Du mir noch einen Gefallen tun, Berna“, sagte er mit mühevoll heiserer Stimme, „und die Kassette umdrehen?“
„Ja, sicher“, sagte sie und ertappte sich bei dem Gedanken, WIE krank er eigentlich sei und was er vielleicht selber … Dann drückte sie auf Start, und Burning Spear krächzte weiter seine einfachen Reggae-Songs. „Africa must be free!“, ertönte es beschwörend und monoton in vielen Wiederholungen aus dem Apparat. Ratlos saß sie nun neben ihm auf dem Bett. Was sollte sie sagen?
„Also, ich geh dann mal“, meinte sie nach einer Weile resigniert, weil sie nichts mehr zu tun fand und er keinen der Gesprächsfäden von ihr aufnahm. Sie beugte sich über ihn, um ihn zu küssen.
„Hey, warte!“, sagte er plötzlich und öffnete mit der linken Hand seinen Hosenknopf. „Zieh runter!“, befahl er ihr heiser, während er liegen blieb. „Schließ die Tür ab!“ Als sie von der Tür zurückkam, ragte sein schwarzer Joystick aus der offenen Jeans auf. Damit hatte sie nicht gerechnet, und wie hypnotisiert zog sie ihre Sachen aus.
„Komm, setz dich drauf“, lockte er jetzt und zog sie mit seiner gesunden Hand zu sich. „Pullover auch ausziehen. Alles!“
Sie gehorchte. Sie setzte sich, spürte ihn und stöhnte … Einen anderen Willen hatte sie nicht. Und sie versank.
„Du darfst hier nicht schreien!“ flüsterte er, die Linke auf ihrem Hinterteil, „die hören hier alles …“
„Du bist gerade rechtzeitig gekommen“, sagte er hinterher, während sie sich an seine Seite schmiegte, „Ich war so down. Ich dachte, hab ich nun eine Freundin oder hab ich keine? Ich meine, du bist die Frau eines andern …“
„Was?“, sagte sie verblüfft, denn sie hatte noch nie darüber nachgedacht, dass das ein Problem sein könnte. „Aber ich hab dir doch gesagt, dass zwischen uns nichts mehr läuft!“
„Tja, sagen kannst du ja viel!“ Er lachte auf, kurz und hart. Glaubte er ihr nicht?
„Was kann ich tun, um es dir zu beweisen?“, fragte sie, denn sie verstand immer noch nicht, worauf er hinaus wollte.
„Kuck mal, Berna“, begann er. Und dann machte er ihr klar, wozu er nach Deutschland gekommen war, nämlich um Arbeit zu finden. Aber dass er durch das Asylgesetz keine Arbeit bekam, oder nur Jobs, für die es keine deutschen Bewerber gab und wo man miserabel verdiente, z. B. Kloputzer in Autobahn-Raststätten, oder eben Schwarzarbeit. Und dass es für ihn nur zwei Möglichkeiten gab, etwas zu finden: Entweder, als Asylant anerkannt zu werden – wobei er jederzeit in eine andere Gegend geschickt werden könnte. Oder, eine deutsche Frau zu heiraten und einen deutschen Pass zu bekommen. Und weil das beides gleich schwierig oder unmöglich war, dachte er seit einiger Zeit daran, zurück zu gehen, zurück nach Hause, nach Sambia.
„Ich bin jetzt seit bald drei Jahren in Deutschland“, sagte er. „Drei Jahre Warten, in denen ich nichts erreicht habe, außer hier und da einen illegalen Gelegenheitsjob. Ich bin jetzt jung und kräftig, ich kann jetzt arbeiten. Ich könnte es und will es. Ich will kein Geld vom deutschen Staat. Ich will nur das Recht zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen. Aber genau dieses Recht habe ich hier nicht. Ich darf nicht arbeiten, die Jobs werden für die Deutschen und höchstens ihre Gastarbeiter – Türken und Griechen – reserviert. Ich muss in meinem Container sitzen, bekomme Einkaufsgutscheine fürs Essen und ein Taschengeld. Ich werde bezahlt dafür, dass ich nichts tue! Aber so, dass ich kaum leben kann. Ich gehöre nicht dazu. Als ich das begriffen hatte, hab ich damals einen Stuhl genommen und ihn durchs geschlossene Fenster nach draußen geworfen, solche Wut hatte ich!“
Er hatte sich in Rage und erneute Verzweiflung geredet und schüttelte ratlos den Kopf. „Ich weiß auch, wenn meine Gerichtsverhandlung jemals stattfindet, werden sie mich nicht als Asylant akzeptieren. Sambia hat keinen Bürgerkrieg, keinen Krieg mit den Nachbarn. Sie werden sagen, es gibt keine Gefahr für mich dort. Wie es wirklich ist, was interessiert es die Beamten! Ob in Afrika ein Nigger mehr oder weniger abgemurkst wird oder verhungert – wen interessiert das? Keinen!“ Er schnaubte empört.
„Und deshalb weiß ich, die einzige Möglichkeit für mich ist, eine Deutsche zu heiraten, so wie mein Bruder, der hat es schlau gemacht. Oder eine Frau, die mir die Papiere gibt, wie wir sagen.“ Er merkte, dass Berna ihn mit großen Augen verständnislos ansah.
„Ich meine eine Scheinehe, weißt du“, erklärte er. „Eine unverheiratete Frau verheiratet sich auf dem Rathaus mit dir und du gibst ihre Adresse als Wohnsitz an. Danach kannst du gehen, wohin du willst, du hast nichts mehr mit ihr zu tun. Natürlich musst du ihr etwas Geld geben dafür … Es heißt, so zehn- bis fünfzehntausend Euro. Wenn du Glück hast, auch weniger. Aber dann bist du frei, bekommst Aufenthaltsrecht und kannst arbeiten. Naja, ich habe kein Geld … Deshalb muss ich eben eine richtige Ehefrau finden. Dann könnte ich auch meinen Sohn herholen … ich habe ihn drei Jahre lang nicht gesehen! Du hast zwei Kinder. Kannst du dir vorstellen, von ihnen drei Jahre lang getrennt zu sein? Ein Jahr? Ein halbes? Nein, so geht das nicht weiter. Ich muss heiraten, ich will arbeiten. Oder nach Hause gehen.“
Er sah sie an, wie um Verständnis bittend. Berna hatte schweigend zugehört, und währenddessen wuchs ihre Angst. Es gab also nichts, was sie tun konnte? Sie würde ihn verlieren! Er würde fortgehen, oder eine andere Frau haben … Nein, das durfte nicht sein.
„Ich könnte mich scheiden lassen“, bot sie an, aber es hörte sich für sie selbst unwahrscheinlich an, sowie sie es ausgesprochen hatte. Scheiden lassen? Und was wird mit den Kindern? Alles aufgeben … Ging das überhaupt?
„Glaubst du das?“, fragte er skeptisch. „Ich glaube das nicht. Kuck mal, du hast alles, was man haben kann. Ich habe nichts. Was für einen Job geben sie denn einem Nigger, selbst wenn er arbeiten darf? Ich könnte dir gar nichts bieten, wenn wir verheiratet wären, kein Haus, kein Auto. Hätte ich Arbeit, müsste ich meine Mutter und mein Kind in meinem Heimatland unterstützen. Das ist ja das Problem, eine Frau, die mich heiratet, muss für sich selber sorgen können. Ich kann nicht für dich sorgen, und für deine Kinder schon gar nicht. Du kannst nicht so verrückt sein.“
„Doch!“, sagte Berna eigensinnig. „Du glaubst, ich habe alles, aber das sieht nur von außen so aus. Ich lebe im goldenen Käfig. Mein Leben gehört meinem Mann, ohne ihn bin ich nichts. Ich habe keine Würde …“
Wo hatte sie das gelesen, schoss es ihr durch den Kopf: ,Eine verheiratete Frau hat keine Würde, keine unabhängigen Gedanken. Sie ist eine Unterabteilung im Denken ihres Ehemannes, und er kann ihr ganzes Denken und Fühlen elend machen, wenn er will, so wie wenn Tinte in Wasser gegossen wird.’ Ja richtig, Iris Murdoch, The Black Prince. Selten hatte sie sich so verstanden gefühlt. Sie hatte sich die Stelle herausgeschrieben. Jetzt fiel ihr der merkwürdige Bezug des Buch-Titels zu ihrer derzeitigen Lebenssituation mit einem schwarzen Prinzen auf.
„Ich brauche dich, Dylan, allein komme ich da nicht raus“, sagte sie mit ihrer leisen, bittenden Stimme. „Mein Leben ist verpfuscht, mit der Ehe bin ich in eine Falle gegangen und bin darin hängen geblieben wegen der Kinder. Ich diene bloß, während Werner seine wichtigen Dinge tut; ich weiß gar nicht, ob ich noch was Eigenes machen kann. Ich bin ausgebrannt, nichts macht mir mehr Spaß. Werner hat mal gesagt: Ohne mich müsstest du putzen gehen! als ich mich beschwert habe. Wer weiß, vielleicht hat er recht. Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich muss da raus. Erst seit ich dich habe, macht das Leben wieder Spaß.“
Zweifelnd schaute Dylan sie an. „Wenn du Afrikanerin wärest, würdest du anders denken“, behauptete er. „Du wärest froh und stolz, einen so reichen Mann zu haben, in einem solchen Haus zu wohnen, die Kinder zur Schule schicken zu können und jeden Tag drei Mahlzeiten zu haben. Das alles hast du! Ich weiß nicht, was du an mir, einem armen schwarzen Gauner, findest …“ Er unterbrach sich. „Doch! Ich weiß schon!“
Er warf den Kopf zurück und lachte sein heiseres, selbstbewusstes Lachen und seine Augen blitzten auf einmal: „You love the animal in me!“