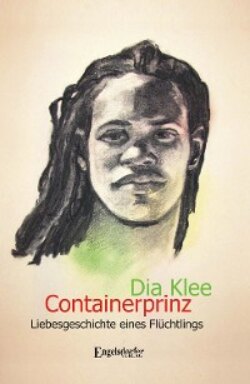Читать книгу Containerprinz - Dia Klee - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drogenboss
ОглавлениеAuch tagsüber waren sie jetzt öfters zusammen unterwegs; er ließ sich umherchauffieren, und sie genoss die Gelegenheit, in seiner Nähe zu sein. Es war gut, dass dieses Jahr völlig verregnet war, an Gartenarbeit war nicht zu denken.
„Können wir einen Freund besuchen?“, hieß es dann oft, und sie fuhr ihn quer durch den ganzen Kreis. Sie kamen nach W., eine dieser kleinen, engen Städte in den engen, kurvenreichen Flusstälern, wo es immer düster und feucht war und die alten Sandsteinbauten außen braunes Moos angesetzt hatten. Hier war das Asylantenheim in einer ehemaligen, leerstehenden Schule eingerichtet. Die großen Schulzimmer waren mit Rigipsplatten in lauter kleine Zellen unterteilt worden, die höher als breit waren.
Dort besuchten sie Choox, einen Nigerianer. Choox war ein echter Illegaler; er gab nicht preis, wie er es geschafft hatte, nach Deutschland einzureisen und, ohne gefasst zu werden, schon mehrere Jahre lang zu überleben. Er lebte „unsichtbar“ in diesem und vielen anderen Asylantenheimen. Kannte alle Landsleute, und wo ein Bett in einem der Zimmer frei war, blieb er so lange, bis es belegt wurde. Er hatte nichts außer ein paar Kleidern in einer Reisetasche. Aber wenn jemand Gras, Koks oder anderes Dope brauchte – Choox konnte alles beschaffen, er kannte alle Quellen und brachte die richtigen Leute – Kunden und Dealer – zusammen. Er war nett, ausgesucht gekleidet und rasierte sich jeden Tag. Von Rastazöpfen hielt er gar nichts. Man musste möglichst unauffällig sein. Er war ein absoluter Vertrauensmann für seine Kunden und auch für die Dealer, denn jeder konnte sicher sein, dass er dichthielt, weil er kein Interesse hatte, mit Autoritäten in Kontakt zu kommen.
Wenn ein Geschäft zustande gekommen war, erhielt er vom Dealer seine Provision, und davon lebte er. Er hatte auch selbst einen kleinen Vorrat von Drogen aller Art angelegt und sie in diesem Heim hinter einer losen Kachel im Bad aufbewahrt. Nur für den Verkauf. Er selbst konsumierte nichts davon.
Leider war dieser hübsche und wertvolle Vorrat gestern einer Polizei-Razzia zum Opfer gefallen.
Sie hatten Hunde mitgebracht, die auf verschiedene Drogen dressiert waren, und die Hunde hatten das Versteck aufgespürt. Zum Glück war Choox gerade nicht „zuhause“ gewesen („my home“, wie er das Heim breit grinsend nannte). Er hatte einen siebten Sinn, der ihn hinaustrieb, wenn Polizei ins Haus stand. Nun war er zurückgekommen, für ihn war es Winter, und man konnte nicht draußen schlafen. Er saß auf der untersten Etage eines Dreifach-Hochbetts und hatte eine Wolldecke um sich gehängt. „Ich habe Angst“, sagte er auf Englisch, denn Deutsch konnte er fast gar nicht. „Sie werden wiederkommen. Sie wollen wissen, wer das Zeugs versteckt hat. Sie haben alle Jungs aus dieser Etage mitgenommen, aber sie können ihnen nichts beweisen. Darum werden sie wiederkommen. Was soll ich bloß machen!“
Dylan und Berna sahen sich an. „Du kannst bei mir im Container bleiben“, meinte Dylan. „Das eine Zimmer gegenüber ist frei.“ – „Wow!“, meinte Choox mit erleichtertem Grinsen. „Du bist ein echter Freund, Dylan. Ich wusste, dass Du es bist!“ Er stand auf, zog Schuhe und Jacke an und holte eine kleine Reisetasche unter dem Bett hervor. „Sollen wir?“, strahlte er.
Unterwegs erfuhr Berna seine Geschichte, wie er aus Nigeria geflüchtet war, weil er als Bote von zwei Drogenbossen kleine Seitengeschäfte gemacht hatte. Von so großen Mengen fällt schon mal was auf die Erde, oder hinter einen Busch, sagte er, und wenn man später vorbeikommt, hebt man es natürlich auf. Man lässt es nicht verkommen. Wenn man die kleine Menge dann gleich verkauft, merkt es keiner, und Geld stinkt nicht. Aber mit der Zeit merkten sie doch, dass öfter ein Teil fehlte, und dann fiel der Verdacht auf ihn. Eines Tages lehnte eine Machete außen an seiner Wohnungstür. Eine Kriegswaffe! Das war eine Warnung. Er musste schleunigst außer Landes gehen.
Manche hier behaupteten sogar, er selber, Choox, sei ein Drogenboss, ein „druglord“ gewesen. Welche Ehre! Er grinste. Nein, er war niemals reich. Jedenfalls, mit dieser Geschichte im Hintergrund könnte er sich nicht als Asylsuchender in Deutschland melden, wusste er. Da würde sich das Ausländeramt totlachen!
Was Dylan im Container die „Versorgung“ nannte, war also durch den sogenannten Drogenboss Choox so gut wie gesichert.
Dylan schwelgte in dichten Wolken, ließ sich von Berna eine gelb-grün-rot-schwarze Rastamütze häkeln und hörte nun ständig und immer seine Reggae-Kassetten, wenn Berna ihn besuchte. Burning Spear, Bob Marley und andere. Wenn er bekifft und gut drauf war, hielt er ihr manchmal einen seiner Jah-Rastafahri-Vorträge, und sie hörte ernsthaft zu, denn sie respektierte jedermanns Religion, wenn sie auch noch so kraus und unverständlich war.
Dann hatte er immer öfter keine Zeit, und wenn sie nachfragte, wich er aus und sagte: „Wir fahren Sachen sammeln.“ „Sammeln – und was?“, wollte sie genau wissen, denn sie verstand nicht.
„Naja, Fernseher, Kühlschränke und so. Alte Sachen, zum Verkaufen.“
„Was? Sperrmüll willst du verkaufen? Wer kauft denn sowas? Das sind doch meistens kaputte Sachen, lohnt sich das denn?“
„Ja, doch, das geht, weißt du! Ich schicke das nach Afrika. Dort brauchen die Leute dringend diese Sachen. Wir haben dort keine eigene Produktion. Wir reparieren die Sachen und verkaufen sie dort für ziemlich viel Geld. In Afrika können sie alles reparieren, weißt du!“
„Gut, ich komme mit sammeln. Wir können es in mein Auto tun. Und dann, wohin damit?“
„Wir stellen alles in mein Zimmer, weißt du. Wenn ich viele Sachen habe, kommt ein Freund von mir aus B. mit meinem Lkw, dann laden wir alles ein und schicken das Ganze mit dem Schiff nach Afrika.“
Ihr kam das unwahrscheinlich vor, ziemlich fantastisch, aber sie machte mit – zum Teil, weil sie damit wieder bei ihm punkten konnte, wie sie glaubte …
Aber zum anderen Teil, weil da auf einmal eine Aufgabe war, ein sinnvolles Ziel, das ihren Vorstellungen von Wiederverwertung entgegenkam. Und war nicht auch wieder ein neues Abenteuer dabei? Etwas, was eine Frau ihres Standes normalerweise nicht tat. Nur arme Leute taten das, Flohmarktleute. Bald sah sie überall an Straßenrändern Fernseher und Kühlschränke liegen, die sie früher gar nicht bemerkt hatte. Die lud sie dann im Schutz der Dunkelheit ins Auto und brachte sie getreulich zu ihm – wie eine Frage stellte sie das Gerät vor ihn hin. Und manchmal – selten eigentlich – erhielt sie die erhoffte Antwort. Dann drehte er den Zimmerschlüssel um, knipste das Licht aus und zog sie in sein schmales Jugendherbergs-Bett …
Während jener bewegten Tage hatte sie noch eine Überraschung für ihn. Sie hatte eine Kleinanzeige in der Wochenzeitung geschaltet:
„SUCHE SCHWEISSGERÄT“ stand da.
Als sie telefonisch drei Angebote bekommen hatte, fuhren sie zusammen hin. Das dritte Gerät befand sich in einer alten Werkstatt in einem Hinterhof.
SCHWEISSEREI stand in verblasster Schrift außen auf dem dunkelgrauen Holzgiebel. Beim Eintreten sahen sie, dass hier nicht mehr viel gearbeitet wurde. Viel herumliegendes Material, Holz, rostiges Eisen, undefinierbar, verrottend. Ein älterer Mann im blauen Kittel über dem Bierbauch, öffnete diese Schuppentür und schaute neugierig den schwarzen Mann von oben bis unten an, der da vor ihm stand. Wortlos führte er beide nach hinten. „Hier, wenn Sie das gebrauchen können,“ meinte er, auf eine kleine, kompakte Maschine deutend, in Größe einer Propangasflasche, die auch noch dabeistand. „Heute schweißen alle elektronisch. Autogenes Schweißen ist unmodern. Geht aber noch gut, Sie können’s gern probieren!“
Ein zufriedenes Leuchten geht jetzt über das schwarze Gesicht. Er nimmt die zwei Blechteile, die ihm der Mann gibt, legt sie vor sich auf die staubige Stahl-Werkbank und schaltet das Gerät ein. Ein Zischen ertönt, und vorn am Brenner kommt eine blaue Flamme zum Vorschein. Dylan streift die Handschuhe über, nimmt mit der einen Hand die Schweißmaske vor sich, die andere führt langsam den Brenner am Metall entlang, um es zu verschweißen. Wenige Minuten, dann ist es gelungen. „Können aber gut schweißen!“, nickt der Mann im blauen Kittel anerkennend.
Sie werden sich einig; Berna hat Dylan vorher taktvoll den Umschlag mit den Scheinen zugesteckt, so dass er selber bezahlen kann.
„Wie hat er in der kurzen Zeit bemerkt, dass du gut schweißen kannst?“, fragt Berna, nachdem sie das Schweißgerät im Kofferraum untergebracht haben.
„Ach, weißt du, der Brenner macht beim Arbeiten ein ganz bestimmtes Geräusch, so ein spezielles Prickeln. Einer, der sich auskennt, hört, wenn es genau das richtige Geräusch ist, wenn die Temperatur und der Abstand und alles genau richtig sind. Das hat er eben gehört. Ich bin so froh, dass ich meine Fähigkeiten noch nicht verloren habe! Du weißt nicht, was das für mich bedeutet, Berna! Du bist ein Engel! Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen nach Hause!“
Erst da wurde ihr bewusst, dass sie beide schon voll dabei waren, seine Heimreise vorzubereiten. Sie hatten nicht weiter darüber gesprochen, aber es war der Pfad, den beide wie selbstverständlich verfolgt hatten, die einzige Alternative auch für ihn, etwas zu tun und endlich für sein Leben aktiv zu werden. Dafür musste er die Gefahr, die ihm vielleicht in Sambia drohte, hinnehmen. Aber ihre Beziehung …?
„Ich kann kommen, Dylan. Ich werde kommen, so schnell wie möglich.“ Ohne sich über die Reichweite ihres Versprechens im Klaren zu sein, hatte sie die Worte ausgesprochen, so, wie sie aus ihrem Herzen kamen.
Und die ganze Zeit über führte sie zu Hause dieses Doppelleben, spielte die brave Hausfrau und Mutter, tat – zwar mit großer Anstrengung, aber unauffällig – alles wie gewohnt, besorgte den Haushalt, die Gartenarbeit, die Hausaufgaben mit den Kindern. Aber sie hatte sich verändert. Merkte Werner nicht, was mit ihr vorging? Sah er nicht, wie sie aufgeblüht war, wie sie sich viel jugendlicher anzog, gradezu sexy! Und vor allem, bemerkte er nicht, dass er nicht mehr gefragt war? Jahrelang hatte sie versucht, ihn für sich zu interessieren – vergeblich! In seiner Gegenwart fühlte sie sich immer unzulänglich und uninteressant, ja, dumm und töricht. Und sie hatte das Gefühl, dass sie für ihn, seit die Kinder auf der Welt waren, nur noch so etwas wie eine Mutter war. Und mit Mutter hat man keinen Sex, die ist nur zum Bemuttern da.
Oder … war da doch eine andere Frau? Was war mit den vielen Überstunden bei Hausbesuchen, bei den nächtlichen Ausflügen zu Patienten, die ihn riefen? All das überblickte sie nicht, und zu kontrollieren wäre unmöglich gewesen. Oder vielleicht gab es andere Frauen für ihn auf diesen Fortbildungskongressen? Das war wahrscheinlich. Genau wusste sie es nicht, aber irgend etwas musste es ja sein. Sein vollkommenes Desinteresse im Bett … Einmal hatte sie einen Zettel in einer Jacke gefunden, die er auf einem solchen Treffen getragen hatte – „Marina“ stand darauf und eine auswärtige Telefon-Nummer. Früher hatte sie so etwas bekümmert. So nötig, wie sie selbst Zuwendung und Zärtlichkeit gebraucht hätte – und stattdessen vergnügte er sich mit anderen! Jetzt hatte sie aufgehört, sich für seine Geheimnisse zu interessieren. Sie hatte selbst eins – es lebte im Nachbarort.
Nur war ihr geheimnisvoller schwarzer Prinz in letzter Zeit immer weniger für sie da. Oder wenn er da war, ignorierte er sie oft. Sie wurde nicht schlau aus ihm, war gekränkt, wollte sich aber nichts anmerken lassen. Einmal sagte er ihr, sie solle nicht so oft kommen, der ganze Container würde schon über sie beide reden, ihn im Scherz fragen, wann denn die Hochzeit sei und so weiter. Das versaue ihm die Laune, weil, wie sie ja wisse, von Hochzeit nicht die Rede sein könne.
Berna hörte sich das an, und ihre Angst wuchs. Was sollte sie machen? Sie würde ihn verlieren. Irgendwann würde er eine Frau finden, die er heiraten konnte. Schon jetzt schwirrten sie doch um ihn herum, die kleinen Mädchen, die er überall kennen lernte. Alle wollten ihn haben.
Dann dachte sie daran, dass er bald nach Afrika zurückgehen würde. Er würde sich dort mit den Sachen, die er von Deutschland mitbrachte, selbständig machen, sich sein Leben aufbauen. Sie konnten sich dann gegenseitig besuchen – ja, das wäre besser als hier dieses elende Leben als geduldeter Asylbewerber. Nein, die Mädels hier würden ihn nicht bekommen … Aber sie selber auch nicht, wurde ihr schmerzlich bewusst, und sie verdrängte den Gedanken sofort. Später, später … jetzt war es noch nicht soweit, irgendwie würde schon alles gehen.