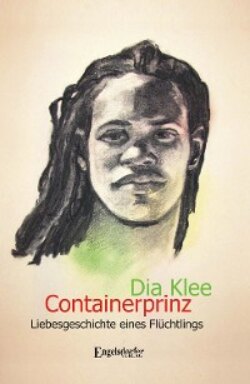Читать книгу Containerprinz - Dia Klee - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gärtnern
ОглавлениеSie rumpelte mit ihrem Kombi über die Landstraße, ein Schlagloch am anderen. Der Winter war wieder heftig gewesen, der Asphalt durch Frost, Streusalzwasser und wieder Frost aufgebrochen. Es war Frühling, und sie würden die Straße nicht in Ordnung bringen vor Mai, Juni.
Sie wich wieder einem Loch aus. Die Straße sah wirklich nachkriegsmäßig aus! Gut, dass hier kein Verkehr war, in dieser abgelegenen Gegend. Hier kamen nur Einheimische hin. Aber was war das dort vorne? Eine dunkle Gestalt auf der anderen Straßenseite. Da geht einer – läuft an der Straße entlang! Das war kein Jogger. Langsam trabend, die Arme im Laufrhythmus baumelnd – wo hatte sie sowas schon mal gesehen? Ach ja, in einem Dokumentarfilm. Irgendwelche Savannenbewohner jagten auf diese Art ein Gnu. Sie waren ausdauernder als das Tier, lösten sich ab im Laufen, kamen von allen Seiten, liefen tagelang so hinter ihm her, und irgendwann gab das Gnu dann auf. Fiel einfach erschöpft zu Boden, so schnell es auch sonst lief. Darauf hatten sie gewartet und konnten es einsammeln.
Sekundenlang hatte Berna ein Déjà-vu, es legte sich auf sie wie die Ahnung eines Traums, der sie oft im Schlaf heimsuchte – ein Traum von einer weiten flachen Landschaft, die Erde ockerrot, ockerfarben auch die kastenförmigen kleinen Häuser ohne Fenster, überragt von hohen, fremden Bäumen, die Schatten spendeten … der Geruch von Hitze. Dort war sie schon oft endlos umhergeirrt, rastlos suchend. Ein flirrend-rötlicher Schleier legte sich über die westfälisch-grüne Landschaft … und hauchschnell, wie er gekommen war, löste er sich wieder auf – eine Fata Morgana. Nur das Gefühl war geblieben – ein Gefühl des Widererkennens.
Im Näherkommen sah sie, dass die Gestalt am linken Straßenrand schwarz gekleidet war, auch der Rucksack auf dem Rücken war schwarz. Auf dem Kopf hatte sie – er? – etwas wie eine hohe, schwarze Mütze, die hin und her schaukelte beim Gehen. Erinnerte entfernt an den Höcker eines Dromedars in Bewegung. Nur eben schwarz. Nun fuhr der Kombi langsam vorbei. Berna sah neugierig hinüber, und die Gestalt schaute zurück. Beider Blick begegnete sich eine Sekunde lang, und sie erschrak ein bisschen. Dann war sie vorbeigefahren. Das Gesicht, das sie angesehen hatte, war auch schwarz.
Das einzige, was sie erkannt hatte, waren die weißen Augenbälle in einem runden Gesicht.
Ein wenig wunderte sie sich noch, was ein Schwarzer hier zu Fuß auf einer Landstraße im südwestlichen Westfalen machte. Wo er wohl hinwollte? Dann bog sie in ihre Straße ein zu dem Dorf, in dem sie mit ihrer Familie lebte. Als sie vors Haus fuhr, hatte sie die schwarze Gestalt schon vergessen und dachte nur noch an ihre Hausfrauenpflichten. Essen kochen. Gleich würden die Kinder aus der Schule kommen.
Zehn Minuten später klingelte es an der Tür. Komisch, sie hatte die Kinder ja gar nicht gehört. Sonst redeten sie immer laut, bis sie ans Haus kamen. War früh dran heute, der Schulbus.
Aber es waren nicht die Kinder, sie sah es durchs Türfenster. Es war ein Fremder. Es war der Schwarze von der Landstraße. Wieder erschrak sie. Was wollte der denn? Jetzt, so aus der Nähe, sah sein Gesicht viel weniger schwarz aus. Plötzlich dämmerte es ihr: Das war der Mann, der sich auf die Anzeige gemeldet hatte!
„Suche Mann, der gärtnern kann“, hatte sie auf einen Zettel gereimt und den in ihrem Bäckerladen in der Kreisstadt ausgehängt. Und noch am selben Tag hatte das Telefon geläutet, und jemand am anderen Ende sagte mit rauchig-melodiöser Stimme und fremdländischem Akzent: „Ich bin ein Mann, der gärtnern kann!“
Und hier war er also.
„Oh, Sie sind das! Sie kommen wegen dem Job, stimmt’s? Ich hab’ Sie eben auf der Straße gesehen. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich Sie natürlich mitgenommen!“ Sie war etwas verlegen. „Ich glaubte, Sie kämen mit dem Bus …“
„Macht nix!“, meinte er freundlich, „Ich bin es gewohnt, zu laufen! Bus ist teuer! Dylan mein Name.“
„Guten Tag, Herr Dylan! Kommen Sie rein!“
„Excuse me – Dylan ist mein Vorname!“
„Oh! Alles klar!“
Berna war etwas durcheinander; sie war eine sanfte, nachgiebige Frau, die immer versuchte, sich der Situation anzupassen. In Gedanken versuchte sie jetzt, sich klar zu werden über den Ablauf. Die rauchige Stimme verwirrte sie.
Wenn sie auch froh war, dass ein Gärtner mal zu ihnen raus kam – gerade jetzt kam dieser hier etwas ungelegen. Das Essen stand auf dem Herd, die Kinder mussten gleich da sein. Keine Zeit, den Garten zu zeigen.
Was sollte sie machen? „Wollen Sie mit uns zu Mittag essen?“ fragte sie höflich, was blieb ihr auch anderes übrig. Sein rundes Gesicht rundete sich noch mehr in einem breiten Lächeln.
„Oh, ja, sehr freundlich, vielen Dank!“
„Sie sprechen gut deutsch! Woher kommen Sie?“
„Sambia“, antwortete er bedächtig, „Lusaka. Bin jetzt bald drei Jahre hier.“
Für sie war Sambia nur ein Name, der Name eines unbekannten Landes. Und der seiner Hauptstadt vermutlich. Afrikanische Geographie – so fremd wie die des Mondes, dachte sie. Wollte sich aber nichts anmerken lassen. Fremd fand sie auch, dass er seine große Mütze im Haus anbehielt. Darunter schien ein umfänglicher Wuschelkopf zu stecken.
Die Kinder kamen. „Das ist Dylan, sagt hallo!“ – „Hallo, ich bin Sina“ – „Ich Boris. Bist du echt aus Afrika?“
„Ja, und ich habe dort sogar einen Sohn!“, antwortete Dylan nachdenklich, während er die beiden fröhlichen hellhäutigen und blonden Kinder musterte.
„Und warum hast du ihn nicht mitgebracht?“, wollte Sina wissen. „Oh – das ist nicht so einfach!“, sagte er mit einem traurigen Lächeln seines breitlippigen Mundes. „Das … ist eine lange Geschichte!“
„Erzählst du sie uns?“, fragten beide wie aus einem Mund. Sie liebten Geschichten über alles.
„Vielleicht später“, lächelte er wieder. Seine großen, mandelförmigen, etwas schräg stehenden Augen glänzten wie die einer Gazelle.
Während des Essens bombardierten ihn die Kinder mit Fragen über Afrika. Und Berna hoffte insgeheim, dass er sich als Gärtner genau so gut machen würde wie als Kinderunterhalter.
Am besten fing er gleich an mit dem Gärtnern, auf Probe sozusagen. Arbeit gab es genug.
Dylan war einverstanden. Dummerweise fing der Regen fast gleichzeitig mit ihm an. Und was für ein Regen! Große Tropfen, und er hörte auch nicht auf, ein richtiger Landregen. Nun ja, es war Frühling, es musste auch regnen.
Er machte trotzdem weiter, Beete waren zu hacken. In wenigen Minuten war sein schwarzer Parka schwer vor Nässe, und das Gesicht unter der dicken Mütze triefte.
Als die Hacke zerbrach, kam er ins Haus.
„Sorry!“, meinte er, die beiden Teile vorzeigend. „Ich bin einfach zu stark!“
,Na, ob das ein gutes Omen ist?’ dachte sie, sagte aber: „Der Boden ist zu schwer bei der Nässe. Da ist wohl heute nichts zu machen.“
Sie gab ihm ein Handtuch und sah bei der Gelegenheit, als er seine Mütze abnahm, dass der schwarze Wuschelkopf aus dicken Dreadlocks bestand. Lauter gedrehte, verfilzte Haarsträhnen – ein Rastamann! Wo hatte sie so eine Haartracht schon gesehen? Ach ja, bei irgendwelchen Hippies auf Ibiza … Seine gedrehten Locken fielen nach dem Trocknen schulterlang herunter. Er sah abenteuerlich aus, dabei groß gewachsen, athletischer Körperbau. Berna, die klein und zierlich war, musste etwas zu ihm aufsehen. Eine Aura von Melancholie umgab ihn, die sie rührte, aber auch ein gewisses hoheitsvolles Gehabe, so, als hätte er es eigentlich nicht nötig, zu arbeiten.
Irgendwie hatte sie ein komisches Gefühl im Bauch, als sie ihrem spät heimkehrenden Ehemann Werner am Abend sagte: „Wir haben einen neuen Gärtner. Es ist ein Schwarzer, aus Sambia.“
„Ist okay!“, nickte Werner, geistesabwesend wie immer, wenn sie ihm etwas von Haus und Garten erzählen wollte. Falls sie ihm den Namen des Gärtners sagte, würde er ihn sofort vergessen. Werner aß sein spätes Mittagessen, fragte, was es sonst Neues gebe, und ging dann, ohne auf ihren knappen Bericht einzugehen, nach oben in sein Arbeitszimmer, um Arztbriefe auf Band zu diktieren. –
Später würde sie nicht mehr genau wissen, wie es dazu gekommen war. Sie sah ihn nicht oft, er tauchte unregelmäßig auf, fragte vorher telefonisch an, ob es Arbeit gäbe. Oft vergingen Wochen, bis er sich meldete, und erreichbar war er nicht. Aber wenn er kam, versuchte sie, auch irgend etwas im Garten zu tun, und dabei redeten sie. Meistens über Sambia und über sein Leben in Deutschland. Sie erfuhr, dass er im benachbarten H., einem kleinen Ort, im Container wohnte. Diese Container waren in letzter Zeit an allen möglichen, meist abgelegenen, Stellen aufgeschlagen worden. Dort beherbergte das Land seine Asylbewerber. Wo sollte man auch so schnell richtige Wohnungen für so viele Flüchtlinge hernehmen?
Oder war es eher so, dass der Container etwas war, was je nach Bedarf leicht verladen und wegtransportiert werden konnte – mitsamt den Menschen? dachte sie, ging diesem Gedankengang aber nicht weiter nach.
Es war gut, zu reden – einfach mit jemand, der da war, zu reden. So lernten sie sich allmählich kennen. Sie war ja meist allein, direkte Nachbarn gab es nicht, zu groß war das Gelände, zu weit draußen auf dem Land. Viele Stunden des Morgens waren die Kinder in der Schule, zu viele, wie Berna fand. Die Schule machte sich heutzutage dermaßen wichtig. Wann hatten Kinder denn mal noch Freizeit?
Abends dann, wenn der vielbeschäftigte Landarzt, ihr Ehemann, im Haus war, die Kinder längst schliefen, war sie wieder allein. Er sprach dann mit seinem Diktaphon, diktierte Untersuchungsberichte seiner Hausbesuche, und las Fachzeitschriften. Hatte er Rufbereitschaft, ging öfter das Telefon. Währenddessen besorgte Berna das Haus, die tausend Sachen, die es eben zu tun gab, angefangen vom Einräumen der Spülmaschine bis zum Reißverschluss-Reparieren von Anoraks und dem Tischdecken für den nächsten Morgen.
Hatte sie dann gegen 23 Uhr alles erledigt und setzte sich zu ihm ins Wohnzimmer, um noch einige Dinge zu besprechen, sagte Werner gähnend hinter seiner Ärztezeitschrift: „Jetzt müssen wir aber schlafen gehen!“
Und das taten sie dann auch. Er legte seinen Kopf aufs Kissen, atmete ein paarmal tief durch und schlief. Berna aber schlief noch lange nicht. Sie lag jede Nacht wach und dachte nach über alles, was sie wieder nur den Kindern hatte erzählen können.
All ihre Gedanken über die Welt, all die Beobachtungen, wenn die Kraniche übers Haus nach Norden flogen, zeitig dieses Jahr. Alle die Fragen zur gemeinsamen Lebensführung: Ob sie ein Schaf anschaffen sollten, um die große Wiese nicht immer mähen zu müssen. Die Kinder wären begeistert. Aber ein Schaf könnte nicht allein sein, es sind ja Herdentiere. Also zwei dann, einen Stall hätten sie ja. Und wer würde die Wolle scheren. Oder doch besser Ziegen? Aber wie dann noch in Urlaub fahren? Und wann würde der überhaupt dieses Jahr stattfinden, sie müssten doch bald buchen … Und Sina war mit ihrer Posaune zur Big Band in der Stadt angemeldet, da kam sie abends spät zurück, jemand müsste sie abholen, der Bus fährt nicht mehr um die Zeit … Boris wollte zum Judo …
Berna nahm ihre Aufgaben als Mutter sehr wichtig, für sie war es selbstverständlich, ganz für die Familie da zu sein und nicht ihre Kraft in irgendeinem Job aufzureiben – darin waren sie sich beide einig. Sie war überhaupt ein solch ernsthafter Mensch. Und sie hatte auch einen ernsthaften Menschen geheiratet, der seinen Beruf ganz ernst nahm. Zwei Nachkriegskinder, die durch die Armut ihrer Eltern früh gereift und bereit waren, viel Verantwortung zu übernehmen. Und sich hoch gearbeitet hatten.
Obgleich Berna in letzter Zeit öfter Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit hatte, was ihre Ehe anging. Er blieb oft überlange in der Praxis. Er fuhr auch öfter auf Kongresse. An ihr als Frau schien er schon lange kein Interesse mehr zu haben. Seit ungefähr zehn Jahren schon nicht mehr. War das normal in seinem Alter? Hatte sich ihr Sexappeal abgenutzt? Zugegeben, im Alltag gab sie sich keine große Mühe, sich herzurichten. Sie schminkte sich selten, weil sie meinte, Naturschönheit sei schöner als Kunstschönheit. Sie hielt sich für ersteres, kleidete sich einfach, aber harmonisch, färbte sich nicht die Haare und schon gar nicht die Fingernägel. Bei der vielen Arbeit immer gepflegt auszusehen, wäre auch schwierig gewesen. Sie glaubte aber zu wissen, dass er eine „Katalog-Frau“ vorgezogen hätte, eine, die ihre weiblichen Attribute mehr betonte. Die elegant war.
Berna war eine richtige Landfrau geworden, sie hatte ein gebräuntes Gesicht, weil sie bei jedem Wetter draußen war. Ein paar dünne Linien zogen sich – noch kaum sichtbar – strahlenförmig von den Augenwinkeln zum Gesichtsrand: Krähenfüße – wie bei Menschen, die oft bei greller Sonne zum Himmel schauen. Ihre Hände waren klein und kräftig, mit durchscheinenden Venen. Ihr dichtes, gewelltes Blondhaar, mit ersten Silberfäden durchsetzt, trug sie meist im Nacken zusammengebunden.
Werner sagte nie etwas – weder positiv, noch negativ – über ihr Aussehen, es schien ihm egal zu sein. ‚Bestimmt hat er eine andere’, dachte Berna oft. Obwohl er nicht besonders attraktiv war, nur mittelgroß, mittelblond und mittelschlank, konnte er sehr charmant sein, wenn er wollte, vor allem vor Publikum. Ihr gegenüber hatte sein Charme zwar schon sehr früh nachgelassen. Nach dem ersten Kind schon. Etwas Unerklärliches war mit ihrer Beziehung geschehen. Seitdem fühlte sie sich eher wie seine Angestellte als wie seine Frau. Das bedrückte sie seit langem, hatte sie unsicher gemacht, und ihre ganze Erscheinung hatte etwas Schüchternes, so als schämte sie sich fortwährend für irgend etwas. Im Kontrast dazu stand ihr mädchenhaft-trotziger Mund unter der geraden Nase. „Schmollmund“ hatte Werner ihn früher genannt. Damals, als er ihn noch küsste. Hatte sie damals schon Grund zum Schmollen gehabt?
Werners Interesse an seinen Kindern war mäßig. Sie sollten ihre Sachen machen, ihn in Frieden lassen. Ihm war wichtig, dass alles reibungslos funktionierte. Dafür sorgte sie. Dafür versorgte er sie, und das tat er zuverlässig. Sie stritten sich nie, alles lief wie geschmiert, ihre Familien-Choreographie war perfekt. Kranksein war nicht erlaubt.
Sie hatten dieses Bauernhaus gekauft, weil Berna unbedingt auf dem Land leben wollte. Nicht bloß, weil es gesünder war – sie war einfach menschenscheu. Sie hatte in sich ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber ihren Mit-Erwachsenen, eben so tiefsitzend wie ihr schwaches Selbstvertrauen und vielleicht aus der selben Wurzel stammend. Deshalb gab sie sich am liebsten mit Kindern ab, von ihnen hatte sie nichts zu fürchten.
Außerdem aber war sie unendlich romantisch. Ein altes Bauernhaus mit großem Garten! Nie hätte sie gedacht, wieviel Arbeit das macht, auch schon ohne Tiere!
Später, als ich Berna schon eine Zeitlang kannte, wurde mir klar, dass sie ziemlich oft irgendwelche Projekte startete, mit denen sie sich übernahm. Es schien, dass sie die Folgen nicht abschätzen konnte, sie wurde meist von ihnen überrollt, egal, was sie unternahm. Ihr größtes „Projekt“ dieser Art war die Familie, dicht gefolgt vom Bauernhof … Sie schien kein Gefühl für ihre persönlichen Möglichkeiten zu haben. Ob das daher kam, dass sie als Kind mit ihren vagabundierenden Eltern nie lange genug an einem Ort geblieben war, um Folgen des Handelns zu erleben? Hatten sie immer so aus dem Bauch heraus gelebt, weil man ja gehen konnte, wenn es einem zuviel wurde?
Deshalb, wenn sie mit Werner über Haus und Hof sprechen wollte, sagte er mildlächelnd: „Es ist dein Spielplatz, du hast ihn gewollt! Mach damit, was du willst. Geld ist kein Problem!“ So hielt er sich raus aus ihrem Leben. Er hielt sie aber auch heraus aus seinem Leben, indem er fast nie von seiner Arbeit sprach. Vor Jahren hatte er eine Landarztpraxis im Nachbarort übernommen, die ihn rund um die Uhr beschäftigte. Er musste das Arztgeheimnis wahren – vertraute er ihr nicht?
Da gab es also nur noch wenig Gemeinsamkeiten, die der Rede wert waren. Weshalb waren sie eigentlich zusammen? fragte Berna sich oft.
Damals hatten sie sich auf einem Tai-Chi-Kurs kennen gelernt, hatten sich sofort verliebt und waren in der ersten Nacht schwanger geworden. Es war beiden recht gewesen; es war an der Zeit. Für Berna mit 36 schon höchste Zeit. Also heirateten sie, und das zweite Kind kam bald. Keine Gelegenheit, einander kennen zu lernen. Was bedeuten wir ihm, die Kinder und ich? dachte sie seit Jahren, während ihr Leben sich ganz um die Kinder und um ihren „Spielplatz“ drehte. Bei beidem spielte ihr Mann keine Rolle.
Manchmal gingen sie zu zweit in ein Restaurant, am Wochenende, wenn sie einen Babysitter hatten. Beim gemeinsamen Essen kam ihr ein Ausspruch ihres Vaters in Erinnerung: „Beim Essen soll der Mund nur vom Kauen wackeln“, so hieß das früher. Auch Werner schwieg beim Essen. Also schwiegen sie auch da, beide, den größten Teil des Abends. Oder er hielt Monologe. Ihr fiel einfach nichts ein, was ihn hätte interessieren können. Klar – so uninteressant, wie sie selber war, glaubte sie. Sie war keine Karrierefrau, hatte zur Zeit keinen Job. Ihr blieben nur die Kinder, für die sie sich entschieden hatte. Was nützte es ihr da, zweimal studiert zu haben, sogar mit Abschluss. Na gut, sie hatte auch diese private Kindertagesstätte mit aufgebaut und würde vielleicht dort arbeiten können. Alles Peanuts! Ihm, dem promovierten, an- gesehenen Mediziner, konnte sie einfach nichts bieten. Er schien sie kaum wahrzunehmen.
Aber das viele Schweigen war für sie erdrückend. Sie sehnte sich nach einem Gesprächspartner. Es gab Tage, an denen sie nur mit den Kindern redete. Sie hatte sich selbst zwei kleine Freunde geboren, die einzigen Menschen, mit denen sie ungehemmt reden konnte, die kein Wort auf die Goldwaage legten, die immer verstanden, auch ohne Worte – telepathisch! Die Beziehung mit diesen beiden wunderbaren Menschlein versäumte er fast völlig. Von der Beziehung zu ihr nicht zu reden …
Einmal – letztes Jahr – hatte er an ihren Hochzeitstag gedacht, so schien es; jedenfalls gab er ihr einen Blumenstrauß, als er abends nach Hause kam. Beiläufig erfuhr sie dann, dass die Blumen von einer Patientin waren … Er bekam ja oft Blumen von dankbaren Patienten. Was sie denn habe, Blumen seien Blumen! Ob er sie nun selber gekauft oder geschenkt bekommen hatte. Waren sie denn nicht schön? Ach so, Hochzeitstag? Naja!
Über all diesen kreisenden Gedanken schlief sie irgendwann ein, schreckte aber immer öfter nachts um vier auf mit der Panik, den Wecker überhört zu haben. Um dann bis zum Morgengrauen Werner bei seinem komatösen Schnarchen zuzuhören.
Aber jetzt war da jemand, der ihr zuhörte, mit dem sie sprechen konnte, ihre Naturbeobachtungen teilen, im Austausch mit seinen Erfahrungen aus einem fernen Kontinent. Jemand, der dankbar für das Essen war, das sie immer auch für ihn mit kochte. Jemand, der tatkräftig half (wenn er natürlich auch bezahlt wurde) und ihr das Gefühl vermittelte, nicht allein in der Einöde zu leben. Und der bei allem, was er tat, nie seine eigentümliche Würde verlor ...
Dass er Flüchtling war, war dabei sicher nicht unwichtig. Berna war ja selbst ein Flüchtlingskind; von Ost nach West war sie im Alter von drei Monaten von den Eltern mitgenommen worden, als diese die Missstände in der jungen DDR satt hatten, sich wehrten und schließlich verfolgt wurden. Sie schafften es über Berlin in den Westen, lange vor dem Mauerbau, und hatten nichts mitnehmen können. Im Westen fiel es ihnen jahrelang schwer, Fuß zu fassen, ein Leben als fahrende Künstler – eine Odyssee. Es war ein Milieu, in dem Berna sich auskannte: Menschen auf der Flucht vor Unrecht, entwurzelt und nirgends zugehörig. Überall gab es sie, und Berna, der es doch gelungen war, sich zu etablieren, war jederzeit auf ihrer Seite und hatte unendliches Mitgefühl. Kein Wunder, dass Dylan sich angenommen fühlte – für ihn war Berna eine Oase in der ansonsten fremdenfeindlichen deutschen Sozial-Wüste!
Dann kam der Winter, und sie sahen sich nicht mehr. Drei lange Monate kam kein Lebenszeichen von ihm.
Und eines Tages im Vorfrühling, die Zaubernussbüsche leuchteten schon gelb, bemerkte sie, dass sie auf seinen Anruf wartete, jeden Tag etwas mehr. Und ihr Herz begann erstaunlich schnell zu schlagen, als sie dann wirklich am Telefon die rauchige Stimme hörte - die Stimme des schwarzen Prinzen, wie sie ihn längst bei sich nannte.
Diese Stimme war es, die es ihr angetan hatte. Ein heiseres Raunen; sie spürte es durchs Telefon, dicht an ihrem Ohr, beinahe wie heißen Atem, ein Hineinhauchen von Zärtlichkeiten, seine vollen Lippen würden dabei ihr Ohr, ihren Hals streifen … Und da diese Fantasien einmal da waren, gingen sie auch weiter, und die Lippen saugten sich an ihrem Hals fest, strichen dann, eine heiße Spur hinterlassend, über ihre Schulter nach vorne, tiefer, eine züngelnde Zunge, die schließlich die besten Stellen findet … Und dann das andere alles – alles!
Oft hatte sie so fantasiert, und so war die Vorbereitung längst perfekt, als er dann vor der Tür stand. Dann nahmen sie das gemeinsame Spiel auf, wie selbstverständlich. Zehn Jahre eheliche Einsamkeit hatten Bernas Hunger unermesslich gemacht.
An ihrem 49sten Geburtstag hatte sie, allen Kummer verleugnend, in ihr Tagebuch geschrieben: Ich habe ein gutes, ruhiges und erfülltes Leben, wunderbare Kinder, einen zuverlässigen, treuen Ehemann, keine Sorgen. Ich bin eine Auserwählte!
Ein Vierteljahr später war so gut wie alles anders. Nur die Kinder, die waren noch immer wunderbar!