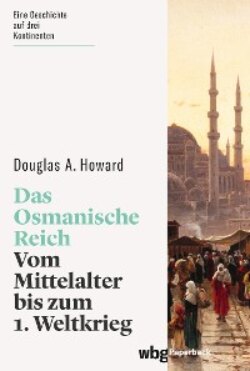Читать книгу Das Osmanische Reich - Douglas Dozier Howard - Страница 24
Heiliger Raum
ОглавлениеIn der Folge ihrer Begegnung knüpften Palamas und die türkischen Eroberer enge Beziehungen an. So politisch nützlich sie offenkundig waren, erwuchsen sie doch auch aus gegenseitigem Respekt und einem nicht unvereinbaren sprituellen Erleben. Die klösterliche Gemeinschaft vom Berg Athos, die Heimat des Hesychasmus, blieb auch unter türkischem Schutz ein Fixpunkt christlicher innerer Einkehr und ein Ziel für christliche Almosen.79 Mochten die Moscheen der Türken oberflächlichen Triumphalisten auch als Sinnbilder für die Eroberung erscheinen, so waren sie doch zugleich sichtbare Metaphern für die gemischten Gemeinschaften, denen sie dienten, und spiegelten eine gemäß der Vorsehung gelebte gemeinsame Geschichte wider. Die berühmte Inschrift aus Bursa, in der sich Sultan Orhan Mudschahid und Gazi zugleich nannte, beginnt sogar mit der Einzigkeitssure 112 des Koran, die vollständig zitiert wird – eine kompaktere Zusammenfassung der islamischen Theologie kann es kaum geben –, und endet mit einem Segen, der mit dem doppelten Wortsinn der arabischen Wurzel sajd, die „Niederwerfung“ bedeutet, spielt. Eine Moschee (masjid) ist ein Ort der Niederwerfung, und wer „sich niederwirft“ (oder „eine Moschee errichtet“), sagt seinem Stolz ab.
Orhans Inschrift in Bursa
Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Sag: Er ist Allah, Einer, Allah der Urgrund. Er hat nicht gezeugt, und Er wurde nicht gezeugt. Und nie ist einer Ihm ebenbürtig gewesen. Datum: das Jahr 738 [1337–1338]. Mein Gott, sei dem Besitzer dieser Moschee gnädig, und dieser ist der große und gewaltige Emir, der Mudschahed auf dem Wege Allahs, der Sultan der Gazis, ein Gazi, der Sohn eines Gazis, der Recke des Staates und der korrekten Ritualpraxis, der Berühmte an den Horizonten, der Held des Glaubens, Orhan, der Sohn des Osman. Möge Allah seine Lebenszeit lange sein lassen! Er befahl die gesegnete Moschee um des Wohlgefallens Allahs willen. Wer eine Moschee errichtet, dem errichtet Allah ein Haus im Paradies.a
aÜbersetzung: Michael Reinhard Heß; Text der Inschrift nach der Textfassung in Ludvik Kalus: „L’inscription de Bursa au nom du sultan Orhān, datée de 738/ 1337–38: comment faut-il la lire?“, Turcica 36 (2004), S. 233–251, unter Berücksichtigung der von Howard benutzten Textvariante. Erstveröffentlichung des schwer entzifferbaren Textes in Mantran, „Les inscriptions arabes“, Nr. 1.
Abb. 1.4: Die Inschrift aus Bursa. Wie Colin Heywood („The 1337 Bursa Inscription“) herausgearbeitet hat, schmückte sie ursprünglich Orhans erste Moschee in der Zitadelle von Bursa. Bei einer Belagerung wurde diese 1413 zerstört, worauf einige Jahre später die heutige Moschee mit der alten Inschrift errichtet wurde.
Andere von den türkischen Eroberern – nicht allein den Osmanen – errichtete Moscheen zeigen dieselbe Art vielschichtiger symbolischer Anklänge. Eine ist die Moschee des Isa Bey aus der Dynastie von Aydın, eine große Steinmoschee in Ayasoluk (dem mittelalterlichen Ephesos), die 1375 geweiht wurde.80 Sie steht auf dem vormaligen Ufer zwischen dem antiken Artemistempel und jener christlichen Kirche, welche die Reliquien des Apostels Johannes enthielt, und zwar oberhalb davon auf dem Stadthügel.81 Türkische Angreifer eroberten 1304 Stadt und Kirche und plünderten beide. Später errichtete die Aydın-Dynastie einen mächtigen Staat entlang der Ägäisküste, vom Golf von Edremit im Norden bis zum Mäander-Tal im Süden, der fast ein Jahrhundert lang Bestand hatte. Als Ibn Battuta 1332 Ayasoluk besuchte, beeindruckte ihn die Johanneskirche, und er vermerkte, dass sie zur Freitagsmoschee der türkischen Eroberer geworden sei.82 Archäologische Ausgrabungen in jüngster Zeit deuten darauf hin, dass dieser Komplex auch Läden und Ställe umfasste – wahrscheinlich waren sie als Stiftung (vakıf) zum Unterhalt der Moschee entstanden. Der Christ Wilhelm von Boldensele, der etwa zur gleichen Zeit durchreiste, berichtete, dass christliche Pilger auch in den Jahrzehnten nach der Eroberung noch immer die Reliquien verehrten und den türkischen Herrschern eine Abgabe zahlten, so wie sie es vorher mit den christlichen Herrschern gehalten hatten.83
Abb. 1.5: Die Isa-Bey-Moschee. Blick vom Atrium der Johanneskirche
Abb. 1.6: Tempel, Moschee und Kirche – das Gelände von Ayasoluk, vom Tempel der Artemis aus gesehen
Irgendwann nach 1350 zerstörte ein Erdbeben das Gebäude und erzwang den Bau einer neuen Moschee.84 Ihr Standort muss wegen seines Symbolwerts ausgewählt worden sein. Baumaterialien aus dem Artemistempel wurden beim Bau der Moschee wiederverwendet (an sich keineswegs ein unübliches Verfahren), darunter zwölf Säulen, die als Arkade in den Gartenhof der Moschee einbezogen wurden, und ein kaiserzeitliches Kompositkapitell im inneren Betsaal. Die Konstruktion der Moschee stand in einer besonderen Beziehung zum Artemistempel wie zur Johanneskirche. Die Qiblawand der Moschee mitsamt ihren Fenstern ist nicht auf Mekka ausgerichtet, sondern blickt zum Tempel. Von den beiden ursprünglichen Minaretten steht nur noch eines, dem die oberen Partien über der Balkonebene fehlen. Sein Pendant stand auf der anderen Hofseite, stürzte aber offensichtlich bei einem Erdbeben in den 1650er-Jahren ein. Heute wirkt der Balkon des erhaltenen Minaretts der Moschee durch die Portale im Narthex der Kirche wie eingerahmt, wenn man genau von jener Stelle im Kirchenschiff aus hinüberblickt, wo in einer Krypta unter dem Altar die Reliquien des Apostels Johannes beigesetzt waren (siehe Abb. 1.7).
Abb. 1.7: Minarett der Isa-Bey-Moschee, eingerahmt von Vorhofportal der Johanneskirche
Auf diese Weise griff die Isa-Bey-Moschee als jüngstes der drei Gebäude an dieser antiken Stätte die chronologische Beziehung zwischen griechischem Heidentum, Christentum und Islam auf. Indem sie Teilaspekte des Tempels und der Kirche einbezog, ließ die Moschee beide als überholt erscheinen, so wie der Islam über dem Christentum und auf den Trümmern des Heidentums errichtet wurde. Der Architekt machte aber auch Anleihen bei der heiligen Aura der Göttin Artemis und des Apostels Johannes und verstärkte diese, wobei er mit den ästhetischen Eigenheiten des Standorts spielte85 und so eine Bildsymmetrie schuf, in der das Gebet auf die Kräfte der Natur und der Zeit ausgerichtet ist. Wenn der Muezzin zum Gebet rief, befand er sich in einer Blickachse, die mitten durch das Schiff der eingestürzten Kirche zu den Reliquien des heiligen Johannes führte, und Betende, die sich niederwarfen, blickten jenseits des Mihrab auf den versunkenen Tempel der Artemis.
Abb. 1.8: Die Moschee von Assos
Ein bescheidenerer Fall ist die osmanische Moschee in Assos an der Südküste der Troas. Der türkische Name für die Stadt, Behram, leitet sich vom mittelalterlichen griechischen Namen Machramion ab. Überwiegend griechisch und christlich blieb die Stadt bis zu den Zwangsmigrationen der Jahre 1919–23. Die antiken Ruinen von Assos säumen die Oberkante eines Steilhangs, von wo aus man eine spektakuläre Sicht auf die blauen Wasser des 200 Meter tiefer gelegenen Ägäischen Meeres genießt. Die Fundstätte war Gegenstand der ersten Grabungen des Archaeological Institute of America in den Jahren 1881–83.86
Abb. 1.9: Inschrift am Türrahmen der Moschee von Assos
An der Nordostecke der Akropolis ragt auf der Landseite wie ein Wachtposten die Moschee auf, die von dort aus kilometerweit zu sehen ist. Je nach Blickwinkel ist sie auch vom Meer her sichtbar. Aus der Nähe zeigt sie sich überraschend schlicht und unscheinbar. Einschließlich der Vorhalle misst das Gebäude nur 17 × 14 Meter und besteht aus einem einzigen überkuppelten quadratischen Raum.87 Es gibt nicht einmal ein Minarett. Ebenso wenig existiert eine Gründungsinschrift, aber osmanische Aufzeichnungen des folgenden Jahrhunderts bestätigen, dass Sultan Murad sie in Auftrag gab,88 wahrscheinlich etwa zur selben Zeit wie Isa Bey die Moschee in Ayasoluk. Die Moschee von Assos wurde aus den Ziegeln und Natursteinen einer verfallenen Kirche, die einst an dieser Stelle gestanden hatte, und des angrenzenden Tempels der Athena erbaut.89
Wie auch in Ayasoluk stand hinter der Wiederverwendung der Materialien mehr als nur funktionelles Denken und Umweltbewusstsein. Selbst den marmornen Türrahmen der ehemaligen Kirche, die dem heiligen Cornelius geweiht war, verwendete man in der Moschee wieder, einschließlich der originalen griechischen Inschrift auf dem Türsturz. Sie ehrt einen anonymen Provinzstatthalter, dessen Mäzenatentum irgendwann in der Vergangenheit die Renovierung der Kirche finanziert hatte.90 Somit wurde der Türrahmen etwas Doppeldeutiges – hier auf der Akropolis von Assos, inmitten der Ruinen vergangener Zeiten, setzte Sultan Murad das Gebäude wieder zusammen. Auch er ließ seinen Namen ungenannt, so wie der vergessene griechische Statthalter, der lange vor ihm die Kirche hatte renovieren lassen.