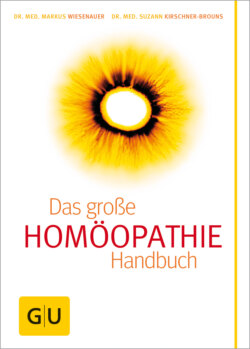Читать книгу Homöopathie - Das große Handbuch - Dr. med. Markus Wiesenauer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Klassische Homöopathie
ОглавлениеDie klassische Homöopathie sieht den Menschen als einzigartiges Wesen. Diese individuelle Betrachtungsweise ist ihr wichtigster Grundsatz; und so, wie der einzelne Mensch unverwechselbar ist, sind es auch seine Krankheitssymptome. Dementsprechend wird mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit das auf den Einzelnen jeweils passend zugeschnittene Medikament gesucht.
Der Name „Homöopathie“ setzt sich aus den griechischen Wörtern „homoios“ (ähnlich) und „pathos“ (Leiden) zusammen, heißt also „ähnliches Leiden“. Der Begriff wurde von dem Entdecker und Begründer der Homöopathie, Christian Friedrich Samuel Hahnemann (geboren am 10. 4. 1755 in Meißen, gestorben am 2. 7. 1843 in Paris) geprägt.
Der deutsche Arzt Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755–1843) ist der Entdecker und Begründer der Homöopathie.
Ehe er als Mediziner zu Ruhm gelangte, finanzierte Hahnemann sein Studium als Fremdsprachenlehrer und Übersetzer. Im Jahr 1779 schloss er sein Medizinstudium ab und ließ sich mit einer eigenen Praxis in Leipzig nieder. Die damaligen äußerst groben Heilmethoden, die aus Aderlässen, Brech- und Abführkuren oder aus der Gabe von giftigen Mitteln wie Quecksilber und Arsen bestanden, ließen ihn allerdings an seiner Aufgabe zweifeln und seine Praxis bald wieder schließen. Er übte öffentlich Kritik an der gängigen Medizin, was ihn nicht gerade beliebt machte. Rasch galt er als „Nestbeschmutzer“. Hahnemann blieb nichts anderes übrig, als sein Geld wieder mit Übersetzungen zu verdienen.
ERSTER HINWEIS
Bei der Bearbeitung eines Arzneimittelbuchs des Schotten Dr. William Cullen stolperte er über eine der Schlussfolgerungen des Pharmakologen. Dieser behauptete, dass die Wirkung der Chinarinde bei Malaria auf ihre magenstärkende Wirkung zurückzuführen sei. Dies erschien Hahnemann unlogisch. In seinem ersten von unzähligen Selbstversuchen nahm er Chinarinde ein, obwohl er nicht an Malaria erkrankt war. In der Folge beobachtete er an sich ähnliche Symptome wie bei einem Malariakranken: etwa Schläfrigkeit, Herzklopfen, Ängstlichkeit und Durst. Von da an stand für ihn fest, dass Chinarinde Malaria heilt, gerade weil sie bei einem Gesunden die Symptome der Malaria hervorruft. Damit war seine Idee „Ähnliches kann durch Ähnliches geheilt werden“ geboren.
In den nächsten sechs Jahren ging er dieser Hypothese systematisch nach. Durch unzählige Versuche an sich selbst, an seiner Familie und seinen Freunden untermauerte er dieses Prinzip. Die gewonnenen Erkenntnisse veröffentlichte er 1796 am Beispiel der Chinarinde in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift „Hufeland Journal“.
• Revolutionierende Methode
Für damalige Verhältnisse wagte sich Hahnemann mit seiner Theorie weit vor; zumal er behauptete, dass die heilende Wirkung umso größer ausfiele, je geringer die Dosis des Symptome verursachenden Stoffes wäre.
Diese neue, sanfte Medizin bedeutete für die Patienten jedoch eine Erlösung von den üblichen, oftmals rüden Behandlungsweisen; und so nahmen sie Hahnemanns Methode begeistert an. Der Apothekerschaft allerdings war diese ein Dorn im Auge. Schließlich sah die Homöopathie jeweils nur ein Medikament in der Behandlung vor, und das auch nur in niedriger Dosierung.
Im Jahr 1810 erschien Hahnemanns Hauptwerk, das „Organon der Heilkunst“ mit den Grundlagen und Gesetzen seiner Lehre (organon, griechisch = Werkzeug, Methode). Dem Buch, das bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren hat, folgte von 1828 bis 1830 mehrbändig „Die chronischen Krankheiten“.
Nachdem 1830 Henriette, Hahnemanns Frau, gestorben war, heiratete der 11-fache Vater fünf Jahre später die Französin Mélanie d’Hervilly. Gemeinsam zogen er und die 45 Jahre jüngere Dichterin und Malerin nach Paris. Dort betrieb der Homöopath mit ihrer Unterstützung bis an sein Lebensende sehr erfolgreich eine Praxis.
DIE ÄHNLICHKEITSREGEL
Der Lehrsatz „Similia similibus curentur“ – „Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“ – ist die Grundlage der Homöopathie. Ihr zufolge kann eine Krankheit nur mit dem Mittel geheilt werden, welches bei einem gesunden Menschen dieselben Symptome hervorruft. Hier einige Beispiele: Bei einem Schnupfen leidet man unter tränenden, brennenden Augen, aus der Nase fließt ein scharfes, wund machendes Sekret. Hier hilft nur das Mittel, das bei einem Gesunden genau diese Symptome hervorruft. Das homöopathische Mittel Allium cepa, aus der Küchenzwiebel hergestellt, ist in diesem Fall die passende Medizin. Jedem, der schon einmal eine Zwiebel zerschnitten hat, werden diese Beschwerden bekannt vorkommen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen Erkältungsschnupfen oder um einen allergisch bedingten Schnupfen handelt. Entscheidend ist die Ähnlichkeit der Symptome.
Gegen Juckreiz und brennende Schmerzen der Haut wie bei einer Nesselsucht hilft das homöopathisch aufbereitete Mittel aus der Brennnessel (Urtica urens). Bei Schwellungen wie nach einem Bienen- oder Wespenstich sowie bei einer Flüssigkeitsansammlung im Gewebe (Ödem) findet ein Mittel Verwendung, das aus der Honigbiene (Apis mellifica) gewonnen wird. Gegen Übelkeit und Schwindel wie beim Rauchen der ersten Zigarette kommt Tabacum, das aus Tabak aufbereitete Mittel, zum Einsatz.
Wichtig für die heilende Wirkung des Homöopathikums ist die größtmögliche Übereinstimmung zwischen dem Krankheitsbild und dem Arzneimittelbild: Man spricht vom ähnlichen Mittel, dem „Simile“. Hahnemann benutzte gerne den Ausdruck „Inbegriff“ der Arznei und beschrieb, dass ein homöopathisches Mittel künstlich ähnliche Beschwerden auslöst wie die eigentliche Erkrankung, diese aber an Stärke noch übertrifft und dadurch den Heilungsprozess in Gang setzt.
ARZNEIMITTELPRÜFUNG AM GESUNDEN
Ehe Hahnemann die Naturstoffe am Kranken anwendete, prüfte er in einem aufwändigen Verfahren die möglicherweise geeigneten Substanzen am Gesunden. Bewies das Arzneimittel in dieser so genannten Arzneimittelprüfung seine Wirkung, war es zur Behandlung beim Kranken mit vergleichbaren Beschwerden geeignet.
Inzwischen sind die Arzneimittelbilder von über 2000 Mitteln bekannt; und auch heute noch hat dieses Verfahren seine Gültigkeit, werden Arzneimittelprüfungen durchgeführt, um neue Mittel zu finden und Arzneimittelbilder zu vervollständigen.
Diese Vorgehensweise ist also Voraussetzung, um die Ähnlichkeitsregel therapeutisch umsetzen zu können. Dabei ist sie die wichtigste Forschungsaufgabe der Homöopathie, denn je intensiver ein Mittel geprüft wird, umso präziser ist seine Anwendung. Zudem sind die Arzneimittelprüfungen der wesentlichste Baustein des Arzneimittelbildes. Auch heutzutage sind sie immer noch einer der wichtigsten Schwerpunkte der Homöopathie-Forschung. Die Prüfungen werden meist von Ärzten an sich selbst durchgeführt.
Genaue Protokollierung
Bei der Arzneimittelprüfung nehmen gesunde Menschen vorschriftsmäßig das zu prüfende Mittel ein. Hierbei wissen sie jedoch nicht, um welche Substanz es sich handelt. Die auftretenden Symptome, wie ein Stimmungswechsel, psychische und körperliche Reaktionen (Angst, Schwitzen, Erröten und Ähnliches) werden dann genauestens beobachtet und protokolliert. Auch wird vermerkt, wodurch sich die Beschwerden bessern bzw. verschlechtern (beispielsweise vor oder nach dem Essen, Besserung in Ruhe, durch Wärme, frische Luft, Verschlechterung durch Kälte oder Feuchtigkeit).
Darüber hinaus spielen ebenso die Interaktionen mit der Umwelt eine Rolle. Verändert sich das Verhalten? Kommt es beispielsweise zu Aggressivität oder Unsicherheit?
DAS ARZNEIMITTELBILD
Sämtliche Ergebnisse der Prüfung eines Homöopathikums an Versuchspersonen werden in einer Symptomenliste zusammengestellt.
In Verbindung mit den pharmakologischen Erkenntnissen über eine Substanz, der Prüfung beim Gesunden, den langjährigen Erfahrungen in der Anwendung beim Kranken und anderen Hinweisen entsteht das eigentliche Bild einer Arznei. Dieses Arzneimittelbild spiegelt die gesamten Anwendungsmöglichkeiten („Wirkungsprofil“) des betreffenden Mittels wider. Es beschreibt alle gesundheitlichen Reaktionen auf eine bestimmte Substanz. Dabei ist das Arzneimittelbild nach dem „Kopfzu-Fuß-Schema“ aufgebaut; es beschreibt also die Wirkung eines Mittels auf die einzelnen Organbereiche von oben nach unten. Außerdem gehören auch die emotionalen Reaktionen sowie die so genannten Modalitäten dazu. Darunter versteht man die Begleitumstände, die eine Besserung oder Verschlechterung der Beschwerden hervorrufen. So können sich beispielsweise Symptome durch Wärme und Bewegung verschlechtern, wohingegen Kälte und Ruhe eine Verbesserung hervorrufen.
• Große und kleine Mittel
Sämtliche Arzneimittelbilder werden ständig durch die Erkenntnisse aus der Anwendung am Kranken, sowohl am Menschen als auch am Tier, ergänzt. Sich bestätigende sowie neue Beobachtungen werden von den Anwendern in der Literatur (wie in Zeitschriften und Büchern) festgehalten sowie auf Fortbildungsveranstaltungen verbreitet, sodass die Kenntnisse über ein Mittel immer umfangreicher werden. Dies führte dazu, dass man in der Homöopathie auch von „großen“ und „kleinen“ Mitteln spricht, in Abhängigkeit von der Menge der Erkenntnisse über dieses Homöopathikum. Beispielsweise ist Pulsatilla pratensis (Küchen- oder Kuhschelle) ein großes Mittel: Hahnemann listete hier 1163 Symptome auf. Beinhaltet ein sehr umfassendes Arzneimittelbild auch einen gut zu beschreibenden Menschentypus, insbesondere mit seinen „Geistes- und Gemütssymptomen“, spricht man von einem „Konstitutionsmittel“. So sind z. B. Pulsatilla-Menschen nachgiebig und sanft. Sie neigen zum Weinen und können nicht gut allein sein.
Die Arzneimittelbilder werden in so genannten Arzneimittellehren alphabetisch zusammengefasst. Man spricht hier von einer „Materia Medica“. Eine solche Mittelzusammenstellung für dieses Buch finden Sie im Kapitel 3 ab > ff.
ENTSCHEIDEND: DAS INDIVIDUELLE KRANKHEITSBILD
Jeder Mensch ist wie sein Fingerabdruck einzigartig. Diese Sichtweise ist eines der wichtigsten Grundprinzipien in der Homöopathie und wird in der praktischen Anwendung der Mittel stets berücksichtigt. Denn so wie jeder Mensch auf seine Weise durch das Leben geht, so individuell sind auch seine Krankheitssymptome. Deshalb ist die Mittelfindung – vor allem bei chronischen Erkrankungen – die wirkliche Kunst in der Homöopathie. Denn die Symptome müssen mit einem Arzneimittel behandelt werden, das genau auf den jeweils Einzelnen zugeschnitten ist. Dementsprechend intensiv ist die homöopathische Anamnese. Der Arzt muss sich dem Patienten mit viel Zeit, Geduld, Wissen und Erfahrung zuwenden. Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln und Geräten allein, wie Ultraschall oder Computertomographie, ist hier sicherlich kein Ersatz.
Nicht die Krankheit an sich oder die allgemeine Diagnosestellung sind also von Bedeutung, sondern durch welche Symptome sich die Krankheit bei genau diesem einen Patienten äußert. Aus den Antworten und Erkenntnissen ergibt sich für den Homöopathen das individuelle Krankheitsbild des Patienten. Dies bedeutet, dass ein Mittel, das z. B. den Schnupfen Ihrer Schwester geheilt hat, nicht das passende Mittel für Sie selbst sein muss und umgekehrt.
Homöopathika können also nicht bei jedem Krankheitsbild gleichermaßen eingesetzt werden, und sie lassen sich auch nicht im gleichen Krankheitsfall von Patient zu Patient austauschen.
Umfassende Anamnese
Weil der Mensch aus homöopathischer Sicht eine Einheit aus Seele, Geist und Körper bildet, werden im Rahmen der Anamnese auch alle Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen:
Art der Beschwerde, Qualität
Zeitpunkt des Auftretens
Ereignisse und Lebensumstände
–Ursachen für Besserung oder Verschlechterung der Beschwerden
Seelische Verfassung (schlechte/gute Laune, weinerlich, traurig, ruhig usw.)
Charakter
Frühere Krankheiten (auch in der Familie)
DIE HERSTELLUNG VON HOMÖOPATHIKA
Die Ausgangsstoffe homöopathischer Mittel stammen zum größten Teil aus der Natur. Rund 70 werden aus Pflanzen oder Pflanzenteilen wie Blättern und Wurzeln hergestellt. Andere Mittel gewinnt man aus Tieren wie der Honigbiene (Apis mellifica), Roten Waldameise (Formica rufa) oder aus tierischen Produkten, etwa dem Gift der Buschmeisterschlange (Lachesis) oder dem Kittharz der Bienen (Propolis).
Auch Metalle wie Kupfer (Cuprum metallicum) oder Gold (Aurum metallicum), Mineralien wie Kalk (Calcium carbonicum) oder Säuren wie die Salpetersäure (Acidum nitricum) werden verwendet. Darüber hinaus dienen ebenso chemische Ausgangsstoffe wie Nitroglycerin als Grundlage.
Nosoden
Sie werden aus gesundem oder krankhaftem Gewebe sowohl vom Menschen als auch von Tieren sowie aus Sekreten (etwa eitrigen Absonderungen), aus (patienteneigenen) Körperflüssigkeiten, aber auch aus Krankheitskeimen hergestellt. Der Begriff leitet sich vom altgriechischen „ho nosos“ = Krankheit ab. Nosoden werden ebenfalls potenziert und sind in ihrer Wirkung vergleichbar mit Homöopathika. Sie können als zusätzliches Mittel gegeben werden (siehe Kapitel Kinderkrankheiten, > ff.).
• Strengste Qualitätsansprüche
Durch das spezielle homöopathische Herstellungsverfahren sind alle Substanzen keimfrei und ungiftig. Auch enthalten sie keinerlei Verunreinigungen. Damit dies gewährleistet ist, unterliegt jeder Hersteller von homöopathischen Arzneimitteln strengsten Vorschriften, wie sie auch im Homöopathischen Arzneibuch (HAB) nachzulesen sind.
Das Arzneibuch hat quasi die Funktion eines Gesetzestextes. Es enthält für jede in der Homöopathie verwendete Substanz eine exakte Beschreibung des Ausgangsstoffes zur Sicherung der gleich bleibenden Qualität und damit auch der Wirksamkeit. So wird z. B. im HAB für die Herstellung von Arnica montana der verwendete Pflanzenteil genau beschrieben: Als Arzneigrundstoff dienen die getrockneten unterirdischen Teile der Arnika, die dann weiterverarbeitet werden.
Die Tradition der Homöopathie zeigt sich nicht nur darin, dass die Beschreibungen der verwendeten Naturstoffe bereits von Hahnemann begonnen und durch moderne Erkenntnisse ergänzt wurden. Auch die Verarbeitung der Substanzen – man spricht von einer Standardisierung – geht im Wesentlichen auf ihn zurück. Im Besonderen betrifft dies den Herstellungsprozess, der als Potenzierung bezeichnet wird.
POTENZEN UND DOSIERUNG
Hahnemann stellte im Laufe der praktischen Anwendungen fest, dass manche der angewandten Mittel nicht ungefährlich waren. So kam es z. B. nach der Gabe von Tollkirsche (Belladonna) oder Brechnuss (Nux vomica) zu Vergiftungserscheinungen. Das veranlasste ihn, die Dosis des Mittels systematisch zu verringern, um die giftige Wirkung oder auch Überreaktionen bei den Behandelten zu vermeiden. Hahnemann benutzte dazu das bis heute unverändert vorgeschriebene Verfahren der stufenweisen Verarbeitung – der Potenzierung –, damals als „Dynamisation“ bezeichnet. Dabei stellte er fest, dass die Wirksamkeit des Mittels umso stärker sein konnte, je höher die Potenzierung war. Auf diese Weise gewann er die Erkenntnis, dass der menschliche Organismus die „Informationen“ eines Arzneimittels auch dann empfängt, wenn der Reiz nur minimal ist.
Bei Mitteln mit niedriger Potenz (D1 bis D12) lassen sich noch Moleküle der Ursubstanz nachweisen; deshalb ist davon auszugehen, dass auch bei höheren Potenzen das entsprechende Mittel energetische Informationen der Ursubstanz enthält. Diese beeinflussen das sensible biologische System des gesamten Organismus auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene.
Jeder Potenzierungsvorgang muss selbst heute noch von Hand durchgeführt werden. Deshalb spricht man auch von handverschüttelten Arzneien. Jeder Hersteller homöopathischer Arzneimittel ist an diese arzneimittelrechtliche Vorschrift gebunden.
Potenzen für den Therapeuten
Die so genannten Höchstpotenzen (C200, C500, C1000 und höher) sollten wie die LM- oder Q-Potenzen ausschließlich dem sehr erfahrenen Homöopathen vorbehalten bleiben, weil sie eine möglichst exakte Übereinstimmung zwischen dem Krankheitsbild und dem Arzneimittelbild erfordern. Bei ihrem Einsatz muss auch häufiger mit einer so genannten Erstverschlimmerungs-Symptomatik gerechnet werden. Darüber hinaus haben sie, je nach Höhe der Potenz, eine Wirkungsdauer von bis zu sechs Monaten.
• Unterschiedliches Wirkungsspektrum
Niedrige Potenzen (D1 bis D12) haben eine breite – vor allem auf organische Beschwerden und Erkrankungen ausgerichtete – Wirkung. So findet Arnica montana D6 beim Bluterguss Anwendung, Luffa operculata D6 kann bei wiederkehrenden Entzündungen der Nasennebenhöhlen genommen werden.
Ab der Potenz D12 und C12 bis hin zu D30 bzw. C30 beginnt der zunehmende Einfluss auf den seelischen Bereich. So helfen höhere Potenzen bei psychischen Beschwerden und Erkrankungen. Ein Beispiel hierfür ist Ignatia D12, das gegen ein Kloßgefühl im Hals bei seelischen Belastungen hilft. Aber auch bei schwereren chronischen Krankheiten, die häufig mit seelischen Leiden einhergehen und die mit „in die Wiege gelegten“ Erkrankungen verbunden sind, kommen diese Potenzen zum Einsatz.
Zwar gibt es von Homöopath zu Homöopath unterschiedliche Ansichten bezüglich der Frage der Potenzhöhe. Entscheidend ist jedoch stets die Richtigkeit des gewählten Einzelmittels. So empfehlen sich in der Selbstbehandlung vor allem die praxisbewährten Potenzen D6 und D12, denn sie erlauben ein sicheres und wirksames Behandeln.
Zwei verschiedene Herstellungsschritte
Gewinnung der Urtinktur, einer flüssigen Arzneiform, sowie der Ursubstanz, einer festen Arzneiform, als Arzneigrundstoff:
– Es wird z. B. Material aus Frischpflanzen mit hohem Saftgehalt (etwa Avena sativa) ausgepresst und der Saft dann im Verhältnis 1:1 mit Alkohol gemischt.
– Sonstige pflanzliche und tierische Materialien (z. B. Chamomilla recutita, Coccus cacti) werden entsprechend den Vorgaben des Homöopathischen Arzneibuchs (HAB) in Abhängigkeit vom Trockengehalt mit Alkohol im Verhältnis 1:1 bis 1:10 versetzt. Nach fünf bis zehn Tagen wird die alkoholische Lösung abgepresst und filtriert.
– Feste Ausgangsstoffe werden soweit möglich in Wasser oder Alkohol gelöst (z. B. Kalium chloratum).
– Unlösliche Ausgangsstoffe wie etwa Cuprum metallicum werden mit Milchzucker im Verhältnis 1:10 verrieben.
Die weitere Verarbeitung erfolgt mittels Potenzierung. Hierbei wird die Urtinktur bzw. Ursubstanz stufenweise mit einem Arzneistoffträger (Alkohol oder Milchzucker) in einem bestimmten Mengenverhältnis vermischt und danach entweder verschüttelt oder verrieben. Je nach Mengenverhältnis existieren drei verschiedene Arten von Potenzen:
– Die Dezimalpotenzen, hergestellt im Verhältnis 1:10, bezeichnet als D1, D2, D3 usw.
– Die Centesimalpotenzen, hergestellt im Verhältnis 1:100, bezeichnet als C1, C2, C3 usw.
– Die LM-Potenzen, auch als Q-Potenzen bezeichnet, hergestellt im Verhältnis 1:50000, bezeichnet als LM I, LM II, LM III usw.
Die Zahlen hinter den Buchstaben geben an, wie oft diese stufenweise Verarbeitung stattgefunden hat. So bedeutet beispielsweise eine D4-Potenz: 1 ml Urtinktur wird mit 9 ml Alkohol vermischt, von der D1-Potenz, die dabei entstanden ist, verwendet man 1 ml und vermischt ihn wieder mit 9 ml Alkohol. Dieser Vorgang wird insgesamt 4-mal durchgeführt (deshalb die Bezeichnung D4).
Entsprechend wird bei einer D6-Potenz dieser Vorgang 6-mal wiederholt usw.
Homöopathika kommen vor allem als Streukügelchen (Globuli), Tabletten und Tropfen sowie in Form von Ampullen zur Anwendung.
DARREICHUNGSFORMEN UND MITTELARTEN
Homöopathische Mittel gibt es als Globuli (Streukügelchen), Tropfen und Tabletten. Ampullen sind zur Injektion durch den Therapeuten vorgesehen, können aber auch als Trinkampullen eingesetzt werden. Außerdem sind manche Mittel in Form von Augentropfen oder Salbe erhältlich.
Globuli bestehen aus Saccharose, also Zucker, auf welche die Tropfen aufgebracht wurden. Sie sind folglich die feste, Tropfen die flüssige Arzneiform. Die Behandlung mit Globuli eignet sich auch für Neugeborene und (Klein-)Kinder, ebenso wie für Schwangere und Stillende.
Tropfen, die man früher besonders häufig verwendete, enthalten als natürliches Konservierungsmittel Alkohol, sind also nicht für jeden ratsam. Homöopathische Tabletten wiederum sind auf Basis von Milchzucker (Laktose) hergestellt, sodass sich bei einer Milchzucker-Unverträglichkeit diese Arzneiform nicht empfiehlt.
• Einzel- oder Komplexmittel?
Neben den unterschiedlichen Darreichungsformen gibt es zwei verschiedene Mittelarten: Entweder werden Homöopathika als „Einzelmittel“ oder als „Komplexmittel“ angeboten. Letztere bestehen aus mehreren homöopathischen Mitteln, die sich in ihrer Heilwirkung ergänzen oder gar verstärken.
Manche Therapeuten verwenden Komplexmittel aus Gründen der Vereinfachung. Sinnvoll kombinierte Komplexmittel sollten jedoch nicht mehr als drei bis fünf verschiedene homöopathische Substanzen enthalten. Dabei ist es wünschenswert, dass sie als Einzelmittel in ähnlicher oder gleicher Weise wirken. Bewährt haben sich entsprechende Kombinationen beispielsweise bei akuten Halsschmerzen oder fieberhaften Infekten.
In der klassischen Homöopathie wird allerdings in Abstimmung mit dem individuellen Krankheitsbild stets nur ein Einzelmittel verabreicht. Eventuell gibt man auch mehrere Einzelmittel hintereinander. Die gleichzeitige Gabe mehrerer Mittel hingegen wird nicht favorisiert, weil dadurch möglicherweise das Krankheitsbild verfälscht und die Behandlung erschwert werden könnte.