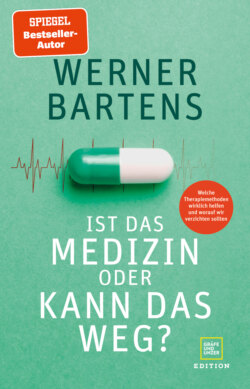Читать книгу Ist das Medizin oder kann das weg? - Dr. Werner Bartens - Страница 11
LABILE SEELE, LABILES KREUZ
ОглавлениеDer Patient war schwer enttäuscht, war er doch seit Jahrzehnten mit seinem Hausarzt eng befreundet. Und jetzt, da ihn seit Tagen heftige Schmerzen in der Lendenwirbelsäule plagten, jetzt, da er einen Arzt gebraucht hätte, der ihn von den Schmerzen befreit hätte, jetzt sagte dieser sogenannte Freund nur lapidar: „Das ist Pech. Du hast eine Entzündung am Steißbein, die dauert 4 bis 6 Wochen, machen kann man da nichts. Geht von selbst wieder weg.“ Schreibtischjob, jede Woche beruflich im ICE unterwegs – und dann nicht sitzen können ohne ständige Schmerzen? Da müsste doch etwas anderes möglich sein! Widerstrebend überweist der Arztfreund an den Orthopäden. Der ordnet eine Röntgenaufnahme der gesamten Wirbelsäule an und stellt eine „Verschiebung“ im Brustbereich fest. Auf den Einwand, der Schmerz sitze aber tiefer, sieht er ein MRT zwingend geboten: Überweisung an den Radiologen. Der wiederum hat zwar eine halbe Seite zu berichten, inklusive „nebenbefundlich“ eine mögliche Zyste an der Niere. Was es mit dem Schmerz in den Lendenwirbeln auf sich hat, steht allerdings nicht in dem Bericht. In der Zwischenzeit hat der gepeinigte Patient alle Hinweise von Bekannten ausprobiert. Ein besonderes Kissen für den ICE, Einlagen, diverse Schmerzmittel („gehen gar nicht auf den Magen“), einen anderen Schreibtischstuhl. Am Ende kommt es wie vom Arztfreund vorhergesagt: Die Entzündung klingt ab, der Schmerz bleibt weg – nur die diversen Kissen sind noch da. Und ein teurer Stuhl muss der Geschäftsführung erklärt werden.
Rückenschmerzen sind wie Erkältungen: „Mit Behandlung 14 Tage – ohne zwei Wochen. Meistens wenigstens.“ Der das sagt, ist kein esoterischer Heiler, sondern Peer Eysel, lange Jahre Chefarzt der Orthopädie an der Universitätsklinik Köln. Eysel weiß, dass in seltenen Fällen auch schwere Krankheiten die Ursache für Rückenschmerzen sein können, Entzündungen oder Tumore etwa. Aber das seelische Gerüst ist viel entscheidender, als Ärzte lange wahrhaben wollten. „Psychische Faktoren sagen das Behandlungsergebnis bei Rückenschmerzen zu mehr als 80 Prozent voraus“, sagt Eysel. Es ist also nicht die Statik und Mechanik des Körpers, sondern die Seele, die entscheidet, ob die Pein im Kreuz wieder verschwindet oder bleibt.
Alle Rücken-Patienten leiden, egal was die Ursache für ihre Schmerzen ist. Manche können sich kaum noch bewegen oder sie liegen jede Nacht wach, weil sie keine Position finden, in der sie schmerzfrei sind. Ihre Leidenswege verlaufen oft ähnlich: Anfangs wechseln sie die Betten und kaufen sich immer wieder neue Matratzen in der Hoffnung auf Linderung. Sie sitzen auf ergonomisch geformten Bürostühlen und melden sich in Fitnessstudios an, um ihre Problemzonen zu stabilisieren. Dabei haben sie meist nur eins im Blick: Den mit Dornfortsätzen gepflasterten Weg vom Scheitel bis zum Steiß – die Wirbelsäule, besonders den unteren Abschnitt. 90 Prozent der Bandscheibenvorfälle und 75 Prozent der Schmerzen sind im Bereich der Lende lokalisiert.
Die Patienten bilden sich die Beschwerden ja nicht ein, auch die Auswirkungen der Psyche auf den Körper sind real. Der Zustand der Seele spiegelt sich im Organismus wider und zeigt sich schnell körperlich, ob in einer veränderten Muskelspannung, nachlassenden Abwehrkräften oder der Neigung zu Infekten. „Das hat mit Einbildung nichts zu tun“, sagt Marcus Schiltenwolf, auf konservative Behandlungen spezialisierter Orthopäde an der Universitätsklinik Heidelberg. Die seelische Verfassung verrät mehr über die Anfälligkeit für Rückenprobleme als das Skelett, wie etliche Studien inzwischen zeigten. Zudem begünstigen die Menschen mit vielen Verhaltensmustern die Entstehung von Rückenschmerzen.
Orthopäden der Universität Stanford haben sich gefragt, ob sie an symptomfreien Menschen erkennen können, welche von ihnen bald Rückenschmerzen entwickeln werden4. Fünf Jahre lang beobachteten sie Freiwillige, die anfangs keinerlei Beschwerden hatten. Dann zeigte sich der verblüffende Befund, dass sich mit dem Persönlichkeitsprofil künftige Rückenschmerzen am besten vorhersagen lassen. Wer zurückhaltend und ängstlich war und kaum Emotionen zuließ, erwies sich als besonders anfällig. Die üblichen Kriterien der Orthopäden waren hingegen kaum tauglich für eine Prognose: Weder Veränderungen im Röntgenbild noch ein verkleinerter Zwischenwirbelraum noch die Schmerzempfindlichkeit war aussagekräftig für eine spätere Pein im Kreuz.
Wenn fehlende Anerkennung zur Last im Kreuz wird
Psychische Faktoren sind für die Entstehung von Rückenschmerzen weitaus wichtiger als mechanische. Chronischer Stress, Unzufriedenheit in der Beziehung, Ärger im Job – all das kann dazu führen, dass es in der Lende schmerzt. Besonders häufig werden Rückenschmerzen durch Gratifikationskrisen im Beruf ausgelöst: Man macht und tut und legt sich für das Unternehmen krumm, aber keiner bemerkt es.
Die fehlende Anerkennung schmerzt nicht nur psychisch. Wer sich dauerhaft bemüht, ohne belohnt zu werden, entwickelt besonders oft Schmerzen im Rücken. Dabei muss Anerkennung gar nicht materieller Natur sein, also eine Gehaltserhöhung. Anerkennende Worte, Anteilnahme und das Gefühl, ein wichtiger Bestandteil des Teams zu sein, sind hilfreicher als manche Schmerztablette.
Vor 20 oder 30 Jahren hätte diese Einschätzung zur Bedeutung der Psyche den meisten Orthopäden wohl nur ein müdes Kopfschütteln entlockt. Die Erklärungen über Ursachen und Beschwerden waren hauptsächlich mechanischer Natur: verkleinerte Gelenkräume, gekrümmte Achsen, Fehlbelastung, zu hohe Anspannung. Ist doch klar, 24 Wirbel, Kreuzbein, Bänder, Sehnen und Muskeln, die das Rückgrat zusammenhalten. Gerät die Balance durcheinander, meldet der Körper Alarm.
Der Unterschied zwischen Befinden und Befund
Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins. Keine anderen Beschwerden verursachen so viele Arbeitsausfälle und Frühberentungen. Eine riesige Branche lebt von Rücken-Patienten: Hersteller von Schmerzmitteln, Bandagen, Stützverbänden ebenso wie Möbelproduzenten, Fitnessstudios und Rückenschulen. In kaum einem Bereich der Medizin sind Befund und Befinden so unterschiedlich: In den Bildern von Röntgen, CT und Kernspin zeigen sich zwar starke „degenerative Veränderungen“ – aber dieser Verschleiß ist von einem gewissen Alter an normal und sagt kaum etwas darüber aus, ob jemand Beschwerden hat.
Etliche Studien haben belegt, wie wenig der medizinische Befund das Befinden der Patienten widerspiegelt. Einmal bekamen Radiologen und Orthopäden in der Schweiz Hunderte Röntgenbilder und CT-Aufnahmen zu sehen. In mehr als einem Drittel der Fälle erkannten die Mediziner krankhafte Prozesse, die eine Operation dringend erforderlich erscheinen ließen. Was die Knochenexperten nicht wussten: Ihnen wurden Aufnahmen von gesunden Studenten gezeigt, von denen keiner über Rückenschmerzen geklagt hatte. Radiologen finden bei mehr als einem Drittel der Erwachsenen Veränderungen der Wirbelsäule, die auf den ersten Blick krankhaft zu sein scheinen, aber eigentlich keine Therapie erfordern.
Nahezu die Hälfte aller 50-Jährigen hat sogar einen Bandscheibenvorfall, aber keinerlei Beschwerden, wie Analysen von Röntgen- und CT-Bildern ergeben haben. Rückenschmerzen sind zu 90 Prozent „unspezifisch“, was so diffus ist, wie es klingt – es lässt sich schlicht keine Ursache dafür finden. Dabei sind Rückenschmerzen mit etwa 40 Prozent die häufigste Diagnose beim Orthopäden. Die Patienten sehnen sich nach einer Erklärung, wollen wissen, warum es sie so sehr im Kreuz plagt. Der Arzt weiß es auch nicht – und ordnet Untersuchungen an: Kernspin, CT, Kontrastmittel. Und der Patient legt sich seine eigene Theorie zurecht: zu viel Arbeit, zu viel Sitzen, manchmal auch eine zu große Last zu schultern.
Dann verstärken Physiotherapie, Schonung, Rücksichtnahme und Krankschreibung die Überzeugung, krank zu sein. „Sekundären Krankheitsgewinn“ nennen Ärzte das Phänomen, wenn die Zuwendung nach einer Diagnose den Patienten nutzt. Dabei wäre es von entscheidendem Nutzen für die Patienten, „wenn man ihnen sagt, dass ihre Beschwerden zu 99,9 Prozent harmlos sind und meistens von allein wieder verschwinden“, sagt Orthopäde Eysel.
Doch statt in ihr Inneres zu horchen, kämpfen viele Leidende nur mechanistisch gegen ihre Beschwerden an. Sie machen Kraftübungen und versuchen, muskuläre Schwachstellen und andere Problemzonen auszugleichen. Bewegung und Training tun den meisten Menschen zweifellos gut. Doch wenn die Seele schwächelt, hilft eine Stärkung der Lendenmuskeln auch nicht weiter.
Die Schmerzkarriere von Patienten mit Leiden an der Lendenwirbelsäule hängt stark von psychischen Faktoren ab. Patienten, denen es chronisch schlecht geht, haben oft noch weitere psychosomatische Beschwerden. Sie suchen mehr Ärzte auf als der gleichalte Durchschnitt und leiden öfter an Ängsten oder Depressionen. „Schmerz entsteht nicht dort, wo er wahrgenommen wird“, sagt der Schmerzexperte Ulrich Egle. Weil der seelische Zustand die Knochengesundheit so stark beeinflusst, ist der Erfolg von Operationen bei Rückenschmerzen ziemlich bescheiden. Bis zu 20 Prozent der Bandscheibenoperationen enden für die Patienten mit unbefriedigenden Ergebnissen; sie haben auch weiterhin Beschwerden. Die schlechte Quote hat einen ganz einfachen Grund: Wenn der Schmerz seine tiefere Ursache in Stress und psychischem Leid hat, hilft eben auch kein Skalpell.
Das Verhalten bei Rückenschmerzen ist ebenfalls wichtig dafür, wie sich die Beschwerden entwickeln – ob sie bald wieder verschwinden oder chronisch werden. Wer unzufrieden ist, oft hadert und immer das Gefühl hat, im Wartesaal des Lebens zu versauern, dessen Wahrscheinlichkeit für Rückenschmerzen steigt um das Siebenfache. Wer im Job darunter leidet, nicht genügend Anerkennung zu bekommen, ist zusätzlich gefährdet. Werden die Schmerzen chronisch, verstärkt sich das Gefühl, sich in einer ausweglosen Situation zu befinden.
Schmerzgeplagte sollten es unbedingt vermeiden, zu „katastrophisieren“. Darunter verstehen Ärzte das Vermeidungsverhalten von Kranken, die ängstlich-passiv sind und hoffen, durch „Schonung“ und Zurückhaltung dem Schmerz zu entkommen. Sie rechnen geradezu damit, dass ihnen weitere Aktivität schadet – und machen es damit nur umso schlimmer. Oft lehnen solche Patienten auch ihren eigenen Körper ab, weil sie ihn mit Schmerz in Verbindung bringen. „Rückenschmerzen überdecken oft Wut, Aggression oder Trauer“, sagt Carl Scheidt, Professor für Psychosomatik an der Universitätsklinik Freiburg. „Wenn Patienten solche verborgenen Gefühle zulassen, geht es ihnen oft besser.“ Hilfreich ist es, aktiv zu sein und alle Bewegungen auszuprobieren, solange sie nicht schmerzhaft sind – und darauf zu vertrauen, dass es bald zur Besserung kommt.
Was die Rückenschmerzen fördert
Psychosomatisch geschulte Ärzte kennen diverse Faktoren, die Rückenschmerzen begünstigen: a) Das Lernen von Vorbildern. Wie haben sich Eltern und Geschwister bei Schmerz und Krankheit verhalten? Haben schon kleine Wehwehchen massive Ängste in der Familie ausgelöst? Hat sich die Mutter mit Kopfschmerzen immer sofort aufs Sofa gelegt, wird dieses Verhalten oft nachgeahmt. b) Der „emotionale Kontext“. Wer beispielsweise in einer Familie aufgewachsen ist, die kaum Gefühle gezeigt und zugelassen hat oder schmerzhafte Trennungen erlebt hat, neigt dazu, auf spätere Belastungen selbst mit Beschwerden zu reagieren.
c) Körperliche Bahnung. Schmerzen hinterlassen Spuren. Die Nervenfasern zur Weiterleitung von Schmerzen bekommen Übung und reagieren schneller, der Schmerz wird gleichsam „gebahnt“. Das Umfeld prägt sich mit ein. Entsteht Schmerz zumeist unter psychischer Belastung, wird auch dieses Muster erlernt. Die Regionen, in denen Schmerzen und Gefühle im Gehirn verarbeitet werden, sind benachbart. So entsteht eine Art negatives Netzwerk im Gehirn: Schmerz ist für den Körper Stress und bedeutet schlechte Laune. Ein Teufelskreis, denn Angst vor Schmerz verstärkt den Stress und dieser wiederum den Schmerz. Irgendwann ist das Muster so eingeübt und Stress kann Schmerz auslösen.
Leider ist der Körper auch gut darin, sich negative Muster zu merken. Im limbischen System werden Schmerzreize mit Gefühlswahrnehmungen verknüpft. Dort entscheidet sich, in welcher Intensität der Schmerz aus der Peripherie überhaupt in das Bewusstsein gelangt und wie stark es wehtut. Dort wird ausgesiebt, welche Impulse überhaupt im Gehirn ankommen. Gesunde verfügen über etliche Barrieren, die den Schmerz auf seinem Weg zum Gehirn stoppen. Er kommt einfach nicht rein.
Ähnlich wie ein Türsteher Menschen daran hindert, in den Club zu gelangen, gibt es hemmende Nerven, die nur dazu da sind, eingehende Schmerzreize abzuwehren. Sie unterdrücken die Schmerzweiterleitung auf der Ebene des Rückenmarks. Als „Gate-Control-Theorie“ wird dieses nützliche Phänomen bezeichnet. Negative Gefühle, chronische Belastungen und Schmerzerfahrungen machen jedoch die neuronalen Türsteher mürbe, bis deren hemmender Einfluss auf die Schmerzweiterleitung entfällt. Der Kontrollposten wird durchlässig.
Es erfordert ein Umdenken, aber die Entstehung von Schmerzen, besonders von Rückenschmerzen, verläuft nicht in einer Einbahnstraße von den peripheren Nerven zum Gehirn. Andersherum funktioniert es genauso – wenn die Gefühle und Erwartungsmuster „von oben“ in die Peripherie zurückgemeldet werden und damit interagieren. Deshalb kann auch frühkindliche Gewalt Rückenschmerzen begünstigen. Ärzte für Psychosomatik wissen, dass unter Erwachsenen mit unklaren Schmerzsyndromen überdurchschnittlich viele als Kinder Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Auch Kinder kranker Eltern, die in dieser schwierigen Phase psychisch nicht aufgefangen wurden, sind vermehrt darunter. Sogar die neurobiologische Reifung des Gehirns ist in hohem Maße von sozialen und psychischen Umweltbedingungen abhängig.
Auf den ersten Blick sind manche Reaktionen auf Schmerzen zwar sinnvoll, beispielsweise sich zu schonen, wenn es wehtut. Was akut hilft, schadet bei chronischen Schmerzen jedoch. Vielmehr müssen Patienten lernen, dass sie keine Angst mehr vor Schmerzen haben sollten. „Wenn sie ihr Vermeidungsverhalten beenden, steigt die Schmerzschwelle langsam wieder“, sagt Orthopäde Schiltenwolf. Es handelt sich allerdings um einen Prozess, der dauern kann, eine Blitzheilung ist nicht zu erwarten. Dafür ist es besonders wohltuend, nach langer Zeit zu spüren, wenn der Schmerz endlich nachlässt.
Warnsignale bei Rückenschmerzen
Nicht für alle Schmerzen sind psychische Faktoren wie Stress oder Unzufriedenheit im Job verantwortlich. Bei folgenden Symptomen sollten Sie baldmöglichst einen Arzt aufsuchen:
Lähmungen oder Taubheitsgefühl
neurologische Störungen wie Blasen- oder Enddarmschwäche
trotz Behandlung nehmen die Schmerzen stark zu
nach einem Unfall oder Sturz treten Schmerzen neu auf
Schmerzen bei schweren Erkrankungen wie Krebs
Schmerzen bei starkem Fieber oder Entzündungen, dazu gehören auch entzündliche rheumatische Erkrankungen