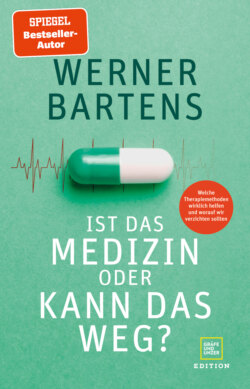Читать книгу Ist das Medizin oder kann das weg? - Dr. Werner Bartens - Страница 7
SCHLUCKEN KÖNNEN
ОглавлениеIn meiner Erinnerung ging es ganz schnell. Ich war noch nicht in der Schule, sondern vielleicht fünf Jahre alt und ging in den Kindergarten. Aber ich war schon „bei den Großen“, der letzte Jahrgang also. In meiner Erinnerung, die in diesem Alter natürlich trügerisch ist (wie später übrigens auch), war ich nur selten krank. Ab und zu hatte ich eine leichte Erkältung. Wenn ich doch mal länger erkältet war oder heftig husten musste, ging meine Mutter mit mir zum Hausarzt.
Das Wartezimmer war wie immer voll, verstaubte Topfpflanzen mit plastikglatten Blättern standen in der Ecke, meistens dauerte es zwei oder drei Stunden, bis ich drankam. Ewigkeiten waren das. Manchmal schickte uns der Doktor mit der Empfehlung nach Hause, ich solle heiße Milch mit Honig trinken, über einem Kamillendampfbad inhalieren oder mich vor die Höhensonne setzen.
Das Dampfbad konnte ich nur schwer ertragen, denn es war am Anfang furchtbar heiß und ich musste dafür alte Handtücher über den Kopf ziehen. Anders als die weichen Frotteetücher, in die ich mich nach dem Baden hüllte, wurde zum Inhalieren nur Ausschussware benutzt, die bald als Putzlumpen verwendet werden würde. Es waren raue, schroffe Tücher, und wenn nach wenigen Minuten die Haare von der feuchten Kamillenluft seitlich an der Stirn klebten, scheuerte es auf der Haut. Die nassen Haare und das harte Handtuch: Ich hasste es. Alle 30 Sekunden lugte ich unter dem Tuch hervor und rief im Dampf nach meiner Mutter: „Wie lange noch?“
Wenn der Hausarzt keine Lust hatte, uns an die bewährten Hausmittel zu erinnern, oder meine Mutter aufgeregter war als sonst, verschrieb er mir Antibiotika gegen die Erkältung. Das war (und ist bis heute) ein Klassiker der ärztlichen Fehlbehandlung, denn auch damals war bekannt, dass Antibiotika nur gegen Bakterien helfen, nicht gegen Viren. Fast alle Erkältungsleiden mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit werden aber von Viren ausgelöst. Rotz, Schnodder und rauer Hals verschwinden nicht schneller, wenn man Antibiotika einnimmt. Dann bilden sich nur schneller Resistenzen gegen die Medikamente. Das hat dazu geführt, dass etliche Antibiotika nicht mehr wirken, wenn sie gebraucht werden, weil etliche Bakterien resistent dagegen geworden sind.
Die Legende, dass Antibiotika bei viralen Infekten trotzdem sinnvoll sein können, um bakterielle Superinfektionen zu verhindern, stimmt auch nicht. Es ist schlicht unsinnig und gefährlich, bei Erkältung diese Arzneimittel zu geben, auch wenn sie ansonsten in vielen Bereichen der Medizin ihre Berechtigung haben und sinnvoll sind.
Ich bekam also dicke, rot-blau lackierte Tabletten, die ich „einnehmen“ sollte. Das bedeutete: schlucken. Sie glänzten angriffslustig in ihrer Lackhülle und ihr Aussehen erinnerte mich an bunte U-Boote, die bedrohlich aufgereiht neben meinem Teller lagen, weil ich sie zum Essen nehmen sollte. „Mit viel Flüssigkeit zu den Mahlzeiten“, wie es bis heute gerne in den Beipackzetteln heißt.
Antibiotika gegen grippalen Infekt – wie lange noch?
Es ist der Klassiker in der Oberstufe und im Medizinstudium. Wer es dann noch nicht kapiert hat, bekommt es in der Ärztefortbildung zu hören: Antibiotika helfen nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Da fast alle banalen Atemwegsinfekte von Viren ausgelöst werden, bringt es nichts, Patienten mit Bronchitis oder Erkältung Antibiotika zu geben. Im Gegenteil: Neben akuten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall und Unverträglichkeit drohen Resistenzen. Zudem ist die Umweltbelastung erheblich, da einige der Mittel nur langsam abgebaut werden.
Harvard-Mediziner haben untersucht, wie oft in den USA Antibiotika gegen Halsschmerzen und akute Bronchitis verordnet werden. Sie kommen zu dem ernüchternden Ergebnis, dass von 1996 bis 2010 gleichbleibend oft Antibiotika verschrieben wurden, Tendenz steigend1. „Obwohl es klare Beweise dafür gibt, dass sie unwirksam sind, obwohl die Richtlinien davon abraten und obwohl wir seit zwei Jahrzehnten unsere Fortbildung darauf ausrichten, dass die Antibiotika-Verordnung bei akuter Bronchitis null sein sollte, betrug die Häufigkeit in den vergangenen 15 Jahren ungefähr 70 Prozent und stieg in dieser Zeit sogar an“, sagt Michael Barnett, der an der Studie beteiligt war.
In Deutschland ist die Situation ähnlich – außer dass die Datenbasis nicht so gründlich aufgearbeitet wird wie in den USA. Ärzte hierzulande geben in 50 bis 75 Prozent der Fälle Antibiotika gegen banale Erkältungsleiden, obwohl damit Patienten nicht geholfen, sondern geschadet wird. Argumente dagegen kann man überall finden: Die Initiative „Choosing Wisely“, die gegen überflüssige Medizin zu Felde zieht, erklärt, warum Antibiotika gegen akute Bronchitis nichts ausrichten (choosingwisely.org). Und in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin wird dargelegt, dass bei Bronchitis und bis zu acht Wochen dauerndem Husten die Medikamente zu meiden sind. Erst bei einer Lungenentzündung sind Antibiotika wichtig und hilfreich. Nein, auch eine Superinfektion in Folge der Bronchitis wird durch Antibiotika nicht gelindert.
Weil die Warnungen seit Jahrzehnten wiederholt werden, ist sogar den nüchternen Leitlinien Unverständnis anzumerken, warum sich am Verschreibungsverhalten nichts ändert. Der „Arzneiverordnungsreport“ vermerkt regelmäßig, dass im Vergleich zum Vorjahr mehr Antibiotika verordnet wurden und im ambulanten Bereich Atemwegsinfektionen Hauptgrund für eine Verschreibung bleiben. Lapidar merken die Autoren an: „Der Hinweis, dass im Unterschied zur Lungenentzündung akute obere Atemwegsinfektionen, vor allem die akute Bronchitis, in mehr als 90 Prozent der Fälle durch Viren ausgelöst werden und daher keine primäre Indikation für Antibiotika darstellen, bleibt wichtig und ist aktuell nochmals bestätigt worden.“
Es war eine Qual. Ich ahnte vermutlich, dass diese Torpedos aus den Laborküchen der abendländischen Pharmazie nichts in meinem Körper zu suchen hatten. Keine Chance. Ich leerte mehrere Becher Kakao, trank literweise Sprudel und Sirup, um die Filmtabletten herunterzuwürgen. Nichts passierte, die Dinger blieben oben – oder auf dem Grund der Tasse, wo sie rot-blau schimmernd ein Farbarrangement mit den feuchten braun-schwarzen Kakaoklumpen bildeten, die immer zurückbleiben, wenn Kinder Kakao in der Tasse anrühren.
Nach etlichen vergeblichen Versuchen war der Lack ab, die Tabletten wurden grau. Sie erinnerten mich mit ihrer derangierten Hülle vorwurfsvoll daran, dass sie immer noch nicht den Weg in meinen Verdauungstrakt gefunden hatten.
Meine Mutter versuchte, die widerspenstigen Teile in Kartoffelbrei, Erdbeeren oder anderes Essen einzuschmuggeln. Früchte, Gemüse oder das Innere von Brötchen lutschte ich ab, in denen meine Mutter die Tablette versteckt hatte. Doch die Pille selbst blieb wie ein bewachter Gefangener in meiner Mundhöhle liegen, bis ich sie irgendwann ausspuckte. Ich wollte und konnte die Tabletten nicht schlucken.
Meine Mutter buchstabierte sich durch den Beipackzettel, wo mit bedrohlichem Unterton befohlen wurde, dass die Pillen „unzerkaut“ zu sich genommen werden mussten. Über Stunden zog sich diese Prozedur hin, doch ich schaffte es einfach nicht und entwickelte eine Vielfalt an Würgereizen, Globusgefühlen und beängstigenden Halszuschnür-Attacken, um den Medikamenten den Zugang zu meinem Innersten zu verwehren. Vielleicht habe ich damals intuitiv eine Skepsis gegenüber den Segnungen der Pharmaindustrie entwickelt.
Als wir das nächste Mal beim Arzt waren, weil ich zum wiederholten Male erkältet war und meine Mutter dringend eine dauerhafte Lösung für meinen empfindlichen Hals wollte, fragte der Doktor scheinbar nebenbei: „Kann er denn gut schlucken?“ Meine Mutter schüttelte vehement den Kopf. Sie hatte das Drama in endlosen Akten vor Augen, wenn ich zu Hause Kapseln, Pillen oder Tabletten einnehmen sollte.
Ich fühlte mich übergangen, bekam es aber auch nicht hin, gleich und erfolgreich zu protestieren. Eigentlich hatte ich sagen wollen, dass meine Schluckbeschwerden nur für Tabletten gelten würden und ich sonst sehr gut beachtliche Bissen zu mir nehmen konnte und in großen Schlucken trinken. Aber es war zu spät. Mit der lebhaften Schilderung meiner Mutter war die Diagnose für den Arzt klar. Keine Chance: „Dann müssen dem Jungen die Mandeln rausgenommen werden.“
Schon bald darauf wurde ich ins Städtische Krankenhaus gebracht und teilte mir ein Sechsbettzimmer mit anderen Kindern, von denen ein gleichaltriges Mädchen nicht schlafen konnte und sich nicht trösten ließ. Die ganze Zeit weinte es und stieß mit einer Schaukelbewegung im Vierfüßlerstand den Kopf vor und zurück auf das Kissen. Die Besuchszeit war streng geregelt und betrug auch für uns Kinder im Vorschulalter eine Stunde zwischen 15 und 16 Uhr, was aus heutiger Sicht ein Wahnsinn ist, aber das ist eine andere Geschichte.
Wir wurden damit getröstet, dass es nach der Operation regelmäßig Eis geben würde, doch das Mädchen weinte und schaukelte weiter. So bekam ich früh eine Ahnung davon, wie sich Hospitalismus äußern kann – auch jenseits von Kinderheimen in rumänischen Diktaturen. Und ich verlor im zarten Alter von fünf Jahren meine Mandeln, was aus medizinischer Sicht vermutlich völlig unnötig war.