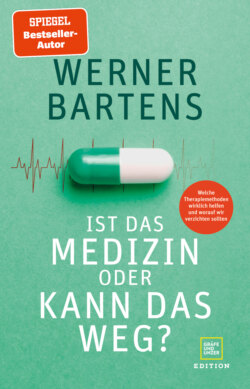Читать книгу Ist das Medizin oder kann das weg? - Dr. Werner Bartens - Страница 5
DIE ÄRZTE MEINER KINDHEIT
Оглавление„Ohne Betäubung?“ Mein Großonkel konnte es nicht fassen. Er hatte einige Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft zugebracht und wusste, was Menschen aushalten können. „So ein Hund!“ Mit dem Hund war der Arzt gemeint, der schnörkellos vorging, nachdem ich im Alter von 13 Jahren einen Pfosten mit dem Vorschlaghammer in den Boden rammen wollte, was leider schiefging. Dabei war der Plan gut gewesen. Ich hatte vor, im Garten eine Begrenzung für den Kompost zu bauen. Den Pfosten hielt mein Schulfreund Ralf, in der Schule ein Physik-Genie, im Alltag aber nur mäßig praktisch veranlagt.
Ralfs geschultem Auge für Geometrie fiel irgendwann auf, dass der Pfosten schief stand. Leider bemerkte er das erst, als ich schon ausgeholt hatte. Deshalb korrigierte er die Position des schon im Boden steckenden Holzpfahls mit einem Tritt. Der Pfosten bewegte sich eine Handbreit in meine Richtung. Prima, der Pfosten stand jetzt gerade, doch meine linke Hand, die ich nahe am Hammerkopf hielt, geriet dadurch zwischen den Pfosten und den nach unten sausenden Hammer – zumindest der linke Zeigefinger, der den Holzstiel an der Unterseite des Schlagwerkzeugs hielt.
Schon bald bildete sich eine Quetschwunde am Zeigefinger, die sich erst rot, dann blau färbte und schließlich nach Kompost aussah. Mein Finger fühlte sich taub an, er blutete, pochte, hämmerte und brannte, alles gleichzeitig. Auch seine Umrisse sahen nicht mehr so aus wie vorher. Ein münzgroßer Hautlappen hing seitlich hinunter.
Meine Mutter, die gerade dabei war, Obst einzukochen, schreckte hoch und fuhr mit mir sofort zu unserem Hausarzt in den Nachbarort. Diesmal musste ich nicht lange warten, bis ich drankam. Im Arztzimmer vereiste der Doktor das Fingerglied mit Kältespray, dann schnitt er kurzerhand den herunterhängenden Hautlappen ab. Ohne Betäubung. Ich schaute der Behandlung interessiert zu, als ob es sich nicht um meinen eigenen Finger handeln würde, der da verarztet wurde. Die Prozedur dauerte nicht mal zwei Minuten. Und um ehrlich zu sein: Es hat kaum wehgetan. Vermutlich war der Finger von dem Schlag bereits betäubt genug. Die Narbe, die davon zurückblieb, war ein paar Monate später kaum noch zu erkennen.
Die Ärzte meiner Kindheit waren beeindruckend. Manche von massiger Statur, alle aber immer auf einschüchternde Weise kompetent und gelassen. Nie habe ich einen von ihnen hektisch erlebt. Sie schienen inmitten des größten Trubels in sich zu ruhen, vermutlich waren sie das ländliche Vorbild für die Notfallmediziner in „Emergency Room“. Dabei war das Wartezimmer ihrer Dorfarztpraxen eigentlich immer voll, es gab fast nie freie Plätze und manchmal musste man als Kind ein paar Minuten stehen, bis ein Stuhl geräumt wurde. Dort saßen die vielen anderen Patienten, die ich immer argwöhnisch musterte, weil sie gemeinerweise vor mir drankamen.
Jedes Mal, wenn einer der Wartenden aufgerufen wurde, zählte ich nach, wie viele es noch waren. Manchmal schien einer vor uns dranzukommen, obwohl er erst später im Wartezimmer erschienen war. Blasse und Blutende waren unter den Wartenden, auch Bauarbeiter oder Bauern, die in Gummistiefeln von ihrer Arbeit auf dem Feld kamen. Andere hielten sich den Arm oder den Bauch, aber die meisten sahen normal aus, sodass man ihnen ihre Beschwerden nicht ansehen konnte. Ich fragte mich, „was denen wohl fehlt“, wie meine Mutter es ausdrückte. „Was sie hatten“, sagte ich dazu – so kannten wir es vom Fußball, wenn einer „markierte“ und nur so tat, als ob er hart gefoult worden war, und ihm gar nichts weh tat. „Weitermachen, der hat nichts“, hieß es dann.
War man endlich an der Sprechstundenhilfe vorbei ins Arztzimmer vorgedrungen, betrat man eine andere Welt. Hier war keine Unruhe und kein Geraschel der bunten Zeitschriften mehr zu hören. Erst war man alleine ohne Arzt, umgeben von weiß lackierten Schränken mit Glastüren. Irritierend war das klebrige Kunstleder auf den Hockern und Liegen. Es war dunkelbraun oder dunkelgrün und manchmal bröckelte es am Rand. In den Glasschränken waren Spritzen und Instrumente, von denen ich hoffte, dass sie nicht zum Einsatz kommen würden.
Dann Auftritt: Herr Doktor. Unser Hausarzt war ein beleibter Mann, bei dem der liebe Gott vergessen hatte, einen Hals zwischen Kopf und Oberkörper zu schrauben, und den meine Mutter ehrfürchtig mit „Herr Doktor“ ansprach, immer ohne Nachnamen. „Herr Doktor“ hier, „Herr Doktor“ da. Doch Herr Doktor hatte die Ruhe weg. Egal, wie viele Patienten draußen warteten und wie sehr meine Mutter ihn löcherte.
Wenn sie wortreich darüber klagte, dass ich so oft erkältet sei und dieser „olle Husten“ nicht verschwinden würde, erzählte der Arzt in ernsten Worten eine Geschichte, die meine Mutter zum Verstummen bringen sollte. Der Hausarzt war auch mal klein gewesen. „Wir sind als Kinder bei fünf Grad durch die Oder geschwommen“, sagte er und machte eine Pause. „Auf der Flucht. Die Russen keine fünf Kilometer hinter uns.“
Ich wusste nicht, was die Russen mit meiner Erkältung und dem ollen Husten zu tun hatten, außerdem war ich im Schwimmverein, insofern beeindruckte mich seine Flussdurchquerung nicht besonders. Und wenn die Russen noch fünf Kilometer weg waren, war der Vorsprung so knapp auch wieder nicht. Aber meine Mutter verstand das Signal. Es sollte wohl bedeuten: Nicht so anstellen, es gibt Schlimmeres.
Hatte ich Bauchweh, sagte der Doktor „Geht wieder weg“ und empfahl „Schonkost“. In meiner Erinnerung bestand Schonkost aus Zwieback und Kamillentee am ersten Tag, Kamillentee und Zwieback am zweiten Tag und aus Kartoffelbrei mit Möhren und Spiegelei als Aufbaukost. Es musste breiig und weich sein. Zudem sagte er gerne „Hunger ist der beste Koch“, wenn er keine ausführliche Antwort geben wollte auf die Frage meiner Mutter, was der Junge mit seinem prekären Magen-Darm-Trakt in den Schonkosttagen „Richtiges“ essen sollte. „Wird schon wieder“, sagte er eigentlich jedes Mal. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was ein Arzt sagen kann.
Einen Kinderarzt hatten wir nicht, da ging es uns ähnlich wie den meisten Kindern meiner Umgebung. Das hielten wir für unnötigen Luxus, den sich allenfalls „bessere Leute“ leisten würden. Außerdem: Was sollte ein Kinderarzt schon können, was der normale Arzt nicht konnte? Waren wir anders als die Erwachsenen? Schulfreund Ralf, der Physik-Experte, der meine Verletzung am Finger später mit Achsenberechnungen des Holzpfahls zu kommentieren wusste, konnte die Fähigkeiten seines Kinderarztes auch nicht erklären. Der würde „zusätzliche Untersuchungen“ machen, sagte er, wenn ich fragte; und das deutete schon schwer auf mögliche Überdiagnostik und Übertherapien hin.
Zum Zahnarzt meiner Kindheit ging ich nicht gerne, wer tut das schon? Er arbeitete ohne Handschuhe und Maske, das war damals so üblich. Allerdings muss gesagt werden, dass die Spritzen, mit denen er mein Gesicht halbseitig lähmte, im Vergleich zu heute einen unfassbar großen Durchmesser hatten. Sie taten tatsächlich teuflisch weh, weil sie erst Bruttoregistertonnen an empfindlichem Gewebe zur Seite drängen mussten, damit sich die Hohlnadel in meinen Gaumen bohren konnte.
Allerdings hatte der Zahnarzt einen Vorteil. Er hörte auf den Namen „Schreier“ und machte immer den Witz, dass in seiner Praxis ausschließlich der Arzt schreit. Deshalb müssten seine Patienten nicht mehr schreien. Eine Weile glaubte ich das tatsächlich, auch wenn er eigentlich nie schrie, während er mich behandelte, sondern allenfalls streng guckte.
Ebenso vertraute ich auf unseren Zahnarzt, als ich mich im Grundschulalter davor fürchtete, dass abends Einbrecher kommen und unser Haus heimsuchen würden. Meine Mutter zerstreute meine Sorgen, indem sie erklärte, dass es bei uns nichts zu holen gebe und sich Einbrecher überlegen würden, wen sie ausrauben und welche Beute dort zu erwarten sei. Der Zahnarzt hatte kostbare Teppiche, teure Kunstwerke und wertvolles Besteck, sodass die Einbrecher es eher dort als bei uns versuchen würden, wenn sie nicht blöd waren. Ich war beruhigt, auch wenn mich der Gedanke beschäftigte, wieso Diebe Besteck klauen sollten.
Weshalb ich von den Doktoren berichte, mit denen ich es damals zu tun hatte? Egal wie handfest, stoisch, manchmal wohl auch wenig einfühlsam diese Ärzte gewesen sein mögen – während meiner Kindheit und Jugend wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass sie etwas tun könnten, was mir hätte schaden können oder auch nur unnütz gewesen wäre. Mein Vertrauen und das unserer Familie in die besten Absichten der Doktoren war unerschütterlich. Was sollten sie auch vorhaben, wenn nicht uns beizustehen und uns zu helfen, wenn es wehtat oder wir in Not waren?
Ärzte sind dazu da, um zu helfen, zu lindern und zu retten. Das ist ihre Aufgabe, und der kommen sie bei allen individuellen Schrullen und Fähigkeiten auch nach. Andere Motive zählen für sie nicht. Daran hatte ich keinerlei Zweifel. Klar, manchmal taten sie einem weh, aber dann musste es eben sein. Dass ihr Tun unnütz oder gar schädlich sein könnte, auf diese Idee kam ich nicht. Und wahrscheinlich geht es den meisten Menschen so, dass sie auf ihre Ärzte zählen und sich vertrauensvoll in ihre Hände begeben. Die Vorstellung, dass Mediziner etwas tun, das nicht im Sinne der Patienten ist, ist gewöhnungsbedürftig. Bei mir war es ein weiter Weg, bis ich diesen Gedanken zuließ.
Das muss betont werden, denn viele Ärzte handelten und handeln aus Idealismus, Nächstenliebe und ziehen tiefe Befriedigung daraus, zu helfen und anderen beizustehen. Sie opfern nicht nur die übliche Arbeitszeit, sondern manchmal auch die Nächte und Wochenenden für ihre Patienten. Viele machen Hausbesuche. Sie wissen, dass sie nicht nur verletzte Körper heilen, sondern für viele Patienten auch der Arzt für die Seele sind, wichtiger Gesprächspartner und verschwiegener Trostspender. Sie wollen niemandem schaden oder gar Gefährliches tun.
Und die Medizin hat besonders in den letzten Jahrzehnten viel Gutes getan. Wer wie ich 1966 zur Welt kam, hatte zwar nur selten das Vergnügen, dass sein Vater bei der Geburt anwesend war. Das galt als modernes Zeug und kam nur in Ausnahmen vor. Immerhin war die Kindersterblichkeit in Europa bereits stark gesunken, sodass einem gesunden Start in die Welt wenig im Wege stand.
Es gab Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen, Aufbaunahrung für Babys und Schonung für die Mütter. Die 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre waren eine Epoche des rasanten Fortschritts. In diesen Jahren wurde der Herzschrittmacher entwickelt, Kernspin und Computertomografie erlaubten zuvor ungeahnte Einblicke in den Körper, in Südafrika wurde erstmals ein Herz transplantiert. Etliche Arzneimittel wurden entwickelt, die den Menschen das Leben erträglicher und sie gesünder machen würden. Etliche Medikamentenklassen wurden neu entwickelt, allein im Bereich der Blutdrucksenker und Herzmittel kamen komplette Gruppen wie die Betablocker, die Kalziumantagonisten oder die ACE-Hemmer hinzu.
Vermutlich gab es kaum eine Ära in der Medizin, in der es so viele relevante wissenschaftliche Neuerungen und Entdeckungen gab wie in den Jahren zwischen 1950 und 1980. Überdies zeigten sich die rasanten Entwicklungen schon in kurzer Zeit als konkrete Verbesserungen für Patienten und wurden direkt am Krankenbett umgesetzt und zur Routine in der ärztlichen Versorgung. Ein goldenes Zeitalter, geprägt von Technikeuphorie, Fortschrittsglaube und Zuversicht in die nahezu unendlichen Möglichkeiten der Medizin, war angebrochen. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Neuerungen und Weiterentwicklungen stagnierten oder immer kleinteiliger wurden. Für diesen Umbruch gibt es kein genaues Datum, etwa ab 1990 verstärkte sich dieser Prozess; ab dem Jahr 2000 war er immer deutlicher zu beobachten.
Auch deshalb kommt es gerade in wohlhabenden Ländern oft zu unnötigen Operationen, fragwürdigen Tests, überflüssigen Untersuchungen, schlicht: zu schlechter Medizin. Es sind Fehler im System, intransparente Strukturen und falsche Anreize, die dazu beitragen, dass Patienten manchmal die falsche Behandlung bekommen, ohne Not operiert werden oder sich fragwürdigen Prozeduren unterziehen müssen.
Vom Bestseller in die Nische
Die Pharmaindustrie hat auf die ausbleibenden Innovationen reagiert. Andrew Witty, Vorstandsvorsitzender des Arzneimittelmultis GlaxoSmithKline, erklärte 2008, dass es die Aktionäre des Unternehmens nicht länger akzeptieren würden, wenn Investitionen keinen Nutzen einbringen. Deshalb änderten etliche Konzerne ihre Strategie: Statt Forschung und Entwicklung auf Blockbuster auszurichten und Mittel zur Behandlung von Volkskrankheiten auf den Markt zu bringen, sollten verstärkt „Nichebuster“ verkauft werden: Teure, neue Medikamente für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Da die Zielgruppe begrenzt ist, wurde sie erweitert. Häufige Leiden, darunter zahlreiche Krebserkrankungen, wurden nach dem Prinzip Salamitaktik in immer kleinere Tumorleiden aufgeteilt, bis sie als „selten“ galten. Die Politik sekundierte mit Förderprogrammen für seltene Leiden. Der Nutzenbeweis blieb jedoch auch in der Nische aus: Von 18 Medikamenten mit neuen Wirkstoffen, die 2010 in Deutschland auf den Markt kamen, erhielten nur 5 vom „Arzneiverordnungsreport“ das Etikett „therapeutisch relevant“. In Frankreich galten nur 17 von 104 Innovationen als „womöglich hilfreich“, wie das pharmazeutische Fachmagazin „Revue Préscrire“ ermittelte. Die bisherige Standardtherapie ersetzte keines der neuen Mittel.
Patienten profitieren immer öfter nicht mehr davon, wenn neue Geräte oder Arzneimittel auf den Markt kommen. Und nach und nach zeigt sich, dass etliche Eingriffe, Operationen und Untersuchungen nicht notwendig sind, sondern aus Gewohnheit und falschen Traditionen angeordnet werden, sodass sich immer öfter die Frage stellt: Ist das Medizin – oder kann das weg?