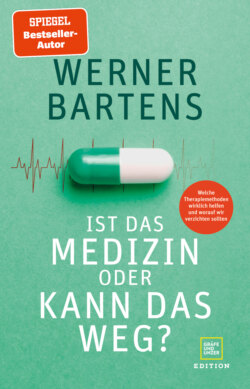Читать книгу Ist das Medizin oder kann das weg? - Dr. Werner Bartens - Страница 8
DER RASCHE GRIFF ZUM SKALPELL
ОглавлениеEs ist nicht leicht, gesundheitlich unversehrt erwachsen zu werden, wie das Beispiel meiner frühzeitigen Operation an den Mandeln zeigt. Auf dem Weg dahin drohen schließlich nicht nur Unfälle und diverse Krankheiten, sondern man kann als Kind auch ruckzuck seine Mandeln verlieren, sobald man über Halsschmerzen klagt und besorgte Eltern, hyperaktive Ärzte oder beides hat. Kann schließlich nicht schaden, wenn sie weg sind, so die verbreitete Meinung. Man braucht sie nicht unbedingt und sie machen nur Ärger, so die zumeist negative Einschätzung zu den Ausstülpungen im Mund- und Rachenraum. Inzwischen ist bekannt, dass die mit Immunzellen angereicherten Organe einen ersten Abwehrring am Eingang des Rachens bilden, bevor Luft oder Nahrungsmittel weiter in das Körperinnere gelangen.
Lange Zeit wurden Mandeln schnell entfernt, doch mittlerweile sind die Nachteile des Eingriffs gut belegt. Trotzdem wird die Operation deutschlandweit immer noch unterschiedlich häufig ausgeführt. Medizinische Gründe kann es dafür kaum geben.
Analysiert wurden die gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Tonsillektomie, wie die operative Entfernung der Gaumenmandeln im Fachjargon heißt, bisher eher selten. 2018 zeigte eine große Untersuchung, dass sich der mancherorts zur Gewohnheit gewordene Eingriff sehr wohl negativ auf das Befinden auswirken kann2. Die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen der Atemwege, Infektionen und allergisches Asthma steigt an, wenn die Mandeln entfernt worden sind. Ärzte der Universitäten Kopenhagen, Melbourne und Yale hatten Daten von mehr als 1,1 Millionen Kindern ausgewertet, die zwischen 1979 und 1999 in Dänemark geboren wurden. Fast 12. 000 davon wurden die Gaumenmandeln entfernt, mehr als 31.000 Kinder verloren sowohl Gaumen- als auch Rachenmandeln („Polypen“), 17.000 nur die Rachenmandeln.
Über mindestens zehn und bis zu 30 Jahre wurde weiterverfolgt, welche Krankheiten anschließend auftraten und ob ärztliche Behandlung nötig war, was aufgrund landesweiter Registerdaten in Dänemark und anderen skandinavischen Ländern einfacher möglich ist als anderswo. „Wer die Gaumenmandeln entfernt bekommen hat, leidet später öfter an Atemwegsinfektionen als Gleichaltrige ohne den Eingriff“, sagt Jacobus Boomsma, der an der Studie beteiligt war. „Auf fünf Operationen kommt eine zusätzliche Erkrankung.“ Die Frage, wie viele Eingriffe nötig sind, damit Patienten einen Nutzen haben oder bis Schaden eintritt, wird in der Medizinstatistik als „Number needed to treat“ bezeichnet. Ein Wert von fünf zu eins als „Number needed to harm“ gilt als vergleichsweise hoch.
Natürlich kann es Gründe geben, Mandeln oder Polypen zu entfernen, etwa wenn Schluckbeschwerden und eitrige Entzündungen immer wieder auftreten. Der Eingriff wurde und wird aber oft vorschnell und insgesamt zu oft ausgeführt. „Unsere Beobachtungen legen nahe, dass die Operation mit erhöhten Langzeitrisiken einhergeht“, sagt Sean Byars, Hauptautor der dänischen Untersuchung. „Das spricht dafür, den Eingriff – wenn möglich – hinauszuzögern, weil sich dann das Immunsystem noch weiterentwickeln kann und die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen im späteren Leben verringert wird.“ Rachen- wie Gaumenmandeln bestehen zu großen Teilen aus lymphatisch hochaktivem Gewebe. Wissenschaftler erkennen zunehmend, welch wichtige Rolle diese Strukturen im Aufbau des Abwehr- und Immunsystems spielen.
„Beim Thema Mandeloperation ist viel Irrationalität im Spiel“, sagt Reinhard Berner, Direktor der Unikinderklinik in Dresden. „In manchen Regionen in Deutschland gibt es komplett tonsillenfreie Schulen, kein Kind hat mehr seine Mandeln.“ Infektionsexperte Berner hat zusammen mit HNO-Ärzten und anderen Experten eine ärztliche Leitlinie zu Mandelentzündungen erstellt. Die kritische Bestandsaufnahme wurde keineswegs von allen HNO-Ärzten begeistert aufgenommen. Allerdings haben sich einige Kinderärzte um Berner dazu veranlasst gefühlt, nachdem der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2014 groteske Unterschiede in der Häufigkeit der Mandeloperationen offengelegt hatte, die sich seitdem immer wieder bestätigt haben.
In manchen Landkreisen Deutschlands wie Delmenhorst, anderen Gebieten in Niedersachsen, aber auch in Hessen, im Harz, in der Eifel und im Bayerischen Wald lag der Anteil der Kinder, die unters Messer kamen, mehr als zehnmal so hoch wie anderswo. Hielt sich die Verbreitung von Halsentzündungen an Kreisgrenzen? Fehlanreize, ökonomische Motive in kleinen Kliniken, in denen die Mandeloperation oft der häufigste Eingriff überhaupt war, und überkommene ärztliche Rituale bieten eine plausiblere Erklärung.
„Das war schon extrem auffällig“, erinnert sich Hartwig Bauer, ehemals Chefarzt in Altötting und einige Jahre Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. „Wir haben gelästert, dass es wohl an der rauen Seeluft liegen muss, wenn rund um Bremen zigmal so oft operiert wurde wie beispielsweise hier im Chiemgau.“ Bauer hat sich zwar selbst mit Anfang 20 die Mandeln herausnehmen lassen und davon seiner Ansicht nach ebenso profitiert wie seine Tochter, die sich auch operieren ließ. Im Rückblick auf seine jahrzehntelange Erfahrung in der Chirurgie sagt er aber auch: „Früher hat man nicht lange gefackelt, da wurde die Indikation viel zu breit gestellt und schnell operiert.“
Manchmal wurde der Eingriff lediglich in Lokalanästhesie vorgenommen, „das konnte furchtbar werden, regelrecht barbarisch“, so Bauer, der sich erinnert, wie das gut durchblutete Gewebe im Rachenraum manchmal in Mitleidenschaft gezogen wurde. Lief es gut und ohne Komplikationen, erinnern sich die Kinder vor allem daran, dass sie – auf medizinische Empfehlung – anschließend viel Eis essen sollten.
Mandeln raus oder nicht?
Heute gilt, dass es für die Entfernung der Rachenmandeln entscheidend ist, wie sehr die Mundatmung beeinträchtigt ist, ob es gar zu Atemaussetzern im Schlaf kommt oder ständig Mittelohrentzündungen drohen. Eine Operation der Gaumenmandeln sollte hingegen erst in Frage kommen, wenn mehr als sechsmal im Jahr Halsentzündungen auftreten, die von Bakterien wie Streptokokken ausgelöst werden und tatsächlich mit Antibiotika behandelt werden müssen.
Aber auch das ist nicht bei jedem Streptokokkenbefund nötig. Dass es sich um die kettenförmig angeordneten Bakterien handelt, dafür sprechen eitrige Belege, Fieber und ausbleibender Husten. „Hier hat ein Umdenken stattgefunden“, sagt Reinhard Berner, Chef der Unikinderklinik Dresden. „Zwar muss im Einzelfall geprüft werden, was medizinisch angezeigt ist, aber insgesamt kann man mit dem Thema Halsschmerzen heutzutage viel entspannter umgehen. Häufig sind die Sorgen der Eltern unbegründet und die meisten Kinder brauchen keine Behandlung.“ Also weder Antibiotika – und erst recht keine Operation.
Lange Zeit galt das Dogma, dass Streptokokken schnell mithilfe von Penicillin und Co. medizinisch unschädlich gemacht werden müssen, weil sonst gefährliche Entzündungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen drohen, die angegriffen werden und ihre Funktion aufgeben. Auf Darstellungen in medizinischen Lehrbüchern sind die Klappen regelrecht zerfranst, so als ob Mäuse davon abgebissen hätten.
Wer will sich schon ein Herzleiden im Erwachsenenalter einhandeln, nur weil in der Kindheit die Halsschmerzen nicht richtig auskuriert wurden? „Inzwischen wissen wir: Nicht alle Halsschmerzen beruhen auf Entzündungen, nicht alle Entzündungen werden von Streptokokken verursacht und nicht alle Herzklappenfehler gehen auf eine Infektion mit Streptokokken zurück“, sagt Kinderarzt Berner.
Der Mythos vom Penicillin (und anderen Antibiotika) als unverzichtbarer Waffe gegen Herzentzündungen ist durch Fallberichte aus den 1950er-Jahren begründet worden, als in einer Kaserne in den USA etliche Soldaten daran erkrankten und schon bald Herzklappenfehler drohten. „In Deutschland wurde das Phänomen aber viel seltener beobachtet und die Beweislage, dass diese Komplikation mit Penicillin verhindert werden kann, ist dünn“, sagt Berner. Deshalb hat der Kinderarzt für besorgte Eltern eine entlastende Empfehlung: „Zwar können Kinder wieder etwas früher in den Kindergarten oder in die Schule, wenn ein nachgewiesener Streptokokkeninfekt mit Antibiotika behandelt wird, aber man verpasst nichts, wenn ein Kind mit Halsschmerzen keine Antibiotika bekommt.“
Einen anderen Rat bietet hingegen Richard Rosenfeld, erfahrener HNO-Arzt im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Früher, als zum Übergang vom Kind zum Erwachsenen offenbar die rituelle Entfernung der Mandeln gehörte, hätten sich mit der Devise, „junge Ärzte meiden“ und auf die Erfahrung Älterer zu vertrauen, meist ärgste Komplikationen bei der Operation verhindern lassen. Heute ist es vielleicht umgekehrt und deshalb ratsamer, sich auf jüngere Doktoren zu verlassen, so Rosenfeld – zumindest aber auf jene, die den aktuellen Forschungsstand kennen und eine Mandeloperation nur zurückhaltend empfehlen. Jedenfalls nicht gleich dann, wenn ein Kind ab und zu über Halsschmerzen klagt und nicht gut schlucken kann – oder will.