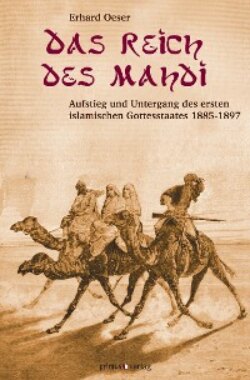Читать книгу Das Reich des Mahdi - Erhard Oeser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Sudan unter ägyptisch-türkischer Herrschaft
ОглавлениеBis der Sudan unter türkisch-ägyptische Herrschaft gelangte, bezeichnete der Begriff „Sudan“ weder ein besonderes Volk noch ein genau abgegrenztes geografisches Gebiet. Das aus dem Arabischen stammende Wort ist der Ausdruck für „schwarz“ (vgl. Buchta 1888, S. 1). Unter „Sudan“ wurde daher das „Land der Schwarzen“ verstanden. Zur ägyptischen Provinz wurde der Sudan unter Mehemed Ali, der in dieses Gebiet mit einer Armee einfiel und als Erster ein Verwaltungssystem von ägyptischen Beamten errichtete, an deren Spitze ein Generalgouverneur stand. Dieses Gebiet wurde von den Nachfolgern Mehemed Alis bis zu den Tagen seines Enkels Ismail Pascha immer mehr erweitert und bestand schließlich beim Ausbruch des Mahdi-Aufstandes aus Nubien, Sennar, Taka, Senhit, den Küstengebieten am Roten Meer Suakin und Massaua im Osten, den Ländern Kordofan und Darfur im Westen, den Verwaltungsbezirken Faschoda, Bahr-el-Ghasal und endlich den Äquatorialprovinzen Hatt-el-Estiwa im fernsten Süden (vgl. Buchta 1888, S. 2). Der jeweilige Generalgouverneur residierte in Khartum am Zusammenfluss des Blauen und Weißen Nil, wo alle Verkehrswege aus dem Süden aufeinandertreffen und wo alle Handelswaren aus dem Süden auf den Weg zur Mittelmeerküste gelangen.
Die Araber fingen schon früh an, die schwarzen Eingeborenen auszubeuten. Einige der arabischen Stämme waren Kamelzüchter, andere Ziegenhirten, wieder andere Baggara oder Kuhhirten. Alle aber, ohne Ausnahme, waren sie Menschenjäger. Während Hunderten von Jahren floss zu den großen Sklavenmärkten ein beständiger Strom gefangener Schwarzer. Die Erfindung des Schießpulvers und die Feuerwaffen, die sich die Araber zu eigen gemacht hatten, erleichterten ihnen das Geschäft, da sie die unwissenden Schwarzen nochmals benachteiligten. Dieser Zustand sollte sich aber auch dann nicht ändern, als der gesamte Sudan unter ägyptischtürkische Herrschaft kam. Unter den chaotischen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in Ägypten nahmen vielmehr Korruption und Missstände im fernen Sudan auf unkontrollierbare Weise zu. Fast ohne Ausnahme betätigten sich die ägyptischen Beamten als Unterdrücker. Denn in den Ministerien in Kairo wurde der Erfolg ihrer Verwaltung einzig und allein an der Menge des Geldes gemessen, das aus den Eingeborenen herausgequetscht werden konnte. Die ägyptische Regierung war zwar der Internationalen Liga gegen den Sklavenhandel beigetreten. Das hinderte sie aber nicht daran, indirekt mit dem Sklavenhandel Geld zu verdienen. Denn die Zahlungsfähigkeit der Araber hing zu einem großen Teil von ihrem Erfolg auf der Sklavenjagd ab. War der Fang gut, profitierte die Staatskasse.
Abb. 1: Ägypten und der Sudan (vereinfacht nach Nutting 1966)
Abb. 2: Der Sklavenhändler Ziber Pascha (aus Slatin 1896)
Unter den Sklavenjägern nahm ein Araber mit Namen Ziber eine Sonderstellung ein. Er war der Mächtigste aller Sklavenhändler im Sudan, beherrschte die Provinz Bahr-el-Ghazal und erhielt sogar wegen seiner Eroberungszüge in der noch von einem alten Sultangeschlecht regierten Provinz Darfur von dem Vizekönig den Rang eines Pascha. Als er jedoch den letzten Sultan von Darfur in einer vernichtenden Schlacht tötete und seine Schätze an Silber, Gold, Waffen und Juwelen an sich nahm und Tausende von Sklavinnen unter seiner siegreichen Mannschaft verteilte, geriet er in Streit mit dem damals amtierenden Gouverneur Ismail Ayub Pascha, der zur Verteilung der Beute zu spät kam. Ziber fühlte sich verletzt, dass ihm nicht die Regierung des Landes, das er erobert hatte, anvertraut worden war, während Ismail, um sich seines Konkurrenten zu entledigen, Ziber auf einen weiteren Feldzug nach Darfur schickte. Aufgebracht über diese Behandlung bat Ziber den Khediven um Erlaubnis, nach Kairo kommen zu dürfen. Er erhielt diese sofort, ließ seinen Sohn Suleiman als seinen Stellvertreter zurück und machte sich mit einem Gefolge von Sklaven und Sklavinnen, sowie mit reichen Geschenken auf den Weg. In Kairo wurde er freundlich empfangen, sodass er seine Klagen gegen Ismail Ayub Pascha vortragen konnte. Daraufhin wurde auch dieser nach Kairo berufen, der ebenfalls Klage gegen Ziber erhob. Das Resultat war, dass sie beide in Kairo zurückgehalten wurden (vgl. Slatin Pascha 1896, S. 52f.).
Aber nicht nur Araber, auch einige europäische Händler waren in das dunkle Geschäft des Sklavenhandels eingestiegen, wie der österreichische Afrikareisende Richard Buchta zu berichten weiß: „Nach und nach erfährt man, dass so ziemlich die meisten hiesigen auf dem Weißen Fluss Handel treibenden Europäer an diesen Geschäften beteiligt waren. Den Anfang damit machte ein Franzose De Malzac. Dieser Mensch hat in den Jahren 1857 bis 59 mehrere hundert Berberiner als Sklaven und Ochsenjäger unterhalten, diese nur mit Sklaven bezahlt, alles im weiten Umkreis seiner Behausung geraubt, gesengt, gebrannt, was sich ihm zur Wehr setzte niedergeschossen und Gräuel aller Art verübt. Unter anderem erzählt man, er habe einen berberinischen Diener, den er bei einer Lieblingssklavin gefunden, an einen mit Negerschädeln geschmückten Baum in seinem Hofe gebunden und kaltblütig als Revolverscheibe benutzt“ (Buchta 1888, S. 30).
Den Sklavenhandel im Sudan konnte die ägyptisch-türkische Verwaltung keineswegs eindämmen, vielmehr stützte sie ihre Autorität auf eine mächtige irreguläre Streitkraft von schwarzen Sklavensoldaten, den Basinger, die nicht schlechter ausgerüstet waren als die regulären Soldaten. Diese waren nicht nur stärker an Zahl und mutiger, sondern blickten mit beständig abnehmender Furcht und ebenso beständig wachsendem Hass auf die auswärtigen, aus Ägypten stammenden Garnisonen, die für sich allein eine völlig unbrauchbare Armee darstellten. Fast 40.000 Mann waren auf acht Hauptgarnisonen und zahlreiche kleinere Stützpunkte verteilt. Eingeschränkt durch natürliche Hindernisse und riesige Distanzen in einem Land ohne Straßen, umgeben von einer Bevölkerung, deren Erbitterung mit ihren Nöten von Jahr zu Jahr wuchs, hätten die ägyptisch-türkischen Streitkräfte des Khediven im Sudan ihre Sicherheit einzig auf die Fähigkeit ihrer Offiziere, auf eine hervorragende Disziplin und auf die Überlegenheit ihrer Waffen gründen können. Doch der üble Ruf des Sudan hielt besser ausgebildete Leute davon ab, in solch entfernten Gebieten Dienst zu tun, und wenn es sich vermeiden ließ, ging keiner in den Süden. Schon die Offiziere der Armee, welche die Khediven im Nildelta unterhielt, waren nach Ansicht Churchills gemessen an europäischen Maßstäben, nichts anderes als ein „lärmender feiger Haufen, schlecht ausgebildet und kaum je bezahlt. Und der Abschaum der Armee im ägyptischen Nildelta war die Elite der Armee im Sudan. Im Dunkeln dieser entlegensten Provinzen taten die Offiziere über lange Zeiträume Dienst, manche ihr ganzes Leben. Einige waren in Ungnade dorthin geschickt worden, andere benachteiligt durch ihre Herkunft. Bei einigen war es extreme Armut, die sie zum Dienst außerhalb Ägyptens zwang, andere lockte der Sudan mit der Hoffnung, dort einen ausgefallenen Geschmack zu befriedigen. Den Harems einheimischer Frauen, welche die meisten von ihnen sich hielten, zog nur die Menge des Gelds eine Grenze, das sie mit allen eben verfügbaren Mitteln an sich raffen konnten. Viele waren gewohnheitsmäßige, hoffnungslose Trinker. Fast alle waren unehrlich. Alle waren sie faul und unfähig“ (Churchill 1899, I, S. 24).
Unter solcher Führung wären die besten Truppen bald verkommen. Und die Ägypter im Sudan waren keine erlesenen Soldaten. Wie ihre Offiziere waren sie der übelste Teil der Armee des Khediven. Wie jene hatte es diese in den Sudan verschlagen. Wie jene waren sie träge und verweichlicht, ihre Ausbildung war mangelhaft, ihre Disziplin lax, ihre Moral niedrig. All das war jedoch noch keineswegs ihre ganze Schwäche und gefährliche Lage. Waren schon die regulären Truppen demoralisiert, so existierte doch noch die irreguläre, gut bewaffnete Streitmacht der Basinger, die zahlreicher und mutiger waren als die fremden regulären Truppen, die sie mit ständigem Hass betrachteten. Den Regulären ebenso wie den Irregulären standen die wilden arabischen Wüstenstämme und die abgehärteten Schwarzen aus den Wäldern gegenüber, aufgestachelt durch Leiden und Unrecht. Nur ihre Unfähigkeit, sich zusammenzutun, schob den Tag hinaus, an dem sie die Invasoren vom Erdboden vertilgen würden. Die ägyptische Provinz Sudan war für Churchill ein Kartenhaus: „Nicht dass es zusammenstürzte, war ein Wunder, sondern dass es sich so lange gehalten hatte“ (Churchill 1899, I, S. 25).
Das war die Situation, in der Mohammed Ahmed auftrat, der sich selbst als „Mahdi“, den nach der islamischen Religion erwarteten Erlöser, betrachtete. Daher ist auch die Hauptfrage, inwiefern es sich bei Mohammed Ahmed um eine wirklich religiöse Erscheinung handelt, die auf einem tatsächlichen Sendungsbewusstsein beruht. In fast allen Darstellungen des Mahdi-Aufstandes wird jedoch gerade dieser religiöse Hintergrund unterschätzt. So glaubte General Gordon aufgrund eigener Beobachtungen nicht daran, dass in diesem Land der religiöse Fanatismus wirklich so groß war: „Weit mehr ist es eine Frage des Eigentums, eine Art Kommunismus unter der Flagge der Religion. Der erregt die Leute zu Taten, die sie sonst verdammen würden“ (Gordon 1908, S. 398). Auf diese Aussage Gordons beruft sich zwar Churchill, aber er sieht die Sache doch differenzierter: „Fanatismus ist kein Kriegsgrund. Er ist das Mittel, das den wilden Völkern kämpfen hilft. Es ist der Geist, der ihnen zur Einheit verhilft – die große gemeinsame Sache, angesichts derer alle persönlichen oder Stammesdifferenzen unbedeutend werden. Was das Horn für das Rhinozeros ist, was der Stachel für die Wespe ist, das war der mohammedanische Glaube für die Araber des Sudan – eine Befähigung zum Angriff wie zur Verteidigung“ (Churchill 1899, I, S. 33).
Einen anderen Eindruck gewinnt man jedoch, wenn man die arabischen Quellen des Mahdi-Aufstandes berücksichtigt. Daraus geht hervor, dass es sich dabei in erster Linie um eine religiöse Bewegung gehandelt hat. Es sind vor allem die Proklamationen und Briefe des Mahdi selbst und seines Nachfolgers Abdullahi, welche bei aller strategischen Taktik, die den Aufstand verbreiten half, die tiefe religiöse Überzeugung erkennen lassen, die sich fast auf das gesamte sudanesische Volk übertragen hatte.