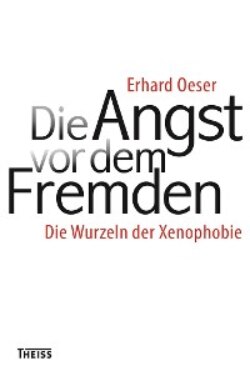Читать книгу Die Angst vor dem Fremden - Erhard Oeser - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Verhalten der alten Ägypter und Babylonier gegen Fremde
ОглавлениеHistorisch an erster Stelle der Nachrichten über den Umgang mit Fremden steht allerdings nicht Griechenland oder Rom, sondern das alte Ägypten. Seit der Entzifferung der Hieroglyphen hat man festgestellt, dass nicht nur antike Quellen zur Beurteilung des Verhaltens der Ägypter gegen Fremde vorhanden sind, sondern dass es dazu seit dem Mittleren und Neueren Reich, also seit Tausenden von Jahren, auch Stellungnahmen der Ägypter selbst gibt. Dabei ist es notwendig, drei Ebenen zu unterscheiden: Die erste Ebene ist die theologisch-philosophische und staatstheoretische Konzeption. Die zweite Ebene ist die der Literatur und die dritte Ebene die des praktischen Umgangs mit den Fremden im Alltag der Ägypter. Zu allen drei Ebenen liegen schriftliche Dokumente vor (vgl. Zeidler in: Riemer/Riemer 2005).
Auf der ersten und höchsten Ebene ist das grundlegende Prinzip der ägyptischen Weltordnung, die Dualität, entscheidend. Sie hat auch die Entstehung des ägyptischen Staates bestimmt, der aus dem Wirken zweier Gegenspieler hervorgeht: der Anhänger des Sonnengottes Re und der Rotte des schlangengestaltigen Apophis, womit alle Widersacher der |31|Weltordnung gemeint sind, sowohl die Rebellen im Innern als auch die Feinde von außen. Fremdheit wird aus Gründen religiöser Differenzen als Feindschaft angesehen. Die Fremden sind Feinde, weil sie Religionsfrevler und Tempelschänder sind, charakterisiert durch den Abfall von der religiösen Weltordnung, während Zugehörigkeit durch Loyalität ihr gegenüber definiert ist (vgl. Assmann 2000, S. 238ff.). Später im Mittleren Reich ist die als politisch-kulturelle Zugehörigkeit verstandene Gemeinschaft nicht so sehr auf die Religion, sondern stärker auf die ägyptische Sprache und Kultur bezogen. Auch das Territorium spielt eine Rolle, ist aber im Hinblick auf die Ausdehnung des Landes beträchtlichen Schwankungen unterworfen.
In der Literatur, in den Königsinschriften und Lebenslehren, wird schon konkreter von den Charaktereigenschaften der Fremden, so zum Beispiel von der angeblichen Feigheit und Hinterhältigkeit der Nubier oder Asiaten, gesprochen. In einer Abschrift eines von Amenophis II. mit eigener Hand ausgefertigten Befehls heißt es: „Traue ja nicht den Nubiern, sondern hüte dich vor ihren Leuten und ihren Zauberern. Hör nicht auf ihre Worte, und kümmere dich nicht um ihre Botschaften“ (Zeidler 2005, S. 46). Und in der Schulliteratur des Neuen Reiches ist von der zum Sprichwort gewordenen angeblichen Dummheit der Nubier die Rede. Aber auch für die Eingliederung der Fremden im Alltagsleben der Ägypter gibt es viele Beispiele. So wurden die Nubier als Kriegsgefangene in die Dienste eines Palastes oder Tempels gestellt und geschlossen angesiedelt. Dabei handelte es sich meist um Soldaten- und Polizeitruppen (vgl. Zeidler 2005, S. 47). Weitere Beispiele für solche Eingliederung von fremden Gefangenen sind die Afrikaner und Asiaten, die auch in Backstuben und Weinkellern beschäftigt waren. Auch viele hohe Beamte stammten aus dem Ausland oder waren Nachkommen von Fremden. Besonders geschätzt waren fremde Handwerker, die neue Fertigkeiten mitbrachten, die in Ägypten gebraucht wurden. Sehr früh wurden Kundschafter und Dolmetscher erwähnt, die aus eroberten Gebieten stammten. Und es gab im Neuen Reich auch nubische und lybische Tänzer, asiatische Sänger und Sängerinnen, syrische Diener und nubische Ammen (vgl. Zeidler 2005, S. 48).
In der Perserzeit (500–400 v. Chr.) lebten in Ägypten trotz einiger Spannungen Ägypter, Perser und Juden, später auch Griechen auf relativ engem Raum in offensichtlicher Toleranz zusammen. Die Verschiedenheit des Aussehens, der Lebensweise und der Sprache galt als vom Schöpfer |32|gewollt. Weder Fremdheit noch Feindschaft oder auch Zugehörigkeit wurden primär durch besondere körperliche oder charakterliche Eigenschaften der Fremden definiert, sondern durch das Verhalten im Bezug auf die dem ägyptischen Staat zugrunde liegende Weltordnung bestimmt: Wer die bestehende Weltordnung nicht kennt, ist ein Fremder; wer sich gegen sie auflehnt, ist ein Feind (vgl. Zeidler 2005, S. 57). Doch es gab auch eine ausgesprochene Xenophobie gegen Griechen. Das bezeugen Urkunden der Ptolemäerzeit, wie der Bericht eines Griechen aus dem Jahr 163 v. Chr. zeigt: „Mir wird Unrecht getan von denen, die in demselben Tempel als Reiniger und Bäcker dienen, sie drangen in den Tempel, in dem ich mich aufhalte, gewaltsam ein, um mich herauszuschleppen und mich stumm zu machen, wie sie es schon früher, während des Aufstandes, unternommen hatten, weil ich ein Hellene bin. Als ich nun erkannte, dass sie von Sinnen waren, schloss ich mich ein; aber einen von meinen Leuten fanden sie auf der Tempelstraße, warfen ihn nieder und verprügelten ihn mit den bronzenen Schabern“ (Hengstl 1978, S. 104–107).
In Mesopotamien galten im 3. Jahrtausend fremde Nomaden als ein Volk, das keine Kontrolle verträgt, das weder Gottesfurcht noch Kulte und Satzungen kennt. Eine altbabylonische Quelle spottet über die Nomadenstämme als Leute, die keine Häuser und keine Städte besitzen. Sie werden als Tölpel bezeichnet, die im Hochland wohnen, kein Getreide kennen und nach dem Tod ihre Leichen nicht bestatten. In den altorientalischen Fluchtafeln werden die Fremden als „Söhne von Tauben, Toren, Lahmen, Verantwortungslosen, Hunden“ bezeichnet. Sie sind Nicht-Babylonier und werden damit sogar als Nicht-Menschen angesehen. Nicht viel anders steht es um die ägyptische Gleichsetzung von „Ägypter“ und „Mensch“, die eine zutiefst misstrauische, ablehnende Einstellung allem Fremdartigen gegenüber zeigt (vgl. Weiler 1983).