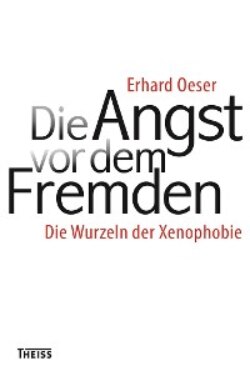Читать книгу Die Angst vor dem Fremden - Erhard Oeser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|25|Kultur als Schicksal: Neorassismus
ОглавлениеDiese neue Form des Rassismus ist politisch motiviert und beruft sich auf die Unterschiede der Kulturen, vor allem zwischen Orient und Okzident. Es war der Orientalist Bernard Lewis, der in der auf Sicherheitsfragen spezialisierten Zeitschrift „Atlantic Monthly“ nach den „Wurzeln der islamischen Wut“ fragte und in diesem Zusammenhang von einem „Clash of Civilizations“ sprach, als „der historischen Reaktion eines alten Rivalen auf unser christlich-jüdisches Erbe, unsere laizistische Gegenwart und die weltweite Expansion von beiden“ (Lewis 1990, S. 60; vgl. Huntington 1998, S. 341). Den Durchbruch in der sicherheitspolitischen Debatte brachte jedoch der 1993 in „Foreign Affairs“ erschienene Aufsatz „The Clash of Civilizations?“ von Samuel P. Huntington, worin dieser apodiktisch feststellte: „Unterschiede zwischen Zivilisationen sind nicht nur real; sie sind grundlegend. Sie sind viel fundamentaler als die Unterschiede zwischen politischen Ideologien und politischen Regimen“ (Huntington 1993, S. 25). Er ist der Meinung, dass diese Unterschiede zwischen den Kulturen über die Jahrhunderte hinweg die längsten und gewalttätigsten Konflikte erzeugt haben, die in ihrem schicksalhaften Charakter wie Naturkatastrophen jedem politischen Handeln entzogen sind (vgl. Ruf 2012, S. 18f.).
Die Konsequenz aus dieser Ansicht besteht für Huntington darin, dass „der Westen“ aufhören müsse, seine einzigartigen Werte, wie die Trennung von geistlicher und weltlicher Autorität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, den anderen Kulturen aufzudrängen, die unfähig gewesen seien, diese selbst zu entwickeln, und auch heute nicht fähig seien, sich an sie zu adaptieren. Das aber muss letztlich als „kulturalistisch verbrämter Rassismus“ (Ruf 2012, S. 21) angesehen werden. Doch darf man bei Huntington nicht übersehen, dass er ursprünglich den Titel seines bekannten Aufsatzes mit einem Fragezeichen versehen hat und in einem umfangreichen Werk den „Clash of Civilizations“ oder, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, den „Kampf der Kulturen“ zu begründen versucht hat (Huntington 1998). Doch die Begründung dieser ausdrücklich als „Hypothese“ formulierten Ansicht, dass alle Auseinandersetzungen auf unserer Welt von Konflikten zwischen den großen Kulturkreisen bestimmt werden, leidet von allem Anfang an unter der begrifflichen Unklarheit der Bezeichnungen „Kultur“ und „Zivilisation“. Wenn Huntington feststellt, dass „die Menschheit in Untergruppen, in Stämme, |26|Nationen und größere zivilisatorische Einheiten zerfällt, die man für gewöhnlich Kulturen nennt“ (Huntington 1998, S. 77), und von „Kulturkreisen“ spricht, dann sind es für ihn als Leiter eines Instituts für Strategische Studien an der Universität Harvard und Berater des US-Außenministeriums eigentlich geopolitische Einheiten, welche die zukünftigen Konflikte auf dieser Erde bestimmen werden.
Abgesehen von dem seit der Zeit der philosophischen Aufklärung in Europa begegnenden Gebrauch des Begriffes „Zivilisation“ im Singular als Gegenbegriff zur „Barbarei“ oder „Wildheit“, herrscht ziemliche Übereinstimmung bei den Kulturhistorikern über mindestens zwölf große Hochkulturen, von denen sieben nicht mehr existieren (mesopotamische, ägyptische, kretische, klassische, byzantinische, mittelamerikanische und Anden-Kultur) und fünf noch vorhanden sind (die chinesische, japanische, indische, islamische und westliche). Im Hinblick auf die Analyse der internationalen politischen Implikationen von Kulturen in der heutigen Welt empfiehlt es sich nach Huntingtons Meinung, zu diesen Kulturkreisen noch die „lateinamerikanische, die orthodoxe und möglicherweise die afrikanische Kultur hinzuzufügen“ (Huntington 1998, S. 77). Der afrikanische Kulturkreis Huntingtons ist, wie er selbst weiß, jedoch eine bloß hypothetische Konstruktion. Die meisten Kulturtheoretiker anerkennen keine eigene afrikanische Kultur. Der Norden des afrikanischen Kontinents und seine Ostküste gehören zum islamischen Kulturkreis. Äthiopien mit seinen besonderen Institutionen, seiner monophysitischen Kirche und seiner Schriftsprache stellte schon früh eine eigene Kultur dar. Anderswo floss mit dem europäischen Imperialismus westliche Kultur ein. In Südafrika schufen holländische, französische und später englische Siedler eine vielfältige europäische Kultur. Außerdem sind in ganz Afrika Stammesidentitäten ausgeprägt.
Die sogenannte „westliche“ Kultur nimmt nach Huntington in dieser Auflistung der „Kulturkreise“ oder „Zivilisationen“ eine Sonderstellung ein: „Der Terminus ‚der Westen‘ wird heute allgemein benutzt, um das zu bezeichnen, was man einmal das christliche Abendland zu nennen pflegte. Der Westen ist damit der einzige Kulturkreis, der mit einer Himmelsrichtung und nicht mit dem Namen eines bestimmten Volkes, einer Religion oder eines geographischen Gebiets identifiziert wird. Das löst diesen Kulturkreis aus seinem geschichtlichen, geographischen und kulturellen Kontext heraus. Historisch gesehen ist westliche Kultur europäische Kultur. Heute ist westliche Kultur euroamerikanische oder nordatlantische |27|Kultur. Europa, Nordamerika und den Atlantik kann man auf einer Landkarte finden, den Westen nicht. Der Name ‚der Westen‘ hat auch zur Bildung des Begriffs ‚Verwestlichung‘ geführt und einer irreführenden Gleichsetzung von Verwestlichung und Modernisierung Vorschub geleistet – es ist leichter, sich die ‚Verwestlichung‘ Japans vorzustellen als seine ‚Euroamerikanisierung‘. Die europäisch-amerikanische Kultur wird jedoch allgemein als ‚westliche‘ Kultur bezeichnet“ (Huntington 1998, S. 60f.). Und so will Huntington diesen Terminus trotz solcher ernsthaften Nachteile beibehalten.
Der „Westen“ umfasst nach Huntington also Europa, Nordamerika sowie andere von Europäern besiedelte Länder wie Australien und Neuseeland. Das Verhältnis zwischen den beiden Hauptkomponenten des Westens hat sich jedoch im Laufe der Zeit verändert. Die Amerikaner definierten ihre Gesellschaft lange Zeit als Gegensatz zu Europa. Amerika war das Land der Freiheit, der Gleichheit, der Möglichkeiten, der Zukunft; Europa stand für Bedrückung, Klassenkonflikt, Hierarchie, Rückständigkeit. Amerika, so wurde sogar behauptet, sei eine eigene Kultur. Dieses Postulat eines Gegensatzes zwischen Amerika und Europa war zu einem erheblichen Teil eine Folge der Tatsache, dass Amerika mindestens bis Ende des 19. Jahrhunderts nur begrenzte Kontakte zu nicht-westlichen Kulturen hatte. Das Amerika des 19. Jahrhunderts definierte sich über seinen Unterschied und Gegensatz zu Europa; das Amerika des 20. Jahrhunderts definiert sich als Bestandteil und sogar als Führer einer umfassenderen Einheit, eben des Westens, zu der auch Europa gehört (vgl. Huntington 1998, S. 60). Als einzige aller Kulturen hat der Westen einen wesentlichen und manchmal verheerenden Einfluss auf jede andere Kultur gehabt. Das durchgängige Charakteristikum der Welt der Kulturkreise ist infolgedessen das Verhältnis zwischen der Macht und Kultur des Westens und der Macht und Kultur anderer Kreise. In dem Maße, wie die relative Macht anderer Kreise zunimmt, schwindet die Anziehungskraft der westlichen Kultur, und nicht-westliche Völker wenden sich mit zunehmender Zuversicht und Engagiertheit ihrer eigenen, angestammten Kultur zu. Das zentrale Problem in den Beziehungen zwischen dem Westen und dem Rest der Welt ist folglich die Diskrepanz zwischen den Bemühungen des Westens, speziell Amerikas, um Beförderung einer universalen westlichen Kultur und seiner schwindenden Fähigkeit hierzu. Der Fehler, der Huntington in diesem Zusammenhang unterläuft, besteht darin, dass er den Universalismus in welcher Form auch immer ausschließlich |28|als eine charakteristische Vorstellung der westlichen Kultur ansieht.
Das Konzept einer „universalen Kultur“ ist für Huntington ein typisches Produkt des westlichen Kulturkreises. Im 19. Jahrhundert diente diese Idee dazu, die Ausweitung der politischen und ökonomischen Dominanz des Westens auf nicht-westliche Gesellschaften zu rechtfertigen. Im ausgehenden 20. Jahrhundert dient das Konzept einer universalen Kultur dazu, die kulturelle Dominanz des Westens über andere Gesellschaften und die Notwendigkeit der Nachahmung westlicher Praktiken und Institutionen durch andere Gesellschaften zu rechtfertigen. Universalismus ist daher für Huntington „die Ideologie des Westens angesichts von Konfrontationen mit nichtwestlichen Kulturen“ (Huntington 1998, S. 92). Deshalb vertritt er die Meinung, im „Interesse der kulturellen Koexistenz“ in der heutigen Welt „auf Universalismus zu verzichten“ (Huntington 1998, S. 526). Doch, wie noch gezeigt werden soll, ist weder der „wissenschaftliche Universalismus“ (Needham 1979) noch der ethischmoralische Universalismus der Menschenrechte eine Erfindung der sogenannten westlichen Kultur. Vielmehr ist der wissenschaftliche Universalismus eine historische Realität, die bereits von allem Anfang der Wissenschaftsgeschichte durch Übersetzungen und Übernahme wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktisch-technischer Anwendungen von einer Kultur in die andere gegeben war. Zwar bestanden Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Regionen oder Kulturkreisen, wie empirischdeskriptiv-qualitativ oder theoretisch-quantitativ, aber es gab niemals eine auf eine besondere Kultur oder gar auf eine „Menschenrasse“ beschränkte Wissenschaft. Alte abwertende Vorstellungen von einer primitiven Wissenschaft der Babylonier, Araber oder Türken im Nahen Osten und der Inder oder Chinesen im Fernen Osten haben sich als unzutreffend erwiesen, während Unterscheidungen wie zwischen einer „jüdischen Physik“ und einer „deutschen Physik“ nichts anderes als Zerrbilder eines nationalistischen Rassismus darstellen. Was aber die Universalität der Menschenrechte betrifft, so sind sie keineswegs bloß „universale Dispositionen“ einer „dünnen minimalistischen Moral“ (Huntington 1998, S. 525), sondern unverzichtbare fundamentale Gesetzmäßigkeiten, ohne die die in verschiedene geographische Regionen und Kulturkreise aufgespaltene Menschheit in Fremdenhass und Fremdenfeindschaft versinken würde.