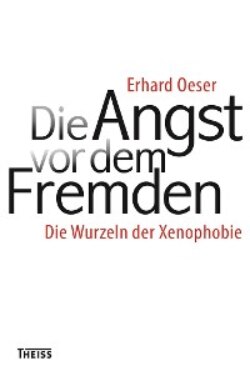Читать книгу Die Angst vor dem Fremden - Erhard Oeser - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Fremden als Feinde Roms: Karthager, Germanen, Hunnen
ОглавлениеWährend bei den Griechen durch die Anwendung des Barbaren-Schemas eine dualistische Anschauung von der menschlichen Bevölkerung unserer Welt entstand, welche die wilden Skythen fast auf die gleiche Stufe stellte wie die kultivierten Ägypter, fassten die Römer nicht alle fremden Völker durch eine einzige abwertende Bezeichnung zusammen. Obwohl der Begriff des „Barbaren“ gleichzeitig mit einer Reihe anderer Elemente der griechischen Kultur nach Rom gelangte, erreichte er dort kaum dieselbe Bedeutung wie in seinem Ursprungsland. Die römische Art, in dem anderen vor allem den fremden Feind zu sehen, war von Anfang an differenzierter, und jedes der Völker, mit denen Rom in Kontakt stand, hatte seine eigene Charakteristik, deren Beurteilung auf der Grundlage des römischen Wertesystems geschah.
In der neueren Forschung (vgl. Dubuisson 1992) versucht man daher, ein Einteilungsschema dieser in den lateinischen Texten der Römer beschriebenen |41|unterschiedlichen Charakterzüge anderer Völker zu rekonstruieren. Voraussetzung dafür ist nach den Prinzipien der modernen verstehenden Ethnologie jedoch, dass man sich auch in das hineinversetzen muss, was von der römischen Mentalität und Ideologie aus diesen historischen Texten bekannt ist. Bei der Beurteilung der Charakterzüge fremder Völker scheint für die Römer die Vorstellung zweier gegensätzlicher Tendenzen grundsätzlich gewesen zu sein: Ein Übermaß an Zivilisation führt zu einem Übermaß an Verschlagenheit (calliditas) und zu einem Verfall der moralischen Werte (perfidia). Ein Mangel an Zivilisation äußert sich in Form von primitiven, ungezügelten Instinkten, wie zum Beispiel crudelitas (etwa bei Hannibal), libido, luxuria, avaritia. Das für sie selbst beanspruchte Wertesystem der klassischen römischen Gesellschaft basiert dagegen auf Begriffen wie virtus, pietas, fides, gravitas usw. (vgl. Dubuisson 1992, S. 229 und 263f.). Obwohl die Römer die Kultur der Griechen hoch einschätzten, waren sie doch nicht blind für deren angebliche oder wirkliche Charakterschwächen. Für diese negativen Eigenschaften liefert ein einziger Begriff – derjenige der levitas (das Gegenteil der gravitas) – die umfassende Begründung. Sie sahen in den hochgebildeten Griechen ein übermäßig verschlagenes (calliditas) und schwatzhaftes (volubilitas) Volk (vgl. Dubuisson 1992, S. 229f.).
Das Fehlen oder die Unzulänglichkeit der Treue (fides) verweist darüber hinaus bestimmte Völker an das untere Ende der Stufenleiter des Wertesystems. Dieser Charakterzug der Falschheit und Treulosigkeit, der eine Folge des Übermaßes an Zivilisation sein soll, stimmt aber mit dem barbarischen Charakter eines afrikanischen Volkes wie der Karthager, das von grausamen abergläubischen Riten wie den berüchtigten Kinderopfern beherrscht ist, nicht überein. Solche widersprüchlichen Charakterzüge, welche die Karthager bei den Römern zur Zeit Ciceros und später zu einem absolut verachtenswürdigen Volk machen, lassen sich nicht nur als eine Kriegspropaganda erklären, sondern auch dadurch, dass nach den Punischen Kriegen keine Karthager im eigentlichen Sinne mehr vorhanden waren. Karthago, die alte Feindin Roms, war auf sehr gründliche Weise zerstört, ihre Bevölkerung in alle Winde zerstreut worden, und man hatte sogar versucht, das Gebiet der Stadt unbewohnbar zu machen, um die Einwohner daran zu hindern, sich dort wieder niederzulassen. Man kann sich daher fragen, inwieweit die Karthager für die Römer des ersten Jahrhunderts nicht zu einem rein historischen Volk geworden sind, dessen Charakterzüge nur noch aus der Behandlung der |42|Punischen Kriege in der Literatur bekannt sind. Es ist aber auch möglich, dass die Vorstellung von diesem Volk – wie das Volk selbst – in gewisser Weise in der Menge der umliegenden afrikanischen Stämme untergegangen ist. Infolge der Vermischung mit jenen Afrikanern können Klischees, wie sie beispielsweise für Numider oder Libyer bei den Römern verbreitet waren, durchaus auf die Karthager zurückprojiziert worden sein. So könnten der Krieg gegen Jugurtha und später Caesars Feldzug in Afrika das traditionelle Bild des Karthagers durch Anleihen bei den Numidern beeinflusst haben.
Eine andere Frage ist, welcher Zusammenhang zwischen dem persönlichen Ruf des berühmtesten Feldherrn der Karthager, Hannibal, und dem seines Volkes besteht. Denn die Römer machten Hannibal eine Reihe von Handlungen und Verhaltensweisen zum Vorwurf, die mit dem Begriff der „punischen Falschheit“ eng verknüpft sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die in den Punischen Kriegen erworbene übermächtige Berühmtheit Hannibals der Grund war, die eine oder andere für besonders repräsentativ gehaltene charakteristische Eigenschaft dieses Karthagers auf das Volk im Ganzen zu übertragen. Die durch die drei verlustreichen Kriege zu unverbrüchlichem Hass gesteigerte Feindlichkeit der Römer gegen die Karthager wird am besten dokumentiert durch den von Plutarch überlieferten Satz, mit dem Marcus Porcius Cato jede seiner Reden vor dem römischen Senat beendete: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss“ (Plutarch 1777, III, S. 446). Cato war es auch, der mit solchen Reden schließlich den dritten und letzten Punischen Krieg bewirkt haben soll, dessen Anfang er noch erlebte, aber dessen Ende wie auch die vollständige Zerstörung der Stadt Karthago im Jahr 146 v. Chr. sich erst nach seinem Tod ergaben.
Karthago, diese Stadt an der nordafrikanischen Küste, war sozusagen die barbarische Gegenwelt Roms, in der die Feindschaft gegen Rom und seine Bewohner ebenso groß, wenn nicht noch stärker war als die des alten Cato. Cornelius Nepos berichtet, dass Hannibal seinen Hass gegen die Römer von seinem Vater Hamilkar geerbt haben soll. Hannibal selbst erzählt aus seinen Jugenderinnerungen, dass sein Vater ihn schwören ließ, niemals mit den Römern Freundschaft halten zu wollen. Diesen Eid hat Hannibal bis zu seinem Tode eingehalten (Nepos 1774, XXIII, 2). Sogar als er aus seinem Vaterland vertrieben worden war und fremder Hilfe bedurfte, hörte er niemals auf, mit seiner ganzen geistigen Kraft die |44|Römer zu bekämpfen. Niemand konnte leugnen, dass Hannibal den Feldherrn des römischen Volkes an Klugheit und Tapferkeit weit überlegen war. Denn so oft er mit den Römern kämpfte, blieb er immer Sieger. Er wurde zum Schreckgespenst für die Bewohner Roms, als es ihm gelang, ihnen mit seinen Kriegselefanten in den Rücken zu fallen. Nachdem er nach vielen siegreichen Kämpfen das Pyrenäengebirge überschritten hatte, erreichte er die Alpen, die Italien von Gallien trennen und die niemand vor ihm mit einem Heer je überschritten hatte. Dort hieb er die Alpenbewohner, die ihn am Übergang zu hindern versuchten, zusammen, und bahnte Wege, sodass ein gerüsteter Elefant dort schreiten konnte, wo vorher ein einzelner bewaffneter Mann kaum hatte kriechen können.
Abb. 3: Hannibals Übergang über die Alpen (aus Livius 1840)
Auf diesem Weg führte er seine Truppen herüber und gelangte nach Italien. Solange er dort blieb, hielt ihm niemand im offenen Kampf stand. Nach der siegreichen Schlacht bei Cannae zog er, ohne Widerstand zu finden, gegen Rom und verweilte auf den der Stadt benachbarten Bergen. „Hannibal ad portas!“ war der historisch durch Marcus Tullius Ciceros Philippische Reden zu einem geflügelten Wort gewordene Schreckensruf der Römer. Hannibal selbst griff jedoch Rom nicht an, sondern wurde aus Italien zur Verteidigung seines Vaterlandes zurückgerufen.
Die römischen Geschichtsschreiber berichten aber auch über ein besonders finsteres Kapitel der Geschichte Karthagos. Es gab in Karthago zwei Friedhöfe. Der eine war der normale Friedhof für Tote ab dem Jugendalter bis ins Erwachsenenalter. Der andere lag außerhalb der Stadt und war für kleine Kinder und junge Tiere bestimmt, er wurde „Tophet“ genannt. Die Existenz dieses Tophet führte zu der schrecklichen Vermutung, dass dort jene Kinder lägen, die dem Gott Baal-Hammon über sechs Jahrhunderte lang regelmäßig geopfert worden seien. Nach Hochrechnungen amerikanischer Ausgräber waren es allein zwischen 400 und 200 v. Chr. über 20.000 Kinder (Huss 1992, S. 57). Diese Vorstellung über einen derartig abscheulichen Opferkult in Karthago hatte ein zähes Leben, das von den antiken Geschichtsschreibern Diodorus Siculus und Plutarch bis zu Gustav Flauberts Roman „Salammbô“ (1862) reicht. Darin schilderte der berühmte Schriftsteller im Stil des französischen Realismus die schreckliche Art der Kindesopfer mit einer grauenerregenden Genauigkeit: „Kaum befanden sich die Opfer am Rande der Öffnung, so verschwanden sie wie ein Wassertropfen auf einer glühenden Platte: nur eine weiße Rauchwolke stieg zwischen den scharlachroten Flammenwirbeln |45|empor. Doch der Gott war unersättlich. Er verlangte immer neue Opfer. Scharen von Gläubigen drängten sich jetzt in die Gänge und schleppten ihre Kinder herbei, die sich an sie anklammerten. Sie schlugen die Kleinen, um sich von ihnen loszumachen und sie den rot bemäntelten Priestern zu überliefern. Manchmal hielten die Spielleute, die mit ihrer Musik die grausige Opferung begleiteten, erschöpft inne. Dann hörte man das Geschrei der Mütter und das Knistern des Fetts, welches auf die Kohlen herabfiel. Das dauerte lange bis zum Abend fort. Dann nahmen die inneren Scheidewände der Opferungsstätte einen dunkleren Glanz an. Man unterschied brennendes Fleisch. Einige glaubten sogar Haare, Glieder und ganze Körper zu erkennen“ (Flaubert o. J., S. 346f.).
Doch diese Schauergeschichte hat sich als unzutreffendes Phantasiegebilde erwiesen. Erst in jüngster Gegenwart hat man nicht nur archäologische Untersuchungen der Gräber in Bezug auf die Urnen und Inschriften auf den Stelen durchgeführt, sondern auch anthropologische Untersuchungen der sterblichen Reste der angeblich geopferten Kleinkinder unternommen. Die Analyse der Überreste von über 500 karthagischen Kindern aber ergab, dass die Kinder bei ihrem Tod meist nur wenige Wochen alt waren und ein Fünftel der bestatteten Kinder überhaupt Totgeburten waren. Die bisherige Vorstellung von einer regelmäßigen Kleinkindopferung in Karthago hatte dagegen nicht auf der Analyse der sterblichen Reste gefußt, sondern sich auf Beispiele von Menschenopfern bezogen, wie sie von einigen frühen Chronisten berichtet wurden, die sich wiederum auf doppeldeutige karthagische Inschriften oder auf Zitate aus dem Alten Testament beriefen. Die anthropologischen Untersuchungen der Knochenüberreste zeigte nun, „dass es wohl einige Opferungen von Kindern gab, aber es war nicht so, dass die Karthager regelmäßig ihre eigenen Kinder opferten“ (Schwartz et al. 2010). Als Ursache für den Tod der Kinder nehmen die Anthropologen heute Krankheiten im Säuglingsalter an, die damals noch nicht bekämpft werden konnten. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass der Tophet ein Friedhof für Kleinstkinder war, ganz gleich, wie sie gestorben waren.
Waren die Karthager für die römischen Geschichtsschreiber ein untergegangenes Volk, das man nicht mehr aus eigener Anschauung kannte und über das man dementsprechend ungesicherte Nachrichten verbreitete, so verhielt es sich mit den Galliern und Germanen ganz anders. Hier wurden vor allem Caesars Kommentare trotz seiner subjektiven und parteiischen Bewertungen als eine verlässliche Quelle angesehen. Als |46|Caesar zum Statthalter von Gallien ernannt wurde, lagen dort nach seinen Angaben nicht nur zwei Parteien um die Oberherrschaft im Streit, sondern Gallien wurde dazu noch von den Germanen bedroht, die als Söldner ins Land gerufen worden waren. Ariovist, der König der Germanen, hatte diese Gelegenheit benützt, um sich in dem fruchtbaren Land niederzulassen. Die auf diese Weise übertölpelten Gallier waren überzeugt, dass sie in wenigen Jahren aus ihrem Land weichen müssten, wenn alle Germanen über den Rhein kommen würden. Deswegen hofften sie, dass Caesar sie von der Unterdrückung dieser wilden und grausamen Barbaren befreien werde. Caesar erkannte, dass eine Einwanderung der Germanen auch dem römischen Volk viele Nachteile bringen würde. Denn „dieses rohe und wilde Volk“ würde sich nicht enthalten, wenn es einmal Gallien in Besitz hätte, in Italien einzufallen (vgl. Caesar 1793, 1, S. 50). Deswegen forderte er den Anführer der Germanen, Ariovist, auf, zu einer Unterredung zu kommen, in der die gegenseitigen Ansprüche in Gallien geklärt werden sollten. Doch Ariovist, der vom römischen Senat bisher als Freund angesehen wurde, war inzwischen so stolz und hochmütig geworden, dass er diese friedliche Zusammenkunft mit den Worten ablehnte, „er könne nicht begreifen, was Caesar oder die Römer in seinem durch Krieg eroberten Gallien zu schaffen hätten“ (Caesar 1793, 1, S. 51). Daraufhin ging Caesar mit seinem Heer auf Ariovist los.
Während Caesar sich wegen der Proviantversorgung noch einige Tage aufhielt, entstand durch das Gerede der Gallier und der Kaufleute, die von der „entsetzlichen Körpergröße der Germanen, von ihrer unerhörten Tapferkeit und Kampffertigkeit, von ihren schrecklichen Gesichtern und feurigen Augen Wunderdinge erzählten“, eine große Furcht, die schließlich das ganze Kriegsheer ansteckte. Diese Xenophobie brach zuerst bei den Tribunen und Offizieren der Reiterei aus und bei jenen, die aus Freundschaft zu Caesar von Rom mitgegangen waren, aber den Krieg nicht kannten und nun über die Größe der Gefahr jammerten (Caesar 1793, 1, S. 54f.). Einer brachte die, der andere jene Ursache hervor und bat um Erlaubnis, fortzureisen, und nur wenige blieben aus Scham, um nicht furchtsam zu scheinen, beim Heer. Sie konnten aber nicht einmal ihr Gesicht verstellen oder sich öfters des Weinens erwehren. Versteckt in ihren Zelten klagten sie entweder allein über ihr Schicksal oder bejammerten mit ihren Freunden die gemeinsame Gefahr. Durch solches Gewinsel wurden nun auch die, die den Krieg kannten, Soldaten, Centurionen und Anführer der Reiterei, angesteckt (vgl. Caesar 1793, 1, S. 55). |47|Als Caesar zu Ohren kam, dass man sogar sagte, wenn er den Befehl zum Aufbruch gebe, würden die Soldaten nicht gehorchen, erteilte er in der Versammlung des Kriegsrates allen einen derben Verweis und drohte, wenn ihm auch niemand folgen würde, dass er allein mit der ihm treu ergebenen zehnten Legion fortmarschieren würde. Dadurch wurde das ganze Heer anderen Sinns und war bereit, den Krieg sowohl gegen die Gallier, welche die Herrschaft der Römer zu brechen versuchten, als auch gegen die einfallenden Germanen fortzusetzen (vgl. Caesar 1793, 1, S. 59).
Es gab einmal eine Zeit, da die Gallier an Tapferkeit die Germanen übertrafen und wegen der Menge ihres Volkes und des Mangels an Feldern Kolonien über den Rhein schickten, die dann dort wie die Germanen ein armes, dürftiges, aber mutiges Leben führten. Dagegen herrschte bei den in ihrem Land zurückgebliebenen Galliern wegen der Nähe zur römischen Provinz und des dadurch ermöglichten Handels Überfluss und Vergnügen. Verweichlicht und allmählich gewohnt, besiegt zu werden, waren sie den Germanen nicht mehr an Tapferkeit gleich. Der Heerführer der Gallier, Vercingetorix, der die verschiedenen Städte Galliens zu vereinigen versuchte, um seinem Volk die Freiheit wiederzugewinnen, musste sich schließlich von Caesars Truppen bedrängt in der Stadt Alesia verschanzen, die von den Römern belagert wurde. Als die Belagerten vergeblich die Ankunft der gallischen Hilfsvölker erwarteten und alles Getreide aufgezehrt war, hielten sie eine Versammlung ab und beratschlagten über den Ausgang ihres Schicksals. Wie Caesar erfuhr, wurde bei dieser Beratschlagung ein schrecklicher Vorschlag gemacht. Ein Gallier, der aus einer vornehmen Familie stammte, die ihrer „abscheulichen Grausamkeit“ wegen berüchtigt war, forderte die verzweifelten Belagerten auf, bevor sie sich in eine ewige Sklaverei der Römer stürzten, lieber seinem Rat zu folgen und „zu tun, was unsere Vorfahren in dem nicht so schrecklichen Krieg gegen die Cimbern und Teutonen getan haben, da sie, in Städte eingeschlossen und zu gleichem Mangel gebracht, mit den Körpern derer, die zum Krieg untauglich schienen, des Hungers sich erwehrten und sich nicht den Feinden ergaben“ (Caesar 1793, 2, S. 129f.).
Die Sitten der Gemanen, behauptet Caesar in seinen Kommentaren zum Gallischen Krieg, sind von den gallischen sehr verschieden: „Ihr ganzes Leben ist Jagd und Krieg. Von Kindheit an härten sie sich zur Arbeit und Dauer ab. Sehr lange ledig bleiben ist für sie lobenswert. Das, glauben sie, befördert die Natur, nährt ihre Kräfte und macht die Nerven |48|fest“ (Caesar 1793, 2, S. 26f.). In der „Germania“ des Tacitus wird diese Ansicht Caesars zum Germanenbild der Rassenreinheit stilisiert, die im nationalistischen Deutschland des 20. Jahrhunderts eine verhängnisvolle Wiederbelebung erfuhr. Es ist einer der ältesten deutschen Übersetzer der Germania Johann Samuel Müller, der bereits im 18. Jahrhundert die später als „Kontinuitätsthese“ bezeichnete Auffassung vertritt, dass die Germanen des Tacitus die bis heute von allen Fremden unvermischt gehaltenen Deutschen sind: „Ich selbst“, sagt Tacitus, „schließe mich der Ansicht an, welche besagt, dass die Völker Deutschlands mit keinen anderen sich durch Heirat vermischt sondern ein eigenes, unvermengtes und nur sich selbst gleiches Geschlecht gewesen sei. Daher haben sie, ob ihrer gleich eine so große Menge ist, alle einerlei Leibesgestalt grimmige blaue Augen, goldgelbe Haare, große Körper, welche aber nur beim ersten Anfall stark sind. Lange Arbeit können sie nicht ertragen, am wenigsten Durst und Hitze ausstehen; der Kälte und des Hungers sind sie wegen Luft und des Bodens besser gewohnt“ (Tacitus 1766, S. 595f.). Wenn sie in eine Schlacht gehen, singen sie, um sich gegenseitig aufzumuntern. Es ist aber nicht ein bloßer Gesang, sondern, scheint vielmehr „eine Harmonie der Tapferkeit“ zu sein: „Sie befleißigen sich vornehmlich eines grässlichen Schalles und eines gebrochenen Getöses, da sie die Schilde vor den Mund halten, damit der Laut im Zurückprallen desto stärker und größer sein möge“ (Tacitus 1766, S. 593). „Den Schild zurückzulassen |49|ist bei ihnen die größte Schande. „Einer, und ein solcher, der so etwas tut, darf sich weder beim Opfer noch bei öffentlichen Versammlungen sehen lassen. Deswegen haben auch viele, welche auf diese Weise ihr Leben davon gebracht haben, ihre Schmach mit dem Strang geendigt“ (Tacitus 1766, S. 601). Eine weitere Eigenart der Schlachtordnungen der Germanen ist, dass sie „nicht aus ungefähr zusammengerafftem Volk, sondern aus Verwandten und Angehörigen bestehen. Die Ihrigen stehen ihnen so nahe, dass sie das Heulen der Weiber und das Schreien der Kinder hören. Dieses sind einem jeden die unverwerflichsten Zeugen, dieses die größten Lobredner. Sie begeben sich mit ihren Wunden zu ihren Müttern und Weibern, und diese scheuen sich nicht, dieselben zu zählen, oder zu untersuchen. Diese bringen ihnen, wenn sie fechten, Speise und sprechen ihnen Mut zu. Man versichert, daß, einige Schlachtenordnungen, alsda sie schon zu wanken und zu weichen angefangen, von den Weibern wieder sind hergestellt worden, indem sie nicht aufgehört, sie zu bitten, in den Weg getreten, und ihre nahe Gefangenschaft ihnen vorgestellt, welche ihnen an ihren Weibern viel unerträglicher, als ihre eigene ist“ (Tacitus 1766, S. 602f.).
Abb. 4: Tacitus und die Germanen (aus Tacitus 1765 und Clüwer 1616)
Die Strafen werden in den Versammlungen festgelegt und sind je nach dem Verbrechen verschieden: „Verräter und Überläufer werden an Bäumen aufgehangen. Feige, Zaghafte und die wegen der Weichlichkeit berüchtiget sind, werden in einem Sumpf oder Morast ersäuft“ (Tacitus 1766, S. 609). Die Jünglinge werden dadurch zu mannbaren Mitgliedern erklärt, dass sie in der Versammlung mit einem Schild und Spieß ausgestattet werden. Ab dann tragen sie bei öffentlichen Handlungen immer ihre Waffen und werden einem der vornehmen Fürsten zugeordnet, den sie in der Schlacht nie verlassen dürfen. Anstatt des Soldes bekommen sie nur freie Mahlzeit und je nach Freigiebigkeit des Fürsten, die dieser nur durch Krieg und Raub ausüben kann, ein Kriegspferd. Die kriegerischen Begleiter des Fürsten sind auch nicht dazu zu bringen, das Land zu bebauen: „Sie halten es vielmehr für eine Trägheit und Niederträchtigkeit, dasjenige durch Schweiß zu erlangen, was man durch Blut erwerben kann“ (Tacitus 1766, S. 612).
An dieses zum Teil auch positive Feindbild der Germanen schließt sich das äußerst negative Hunnenbild des letzten großen römischen Historikers Ammianus Marcellinus an, das im Grunde genommen eine Fortsetzung der Ansichten der Griechen über das wilde Volk der Skythen darstellt: „Da gleich nach der Geburt in die Wangen der Kinder mit dem |50|Messer tiefe Furchen gezogen werden, damit der zu bestimmter Zeit auftretende Bartwuchs durch die runzligen Narben gehemmt wird, werden sie unbärtig alt und ähneln, jeglicher Schönheit bar, den Eunuchen. Sie besitzen gedrungene und starke Glieder und einen muskulösen Nacken und sind so entsetzlich entstellt und gekrümmt, dass man sie für zweibeinige Bestien halten könnte. Sie kennen keine festen Wohnsitze, sondern schweifen umher, ohne Haus, ohne Gesetz und feste Lebensweise, immer wie auf der Flucht mit ihren Wagen, auf denen sie wohnen. Hier nähen ihre Frauen für sie die schmutzigen Kleidungsstücke, hier paaren sie sich mit ihren Männern, gebären ihre Kinder und ziehen sie bis zur Mannbarkeit auf. Niemand bei ihnen kann auf die Frage, woher er stamme, eine Antwort geben, denn irgendwo wurde er gezeugt, weit fort davon geboren und in noch größerer Entfernung erzogen. Wie Tiere, die keinen Verstand haben, kennen sie keinen Begriff von Ehre und Ehrlosigkeit und unterliegen keinem Einfluss von Ehrerbietung vor einer Religion oder auch nur einem Aberglauben“ (verkürzt zitiert nach Weiler 2012, S. 12). Unschwer kann man in dieser Charakteristik eines „fahrenden Volkes“ die heutige Xenophobie gegenüber den Zigeunern oder Roma erkennen.
Was nun das Verhalten gegenüber den in Rom ansässigen Fremden betrifft, so hat bereits Augustus, wenn sich eine Ernährungsnotlage abzeichnete, darauf mit rücksichtsloser Ausweisung der Fremden reagiert: „Einst hatte er während einer weit verbreiteten und schwer zu behebenden Unfruchtbarkeit der Äcker und des Viehs alle zum Verkauf stehenden Sklaven und die Insassen der Gladiatorenschulen sowie alle Fremden mit Ausnahme der Ärzte und Lehrer und einen Teil der Haussklaven aus Rom ausgewiesen“ (zit. nach Weiler 2012, S. 7). Kritisch gegenüber dieser ungerechten Fremdenausweisung äußerte sich allerdings Ammianus Marcellinus: „Schließlich ist man in seiner Würdelosigkeit so weit gegangen, dass man bei der überstürzten Ausweisung der Fremden aus der Stadt, die vor nicht langer Zeit wegen der Furcht vor einer Lebensmittelknappheit erfolgte, die Vertreter der freien Wissenschaften trotz ihrer geringen Anzahl ausstieß, ohne ihnen Zeit zum Atemholen zu lassen. Dagegen behielt man die ständigen Begleiter der Schauspieler und solche, die sich im Augenblick dafür ausgaben, in der Stadt zurück, und ebenso durften dreitausend Tänzerinnen mit ihren Chören und ebenso vielen Tanzmeistern unbehelligt bleiben“ (zit. nach Weiler 2012, S. 8) Augustus war nicht nur derjenige, der Fremdenausweisungen in großem Stil verfügte, sondern er „hielt es auch für sehr wichtig, das Volk unverfälscht |51|zu erhalten und durch keine Vermischung mit fremdem oder Sklavenblut zu verderben. Daher verlieh er das Bürgerrecht nur sehr sparsam und setzte auch den Freilassungen Grenzen“ (zit. nach Weiler 2012, S. 11). Trotzdem beklagte der römische Dichter Lucanus in drastischen Worten das Überhandnehmen der Fremden in Rom: „Rom wird nicht von seinen eigenen Bürgern belebt, sondern wimmelt vom Abschaum der Menschheit“ (zit. nach Weiler 12012, S. 11).