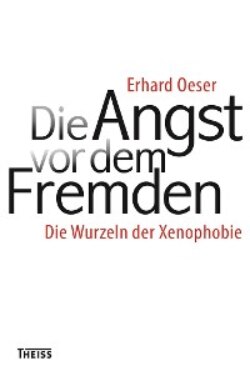Читать книгу Die Angst vor dem Fremden - Erhard Oeser - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Barbaren und Sklaven von Geburt aus: Die Fremden bei den Griechen
ОглавлениеDie Verhaltensweisen der Griechen gegenüber den Fremden im klassischen Altertum lassen sich nicht auf eine einfache Formel bringen, schon deswegen nicht, weil sie regional und entwicklungsgeschichtlich auf unterschiedlichen Einstellungen und Zielsetzungen beruhen. Das gilt |33|sowohl für den „Vater der Geschichtsschreibung“, Herodot von Halikarnass, als auch für die großen klassischen Philosophen Platon und Aristoteles.
Abb. 2: Die Autoren der Antike: Herodot, Platon und Aristoteles (Zusammenstellung von Porträts aus Herodot 1763 und von römischen Kopien der Büsten Platons und Aristoteles’)
Herodot richtet sich in seinem Geschichtswerk and die Griechen des 5. Jahrhunderts, die gerade, nachdem sie die persische Weltmacht besiegt hatten, zu ihrem eigenen Selbstbewusstsein als Hellenen fanden. Die Bezeichnung „Hellenen“, die ursprünglich nur auf einen thessalischen Stamm in Griechenland bezogen war, wurde von Herodot bereits als Gegenbegriff zu den fremden „Barbaren“ verwendet und setzte sich dann allgemein als Name für alle Griechen durch. Seine Darstellung des Krieges der griechischen Stadtstaaten gegen die persische Übermacht diente zur eigenen Identitätsfindung als einer Kultur mit einer gemeinsamen Geschichte. Auch die ethnographischen Beschreibungen der andersartigen Lebensgewohnheiten und Sitten der Ägypter und Perser, der Babylonier und Skythen erfüllten die Funktion, aus dem Kontrast das Gemeinsame der Hellenen ins Bewusstsein zu heben. So bilden Berichte über die persische Gesetzgebung einen bedeutenden Teil des Werkes von Herodot, mit der offensichtlichen Absicht, die Perser wirklich zu verstehen, um die Kriegsschuld ermitteln zu können.
|34|Gegenüber den herumschweifenden wilden Nomadenstämmen äußert sich Herodot aber ausgesprochen fremdenfeindlich. Es sind vor allem die Skythen, von deren Sitten und Gebräuchen er die schauerlichsten Berichte liefert. So sagt er über die Gewohnheiten, welche die Skythen im Krieg befolgen: „Von dem ersten Menschen, den der Skythe erlegt, trinkt er das Blut, so wie er die Köpfe derer, die durch ihn im Treffen gefallen sind, dem König bringt. Denn kann er diesem einen Kopf bringen, so hat er Anteil an der Beute; außerdem aber nicht“ (Herodot 1794, Bd. 2, S. 162). Man erfährt auch von Herodot, dass nicht die nordamerikanischen Indianer die Ersten waren, welche die grausige Gepflogenheit des Skalpierens ihrer getöteten Feinde erfunden haben, sondern die Skythen: „Demselben die Haut abzuziehen macht der Skythe zuerst bei den Ohren rings herum einen Schnitt; dann fasst er oben den Schopf, und reißt die Haut herab. Diese reibt und bearbeitet er darauf mit den Händen und schabt hernach das Fleisch mit einer Ochsenrippe ab. Hat er dieselben auf diese Art geschmeidig genug gemacht, so dienen sie ihm dann statt eines Handtuchs. Er hängt sie an den Zaum seines Reitpferdes als ein Zeichen der Ehre und des Sieges; denn je mehr solche Handtücher bei ihnen einer aufweisen kann, desto braver ist der Mann“ (Herodot 1794, Bd. 2, S. 162). Von den Massageten berichtet Herodot: „Ist jemand sehr alt, so kommen die Verwandten zusammen, schlachten ihn nebst anderem Vieh, und kochen und essen das Fleisch, welches bei ihnen für eine große Glückseligkeit gehalten wird. Stirbt aber jemand an einer Krankheit, so wird er nicht gegessen, sondern begraben, und man hält es für einen großen Verlust, dass man ihn nicht schlachten konnte“ (Herodot 1794, Bd. 1, S. 216). Ähnliche Gebräuche überlieferte Herodot von anderen wilden Stämmen Asiens, die ihre in Stücke gehauenen Toten zusammen mit Stücken von geschlachtetem Vieh vermengen und daraus ein festliches Mahl bereiten. Doch überall gilt bei diesen menschenfressenden Wilden, dass man sich vom Fleisch eines durch Krankheit Verstorbenen hüten muss (Herodot 1794, Bd. 3, S. 99). Die rohesten Barbaren sind aber jene Nomaden, die nördlich noch weit hinter den Skythen leben. Sie bezeichnet Herodot einfach als Anthropophagen (Menschenfresser). Sie haben weder Gesetze noch Gerichte und sind am wenigsten gebildet unter allen Völkern (Herodot 1794, Bd. 4, S. 18 und 106). Trotz der Verdammung der barbarischen Sitte der Menschenfresserei ist sich Herodot durchaus bewusst, dass alle Menschen aus Tradition die Gesetze wählen würden, welche der Verfassung ihres Vaterlandes entsprechen. Als Beispiel |35|erwähnt er die Leute eines indischen Volksstammes, bei denen es Sitte ist, ihre verstorbenen Eltern zu essen, und die auf die Frage, für wie viel Geld sie ihre Väter wohl verbrennen würden, laut schrien und baten, über etwas Angenehmeres zu reden. Abschließend stellt Herodot dazu fest: „So viel vermögen also Sitten und Gebräuche“ (Herodot 1794, Bd. 3, S. 38). Das aber bedeutet nichts anderes, als dass die Tradition eines Landes die unterschiedlichen Gesetze bestimmt.
Dass aber eingewanderte Völker sich nicht an die Gesetze des Landes halten, das sie aufgenommen hat, illustriert Herodot an dem grausigen Beispiel einer skythischen Nomadenhorde, die von den Medern als Gastfreunde aufgenommen wurde. „Sie waren hoch geschätzt, weil sie junge Leute in ihrer Sprache und im Bogenschießen unterrichteten und immer auf die Jagd gingen. Doch als sie ein Mal mit leeren Händen zurückkamen, wurden sie sehr hart und schimpflich behandelt. Da entschlossen sie sich, wegen dieser unverdienten Schmach einen von den Knaben, die sie unterrichteten, zu zerstückeln. Dies taten sie, richteten den Knaben als Wildbret her, und setzten ihn so dem regierenden Herrscher vor“ (Herodot 1794, Bd. 1, S. 73).
Fremdenhass und Verachtung gegenüber den Persern wurden besonders deutlich, als sich der sagenhaft reiche Lyderkönig Krösus zu einem Krieg gegen sie entschloss. Während der Zurüstung dazu stellte ihm ein Lyder, der bei seinen Landsleuten als weiser Mann galt, folgende Frage, die zeigt, dass die Perser von vornherein als unzivilisierte Wilde angesehen wurden: „Gegen Leute, König, willst du einen Feldzug unternehmen, welche lederne Beinkleider und Röcke tragen? Welche nicht essen, was sie mögen, sondern was sie haben, und in einer wilden Gegend wohnen; überdies keinen Wein, sondern nur Wasser trinken, weder Feigen noch sonst was Gutes zu essen haben? Gesetzt nun, du siegst, was willst du ihnen abnehmen. Sie haben ja nichts. Und wirst du geschlagen, so bedenke doch, was du alles dabei verlierst! Haben sie einmal unsere Schätze gekostet, so werden sie diese gewiss festhalten und nicht mehr abtreten“ (Herodot 1794, Bd. 1, S. 65). Mit einem Wort, die Perser wurden als räuberische Barbaren und als wirtschaftliche Bedrohung angesehen.
Die Bezeichnung „Barbaren“ (wörtlich: „Stammler, Stotterer“) wird erstmals bei Homer (Ilias II, Vers 867) als Bezeichnung für alle diejenigen verwendet, die nicht oder nur schlecht Griechisch sprechen. Mit dieser Ausgangsbedeutung ist aber oft auch die Nebenbedeutung „ungebildet, roh, feige, grausam, wild, gewalttätig, habgierig und treulos“ verbunden. |36|Als negative Bezeichnung, vor allem im propagandistischen Sinn, gelangte der Begriff des Barbaren durch die Perserkriege (490–449 v. Chr.) bei den Griechen in den alltäglichen Sprachgebrauch. Durch die Erbfeindschaft zwischen Hellas und Persien entstand bei der griechischen Bevölkerung eine strikte Ablehnung der fremden Rasse, Sprache und Kultur des Kriegsgegners. Nicht so bei Herodot, der die Perser und andere Nationen keineswegs nur als fremde Barbarenvölker ansieht, sondern sich bemüht, wie er selbst in seiner Vorrede zu den Historien sagt, „die Ursachen ihrer gegenseitigen Kriege“ anzugeben. Durch diesen Versuch Herodots, sich auf die Perspektive anderer Kulturen einzulassen, wird die doppelte Bedeutung des griechischen Begriffs „xenos“ klarer, der nicht nur „Fremder“ meint, sondern auch „Gastfreund“ bedeutet. Schon in der Ilias Homers wird deutlich, dass nach den Gepflogenheiten des Gastrechtes Fremde anständig behandelt werden müssen. Das gilt auch für die nächste Generation, wenn ihre Ahnen bereits durch das Gastrecht verbunden waren. Das klassische Beispiel bei Homer ist die Beziehung zwischen Glaukos und Diomedes, deren Großväter Gastfreunde waren und die sich nicht in der Schlacht vor Troja bekämpfen, obwohl sie dort eigentlich als Feinde aufeinandertreffen. Noch eindringlicher ist die Gastfreundschaft geboten, wenn ein Fremder als Bittsteller kommt. So begibt sich der Herrscher Trojas, Priamos, als fremder feindlicher Bittsteller ins Lager der Griechen und bittet Achill, den Leichnam Hektors auslösen zu dürfen. Achill gibt den Leichnam Hektors gegen Lösegeld heraus und bewirtet Priamos als Gastfreund.
Während Homer in dem Trojaner Hektor auch den heldenhaften Barbaren kennt und die Gastfreundschaft gegenüber Fremden betont und Herodot in objektiver Weise die Ursachen der Kriege zwischen Griechen und Barbaren darstellen will, wobei sich sowohl Verschiedenheit als auch Gleichheit der menschlichen Kulturen zeigen, geht es in den staatstheoretischen Schriften der großen klassischen Philosophen Platon und Aristoteles um die in sich geschlossenen Ordnungsstrukturen der griechischen Stadtstaaten und ihre Verteidigung gegenüber äußeren Einflüssen. Daher überwiegen hier die Feindbilder der Fremden als unerwünschte Eindringlinge, vor denen man sich schützen muss. In Platons Idealstaat wird diese Aufgabe den Wächtern oder Wehrmännern zugeteilt, die dazu bestimmte körperliche und seelische Eigenschaften besitzen müssen: „Nun, scharf müssen sie doch wohl einer wie der andere sein im Wahrnehmen und schnell, um das Wahrgenommene zu ergreifen, und wiederum stark, um |37|im Notfall das Ergriffene zu verfechten“ (Platon 1958, S. 112, Politeia 375 a – 376 e). Und was die seelischen Eigenschaften des Wehrmannes betrifft, so muss er nach Platon „eifrig und tapfer sein, wenn er doch gut fechten soll“. Wenn aber die Wehrmänner von Natur aus so geartet sein müssen, erhebt sich die Frage, ob sie nicht auch untereinander und gegen andere Bürger gewalttätig sein werden. Vielmehr sollen sie ihrer Aufgabe als Beschützer des Staates entsprechend „gegen alle Befreundeten sanft sein und nur den Feinden gegenüber hart“. Aber, fragt Platon, „wo sollen wir eine zugleich sanfte und hocheifrige Gemütsart auffinden? Denn die sanftmütige Natur ist ja derjenigen entgegengesetzt, in welcher der Eifer vorherrscht“ (Platon 1958, S. 112). Die Antwort darauf gibt Platon mit einem Vergleich, der die moderne naturwissenschaftliche Erklärung der Xenophobie als angeborene Konstante vorwegnimmt. Allerdings ist es nicht die Berufung auf die Fremdenangst der Kleinkinder, wie sie heute von Verhaltensforschern (Eibl-Eibesfeldt 1991) als angeborener Ursprung der Xenophobie angenommen wird, sondern der Vergleich der Wehrmänner mit den Hunden (vgl. Oeser 2004). Denn für Platon sind es die Hunde, die diese entgegengesetzten psychischen Eigenschaften in sich vereinigen: „Denn du weißt wohl“, sagt Platon, „dass das edler Hunde Art ist, von Natur aus gegen Hausgenossen und Bekannte so sanft zu sein wie nur möglich, gegen Unbekannte aber ganz das Gegenteil“ (Platon 1958, S. 112). Und dann folgt die Behauptung, dass nicht nur die Wurzeln der Xenophobie, sondern auch die der Zuneigung zu Bekannten bei diesem Tier erfahrungsunabhängig und somit angeboren sind: „Sowie es einen Unbekannten sieht, ist es ihm böse, ohne dass jener ihm zuvor irgendetwas zuleide getan; wenn er aber einen Bekannten sieht, ist es ihm freundlich, wenn dieser ihm auch niemals irgendetwas Gutes erwiesen hat“ (Platon 1958, S. 112). Und Platon fügt im Sinne seiner Lehre von der philosophischen Natur des Hundes, wie er sie auch von den Wächtern seines Idealstaates voraussetzt, hinzu, dass diese „herrliche Beschaffenheit“ des Hundes darin besteht, dass er „an nichts anderem einen befreundeten Anblick und einen widerwärtigen unterscheidet als daran, dass er den einen kennt und der andere ihm unbekannt ist“ (Platon 1958, S. 113). Durch Verstehen des Bekannten oder Nichtverstehen des Unbekannten werden also das Verwandte und das Fremdartige bestimmt. Und dadurch ist für Platon auch das Verhalten im Verkehr mit anderen Staaten geregelt.
Der Idealstaat Platons ist, wie seine Darstellung des Wächterstandes demonstriert, das Urbild einer „geschlossenen Gesellschaft“ (Popper |38|1992). Und er ist auch keine Demokratie, in der alle Menschen, Fremde und Einheimische, gekaufte Männer und Frauen ebenso wie ihre Käufer, Rechtsgleichheit und Freiheit besitzen. Denn die Unersättlichkeit nach Freiheit führt nach Platons Meinung zur Auflösung der Demokratie, und zwar dann, wenn die Bürger sofort unwillig werden und Zwang nicht ertragen, trotzdem er ihnen noch so wenig auferlegt wird. Das führt dazu, dass sie sich zuletzt um die Gesetze gar nicht kümmern, mögen es geschriebene oder ungeschriebene sein. Vor allem aber ist es die Einführung fremder Gepflogenheiten und Gesetze, die den Untergang eines Staates bedeuten. Deshalb muss sowohl die Aufnahme anderswoher kommender Fremder als auch die Reise der eigenen Bürger außer Landes streng geregelt werden. Denn der gegenseitige Verkehr zwischen den Staaten erzeugt Gewohnheiten aller Art, indem Fremde manche Neuerungen hervorrufen. Das aber könnte Staaten, welche vermittels guter Gesetze wohleingerichtet sind, den allergrößten Schaden bringen (Platon 1959, S. 306).
Hinsichtlich der Reisen in andere Länder und Gegenden und der Aufnahme Fremder ist daher nach Platon so zu verfahren: „Keinem, der jünger als vierzig Jahre, ist, sei es irgendwann und irgendwie sowie auch nicht in eigenen Angelegenheiten, zu verreisen gestattet; in öffentlichen dagegen sei das den Herolden und Gesandten gestattet“ (Platon 1959, S. 307, Nomoi 950 d). Aber ein derart geschlossener Staat, der bei mangelndem Verkehr mit anderen Staaten gute und schlechte Menschen nicht kennenlernte, könnte auch seine Gesetze bloß durch Gewöhnung nicht aufrechterhalten ohne einen Vergleich mit anderen, deren Kenntnis sehr viel wert sein könnte. Solche als Beobachter entsandte Bürger müssen aber über fünfzig Jahre alt sein und sich im Krieg und in andern Dingen bereits ausgezeichnet haben. Erweisen sich die Erfahrungen des zurückgekehrten Beobachters als besser als die eigenen Gesetze, dann muss er gelobt werden. „Erkennt man dagegen den Zurückgekehrten für einen Verderbten, dann verkehre er, indem er sich das Ansehen eines Weisen gibt, mit niemandem, weder jung noch alt, sondern lebe, gibt er den Staatsbeamten Gehör, vom Öffentlichen fern. Tut er das aber nicht, dann treffe ihn, wird er vor Gericht überführt, in Bezug auf die Erziehung und die Gesetze auf irgendwelche Neuerungen zu sinnen, der Tod“ (Platon, 1959, S. 308).
Was aber die fremden Reisenden betrifft, so unterscheidet Platon vier Kategorien, denen gegenüber unterschiedliche Verhaltensweisen angebracht |39|sind: Die erste Gruppe sind die Handelsreisenden, die im Sommer Vögeln gleich das Land durchfliegen. Diese sollten von den Beamten außerhalb der Stadt empfangen werden, wobei darauf zu achten sei, dass die Fremden keine Neuerungen einführen und dass die Bevölkerung möglichst wenig mit ihnen verkehrt (Platon, 1959, S. 308f.). Die zweite Gruppe sind die Besucher von musischen Veranstaltungen; diese sollten in Herbergen in der Nähe von Tempeln Quartier beziehen, und die Priester und Tempelwächter hätten dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht allzu lange hier verweilen. Unter die dritte Fremdenkategorie fällt derjenige, der mit irgendwelchen öffentlichen Aufträgen aus einem anderen Land kommt. Ihm gebührt als Gast der hohen Würdenträger der Stadt eine öffentliche Aufnahme (Platon, 1959, S. 309). „Der vierte, sollte so einer einmal sich einfinden, ist ein seltener Gast; sollte also nun irgendeinmal ein solches Ebenbild unseres Reisenden aus einem andern Lande eintreffen, dann sei er erstens nicht unter fünfzig Jahre alt und außerdem begierig, etwas Schönes, durch seine Schönheit vor dem in andern Staaten Bestehenden sich Auszeichnendes kennenzulernen oder auch einen andern Staat mit etwasso Beschaffenem bekannt zu machen“ (Platon, 1959, S. 309).
Platon spricht zwar auch von der Existenz von gekauften Sklaven, die nicht die gleichen Rechte genießen wie die freien Bürger, doch es war Aristoteles, der die verhängnisvolle Lehre von den „Sklaven von Natur aus“ vertrat, die ihre Wirksamkeit bis in die Neuzeit bewahrt hat. Denn die wilden Völker Afrikas und der Neuen Welt wurden ohne Bedenken von ihren Eroberern und Unterdrückern von vornherein als geborene Sklaven angesehen und als Handelsobjekte verschachert. Das Argument, dass es sich dabei um Menschen handelt, die nur zur körperlichen Arbeit taugen und zu geistigen Leistungen nicht oder nur eingeschränkt fähig sind, hat seinen Ursprung in der „Politik“ des Aristoteles. Während Platon als Hundeliebhaber den Tier-Mensch-Vergleich benützt, um die angeborenen Vorzüge der Beschützer seines Idealstaates, der Wächter oder Wehrmänner, zu preisen, verhelfen uns nach der Meinung von Aristoteles „Sklaven und Haustiere nur zur Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse“. Menschen aber, „deren Aufgabe im Gebrauch ihrer Leibeskräfte besteht und denen das die höchste Leistung ist, sind daher Sklaven von Natur aus“ (Aristoteles 1943, S. 10). Denn für derjenigen, der an der Vernunft nur insoweit teilhat, dass er sie in anderen vernimmt, aber nicht selbst hat, sondern sich ausschließlich durch Gefühlseindrücke und sinnliche Empfindungen |40|regieren und leiten lässt, für den ist es auch nützlich und gerecht, Sklave zu sein.
Mit Blick auf die Sklaven ist eine weitere Unterscheidung zu treffen. Aristoteles spricht nämlich von Sklaverei in doppeltem Sinne: Es gibt nicht nur Sklaven von Natur aus, sondern auch eine Sklaverei aufgrund des Gesetzes. Das betreffende Gesetz beinhaltet eine gewisse allgemeine Übereinkunft dahingehend, dass der im Krieg Besiegte Eigentum des Siegers sein soll. Gegen dieses Recht nun erheben Gesetzesgelehrte Klage auf Gesetzwidrigkeit, als wäre es schrecklich, dass der Besiegte der Sklave und Diener dessen sein sollte, der ihn besiegen kann und ihn an Stärke übertrifft. Zwar ist die Sklaverei nach Kriegsrecht im Allgemeinen gerecht, jedoch nicht in allen Fällen. Sonst könnten Männer aus anerkannt edelstem Stamme Sklaven sein, wenn sie zufällig zu Gefangenen gemacht und verkauft würden. Hieraus erhellt aber auch, dass nicht alle Arten der Herrschaft über Sklaven untereinander gleich sind. Die eine bezieht sich auf gefangene freie Fremde, die andere auf Sklaven von Natur aus. Demnach sind nur die gefangenen Barbaren als echte Sklaven zu bezeichnen (vgl. Aristoteles 1943, S. 12), während Kriegsgefangene aus zivilisierten Ländern einen anderen Status und ein anderes Ansehen besitzen, das auch Freundschaft mit ihren Besitzern nicht ausschließt.