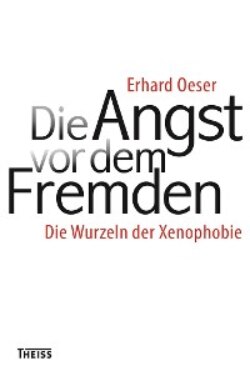Читать книгу Die Angst vor dem Fremden - Erhard Oeser - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die philosophischen Grundlagen der Ethnologie
ОглавлениеWill man die Frage nach den Ursachen der Xenophobie auf wissenschaftliche Weise untersuchen, so stößt man auf ein vielschichtiges, komplexes Problem, das nicht nur von einem Bereich der Wissenschaft behandelt werden kann. Seit dem Beginn der Aufklärung beschäftigen sich mit dem Thema fremder Kulturen eine Reihe von kulturwissenschaftlichen Disziplinen wie Völkerkunde, Sozialanthropologie, Kulturanthropologie und Kulturgeschichte. Die Ethnologie oder Völkerkunde war einst mit dem Anspruch angetreten, alle Völkerschaften in ihrer jeweiligen kulturellen Besonderheit zu erfassen und damit etwas über die kulturelle Entwicklung der Menschheit aussagen zu können, doch konkret war ihr Forschungsfeld von Anbeginn an auf die „Wilden“, die archaischen Stammesgesellschaften, eingegrenzt. Schon die ersten fachlich ausgebildeten Ethnographen waren sich darüber im Klaren, dass ihre Arbeit darin bestand, fremde Kulturen zu untersuchen, die noch existierten, aber durch zunehmende zivilisatorische Einflüsse bald der Vergangenheit angehören würden. Die merkwürdige Lage, in der sich die Ethnologie schon seit einiger Zeit befindet, hat Bronislaw Malinowski folgendermaßen beschrieben: „Die Ethnologie befindet sich in der traurig absurden, um nicht zu sagen, tragischen Lage, dass genau in dem Augenblick, da sie beginnt, ihre Werkstatt in Ordnung zu bringen, ihre eigentlichen Werkzeuge zu schmieden und an die ihr zugewiesene Aufgabe zu gehen, das Untersuchungsmaterial hoffnungslos schnell dahinschwindet. Gerade jetzt, da die Methoden und Ziele der wissenschaftlichen Feldethnologie Gestalt angenommen haben, da hierfür gut vorbereitete Männer sich angeschickt haben, in unzivilisierte Länder zu reisen und deren Einwohner zu studieren – sterben diese direkt vor unseren Augen aus“ (Malinowski 1922, S. 15). Und jene Völker, muss man hinzufügen, die sich inzwischen zu eigenen Staaten entwickelt haben, lehnen es ab, von der europäischen Ethnologie erforscht zu werden, da sie in ihr ein Relikt kolonialer Herrschaft erblicken.
Tatsächlich war ja Europa seit Jahrhunderten dabei, alle Kontinente zu erobern und die fremden Völker zu unterwerfen. Im Windschatten der |17|europäischen Kolonialisierung der Welt hat sich daher auch die Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin etabliert. Europäische Nationen konkurrierten in der Unterwerfung und Ausbeutung der von ihnen entdeckten Länder. Missionierung und Zivilisierung waren oft nur ein Vorwand zu immer grausamerer Unterdrückung. Aber man wird der Ethnologie nicht gerecht, „wenn man sie mit dem Kolonialismus unmittelbar in einen Topf wirft. Ihre auf das Verstehen fremder Kulturen gerichtete Fragestellung steht in grundlegender Gegnerschaft zum Kolonialismus und Imperialismus. Denn im Verstehen liegt die grundsätzliche Anerkennung der Subjektivität der fremden Kulturen begründet“ (Schmied-Kowarzik 1998, S. 10). Diese grundsätzlich andere, verständnisvolle Einstellung zum Fremden schließt jedoch keineswegs aus, dass ethnologisches Wissen instrumentell missbraucht worden ist und weiterhin missbraucht werden kann. Es kann auch nicht geleugnet werden, dass es unter den Ethnologen Kollaborateure mit dem Kolonialismus und Imperialismus gegeben hat und dass Ethnologen gerade heute – oftmals unwissend und wider Willen – für Entwicklungsprojekte eingesetzt werden, die nicht der Selbstbestimmung der fremden Kulturen zuarbeiten, sondern ihrer Unterjochung dienen oder gar ihre Auslöschung betreiben. Doch der heutigen kulturwissenschaftlich orientierten Ethnologie geht es prinzipiell um ein Verstehen der kulturellen Lebens- und Sinnzusammenhänge aus ihrer je eigenen Perspektive heraus. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis von der unvermeidlichen Subjektivität der sich langsam herausbildenden europäischen Ethnologie.
So stellt die heutige Aufgabe der Ethnologie ein komplexes, weil gegenläufiges Unternehmen dar. Ursprünglich auf Beobachtung und verstehende Teilnahme beschränkt, wird gerade in unserer globalisierten Welt das Ziel nicht durch bloß theoretisches Erkenntnisinteresse bestimmt werden, sondern muss der praktischen Verständigung dienen. Man würde aber den politischen Begriff der Verständigung gründlich missverstehen, hörte man aus ihm lediglich Harmonie, Dialog und Friedfertigkeit heraus (vgl. Schmied-Kowarzik 2002, S. 21). Natürlich ist es richtig, dass jeder Fremde – der religiös anders Denkende, der kulturell anders Geprägte, der anders aussehende Mensch – jederzeit zum Feind erklärt werden kann. Diese Realität, die wir bei uns wie überall auf der Welt und zu allen Zeiten vorfinden, muss durch gegenseitige Verständigung überwunden werden. Doch ist darunter nicht die Aufhebung aller Differenzen schlechthin zu verstehen: „Fremde wird es immer geben, es |18|geht vielmehr darum, den Fremden in seiner Andersheit anzuerkennen, sein Fremdsein einzusehen, es zu akzeptieren und auszuhalten“ (Schmied-Kowarzik 2002, S. 21f.).
Abb. 1: Jean-Jacques Rousseau und Voltaire (nach zeitgenössischen Porträts)
Wenn sich heutzutage Xenophobie als ein zentrales Problem der Ethnologie als Wissenschaft von den fremden Völkerschaften erweist, ist daher auch eine grundsätzliche Erweiterung ihres heutzutage disziplinär verengten Forschungsfeldes nötig. Eine solche Erweiterung sollte auch, wie Schmied-Kowarzik betont, die traditionellen philosophischen Grundlagen mit einschließen, die in der Zeit der Aufklärung entwickelt worden sind und die auch die wissenschaftlichen Begleiter der Entdecker und Weltumsegler, wie zum Beispiel Georg Forster, beeinflusst haben.
Es sind vor allem zwei Namen, Rousseau und Voltaire, die in der Neuzeit sowohl den Forschungsreisenden eine Leitlinie gaben als auch umgekehrt die empirischen Forschungsergebnisse der fremden Welten als Belege für die Gültigkeit ihrer Ideen betrachteten. Obwohl die von ihnen beschworene Einheit des Menschengeschlechtes auch naturwissenschaftlich durch Darwins Evolutionstheorie und durch die moderne Genetik im Bezug auf die Gleichheit der biologischen Art Homo sapiens bestätigt worden ist, gibt es bis heute das Problem der unleugbar vorhandenen |19|Ungleichheit der Menschen. Über die Frage nach dem Ursprung dieser Ungleichheit unter den Menschen lieferte Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) eine erste Antwort, die über Jahrhunderte hinweg die wissenschaftliche Diskussion bestimmt hat: Es ist die Zivilisation und die Kultur, die diese Ungleichheit unter den Menschen schafft. Rousseau geht in seiner Abhandlung über die „Ungleichheit unter den Menschen“ von der genetischen Einheit des Menschengeschlechtes aus, die er noch am reinsten in dem Wilden repräsentiert sieht. Doch kaum erschienen, regte sich dagegen die Kritik seines Mitstreiters in der Aufklärung, des Philosophen Voltaire (1694–1778). Dieser bezeichnete Rousseaus Abhandlung als ein „Buch gegen das Menschengeschlecht“, nach dessen Lektüre man Lust verspüre, auf allen Vieren zu laufen: „Niemand hat es mit mehr Geist unternommen“, schreibt er an Rousseau, „uns zu Tieren zu machen, als Sie; das Lesen Ihres Buches erweckt in einem das Bedürfnis, auf allen Vieren herumzulaufen. Da ich jedoch diese Beschäftigung vor einigen sechzig Jahren aufgegeben habe, fühle ich mich unglücklicherweise nicht in der Lage, sie wieder aufzunehmen“ (Brief Voltaires an Rousseau vom 30. August 1755, Correspondance Bd. 68, S. 280).
Rousseau sieht sich jedoch in seiner Ansicht durch die Entdeckungen neuer Völker bestätigt. Für ihn sind die wilden Fremden Afrikas und der Karibik oder die Indianer Nordamerikas nur die übrig gebliebenen Repräsentanten der ursprünglichen Einheit der Menschennatur. Von dem wilden Menschen der Vorzeit, der „einsam, müßig und immer von Gefahren umgeben“ war, entwirft er daher folgendes Bild: Er wird gern schlafen, und sein Schlaf muss so leicht sein wie der der Tiere, die wenig denken und die gewissermaßen ständig schlafen, wenn sie nicht denken. Da die Selbsterhaltung fast seine einzige Sorge ist, müssen sich bei ihm jene Fähigkeiten am besten entwickeln, die vor allem auf den Angriff und die Verteidigung gerichtet sind. Das bedeutet: Er muss entweder selbst auf Raub ausgehen und seine Beute erobern oder sich schützen, um nicht der Raub eines anderen zu werden. Alle Organe, die sich nur durch Weichlichkeit und Verzärtelung vervollkommnen können, müssen bei ihm in einem groben Zustande bleiben, der jede Verfeinerung ausschließt. Seine Sinne müssen also verschieden beschaffen sein. Gefühl und Geschmack müssen außerordentlich grob, Tast-, Gehör- und Geruchssinn aber sehr fein sein. So verhält es sich bei sämtlichen Tieren und, nach Berichten von Reisenden, auch bei den meisten wilden Völkern (vgl. Rousseau 1953, S. 55f.). Man darf sich also nicht wundern, sagt |20|Rousseau, dass die Hottentotten am Kap der Guten Hoffnung die Schiffe mit dem bloßen Auge aus der gleichen Entfernung erkennen wie die Holländer mit ihren Fernrohren. Die amerikanischen Wilden vermögen ebenso gut wie die besten Hunde die Spanier an ihren Fährten aufzuspüren. (vgl. Rousseau 1953, S. 76).
„Hüten wir uns aber“, warnt Rousseau, „die wilden Menschen mit denen zu verwechseln, die wir vor Augen haben. Die Natur behandelt alle Tiere, die ihrer Obhut anvertraut sind, mit einer Liebe, aus der ersichtlich wird, wie eifrig sie auf ihre Rechte bedacht ist. Das Pferd, die Katze, der Ochse und selbst der Esel haben in den Wäldern eine ansehnliche Gestalt, eine kräftige Konstitution, mehr Stärke, Kraft und Mut als in unseren Behausungen. Wenn diese Tiere gezähmt werden, dann verlieren sie den größten Teil ihrer Vorzüge, und es scheint, als ob all unsere Sorge für Pflege, Wartung und Futter dieser Tiere sie nur um so mehr entkräftete. Mit dem Menschen ist es nicht anders. Sobald er in die Gesellschaft tritt und in Knechtschaft gerät, wird er schwach, feige, kriecherisch, und seine verweichlichte und verzärtelte Lebensweise entnervt schließlich völlig seinen Mut und seine Kraft“ (Rousseau 1953, S. 54). Man erkennt in diesen Worten Rousseaus unschwer die in der modernen vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie) im Hinblick auf die Zivilisationsschäden und Degenerationserscheinungen von Konrad Lorenz vorgebrachte, aber auch viel kritisierte Vorstellung von der „Verhausschweinung“ des heutigen Menschen. Solche tatsächlich vorhandenen Degenerationserscheinungen sind jedoch unbedeutend gegenüber der explosiven Vermehrung der Menschheit auf dieser Erde und der gesteigerten Lebenserwartung des Menschen in den zivilisierten Industrieländern.
Auch Rousseau hat den Wilden, der in den Wäldern umherirrte, nicht als den edlen Menschen verherrlichen wollen und daher auch niemals die Rückkehr zum Naturzustand für möglich, ja auch nur für wünschenswert gehalten: Der wilde Mensch war nach seiner Meinung nur wenigen Leidenschaften unterworfen. Er kannte keinen Beruf, keine Sprache, keinen Wohnsitz, keinen Krieg. Ihm waren nur die Einsichten und Empfindungen geläufig, die dem Naturzustand entsprachen. Er fühlte nichts anderes als seine wahren Bedürfnisse. So konnte sich sein Verstand nicht weiterentwickeln. Stieß er unvermutet auf eine Entdeckung, so konnte er sie niemandem mitteilen, da er nicht einmal seine eigenen Kinder kannte. „Jede Fertigkeit starb mit ihrem Erfinder aus. Es gab weder Erziehung |21|noch Fortschritt. Geschlecht folgte auf Geschlecht, ohne dass darin ein Sinn zu liegen schien. Jede neue Generation musste wieder von vorn beginnen. Jahrhunderte verstrichen, aber die Menschen verharrten in ihrem Zustand der Plumpheit. Die Gattung war schon alt, doch der Mensch blieb stets ein Kind“ (Rousseau 1953, S. 81). Nicht der Naturzustand selbst, sondern die Epoche der entstehenden Gesellschaft, „als sich die menschlichen Fähigkeiten entwickelten“, war daher für Rousseau die glücklichste Zeit der Menschheit, „denn sie hält zwischen der Trägheit des ursprünglichen Zustandes und der törichten Wirksamkeit unserer Eigenliebe die richtige Mitte“. Aber auch diese Zeit ist unwiederbringlich vorbei. „Der Mensch wurde böse, als er gesellig wurde. Die Menschen und die gesamte Weltordnung sind seit jener Zeit auf den Stand herabgesunken, auf dem wir sie heute antreffen“ (Rousseau 1953, S. 84).
Im Gegensatz zu Rousseau sieht Voltaire nicht in der Zeit des Übergangs der ursprünglichen Wildheit des Menschen in die Epoche der entstehenden Gesellschaft die wichtigste Epoche der Menschheit, sondern für ihn ist der bisherige Höhepunkt die Epoche des französischen Bürgertums, dem er selbst entstammt. Sein umfangreiches „Essai sur les moeurs“, in dem er diese Ansicht zu begründen versucht, ist eine Universalgeschichte des menschlichen Geistes, die sich nicht mehr nur auf die Wiedergabe der großen politischen Ereignisse beschränkt, sondern die Geschichte der Veränderungen, Lebensgewohnheiten und Sitten der Völker beschreibt und somit eines der ersten ethnographischen Dokumente darstellt. Dabei ist er sich der Subjektivität der eigenen Sichtweise bewusst, wenn er sagt: „Wir müssen uns vor unserer Gewohnheit hüten, alles nach unseren Gebräuchen zu beurteilen“ (Voltaire 1878, XI, S. 208; vgl. Kohl 1981, S. 81). Doch es gibt für ihn Regeln, die allen Menschen von Gott eingeschrieben sind und die den Geschichtsverlauf bestimmen. Es sind der Hang zur Geselligkeit und die sich gegenseitig die Waage haltenden Kräfte der „Leidenschaft“ und der „universellen Vernunft“, jene „von der Natur in unsere Herzen eingeprägten Eigenschaften, in denen sich alle Völker gleichen und die, bei allen äußeren Unterschieden der menschlichen Rassen, die Einheit der Gattung und ihrer Geschichte verbürgen“ (Voltaire 1878, XII, S. 370; vgl. Kohl 1981, S. 155f.).
Ursprünglich hatte Voltaire nicht daran gedacht, die Geschichte der wilden Völker ohne Zivilisation im Rahmen seines Essays zu berücksichtigen, da man aus ihr keine Lehren ziehen könne. So sagt er im Vorwort von 1756: „Man muss die Augen abwenden von jenen wilden Zeiten, die |22|die Schande der Natur sind.“ Doch unter dem Einfluss Rousseaus ergänzte er in der Neuauflage sein Geschichtswerk mit längeren Ausführungen über die wilden Völker Afrikas und Amerikas. Während er schon früher den großen Kulturen des Orients jeweils eigene Abschnitte gewidmet hatte und damit auch formal deren Eigenständigkeit gegenüber den europäischen Nationen zum Ausdruck brachte, erfolgt erst in der Neuauflage von 1761 die Beschreibung der amerikanischen und afrikanischen Gesellschaften im Rahmen ihrer Entdeckung und Eroberung durch die europäischen Kolonialmächte. So werden dort die Entdeckungsfahrten des Kolumbus, die Eroberungszüge von Cortés und Pizarro, die Geschichte der europäischen Niederlassungen in Brasilien und Nordamerika, das Wirken der Jesuiten in Paraguay und die langwierige Besiedlung Amerikas abgehandelt. Darüber hinaus werden auch die physischen Merkmale, die Lebensgewohnheiten, Gesellschafts- und Religionsformen der westafrikanischen Völker, der Kaffern und der Hottentotten in Zusammenhang mit der Geschichte der portugiesischen Entdeckungsfahrten und des Sklavenhandels geschildert. Im Verlauf seiner Ausführungen kommt er jedoch zu höchst problematischen Ansichten, die man heute als Xenophobie vor allem in der speziellen Form der damals unter den Gelehrten Europas weit verbreiteten Negrophobie ansehen muss. Denn bei aller moralischer Empörung, mit der Voltaire die Grausamkeiten der Kolonisatoren und die Unmenschlichkeiten des Sklavenhandels verurteilt, bildet für ihn der geringe Widerstand, den all diese Völkerschaften ihrer Unterwerfung, Versklavung und Ausrottung durch die Europäer entgegenzusetzen vermochten, einen Gradmesser dafür, in welchem Ausmaß die dem von Rousseau gepriesenen Naturzustand noch am nächsten stehenden Gesellschaften den zivilisierten europäischen tatsächlich unterlegen sind. So sagt er von den Schwarzen Afrikas: „Die Rasse der Neger ist eine Menschengattung, die von der unsern so verschieden ist, wie die Hühnerhunde von den Windspielen“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 39). „Weder ihre schwarze Haut noch ihre schwarze Wolle gleicht unserer Haut und unserm Haar. Auch ist die Form ihrer Augen nicht die unsere.“ Und Voltaire glaubt auch sagen zu können, dass ihre Intelligenz von sehr untergeordneter Art ist: „Daher kommt es, dass die Neger die Sklaven der anderen Menschen sind. Man kauft sie an den Küsten Afrikas wie Vieh, und die zahlreiche Menge dieser nach unsern amerikanischen Kolonien versetzten Schwarzen dient einer sehr kleinen Zahl von Europäern“, und er fügt in Bezug auf die Eroberung der Neuen Welt hinzu: |23|„Die Erfahrung hat auch gelehrt, wie überlegen diese Europäer den Amerikanern sind, welche, allenthalben besiegt, niemals gewagt haben, eine Revolution zu versuchen, obwohl sie mehr als tausend gegen einen waren“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 65f.).
Die Hauptursache für die Vernichtung dieser Völker liegt daher für Voltaire bei ihnen selbst, nämlich in der mangelnden Ausbildung der Verstandeskraft. Denn die Neger glauben, da sie „keiner großen Aufmerksamkeit fähig sind“ und auch „wenig kombinieren“, nur deswegen „in Guinea geboren zu sein, um an die Weißen verkauft zu werden und ihnen zu dienen“ (zit. nach Kohl 1981, S. 162). So befanden sich die westafrikanischen Stammesgesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung durch die Portugiesen zum größten Teil noch im „ersten Stadium der Dumpfheit (premier degré de stupidité)“, das darin besteht, „nur an die Gegenwart zu denken und an die Bedürfnisse des Körpers“. Die „sanften und unschuldigen Sitten“ der Hottentotten zeigen dagegen an, dass sie bereits einen „zweiten Grad der Dumpfheit“ erreicht hatten, der „eine formlose und auf gemeinsamen Bedürfnissen gegründete Gesellschaft erlaubt“. „Zwischen diesen beiden Graden der Schwachsinnigkeit (imbecillité) und der beginnenden Vernunft (raison commencée) hat mehr als nur eine Nation Jahrhunderte lang gelebt“ (Voltaire 1878, XII, S. 358; vgl. Kohl 1981, S. 162).
Während die Negrophobie bei Voltaire derart ausgeprägt ist, kann man ihm keinesfalls Islamophobie vorwerfen. Im Gegenteil ist er der Meinung, dass „die Araber Asien, Afrika und einen Teil Spaniens zivilisiert haben“ bis zu der Zeit, als sie vertrieben wurden, worauf „Unwissenheit alle diese schönen Länder bedeckte“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 265f.). Und er vertritt auch die Auffassung, dass „man sich nicht weniger irrt, wenn man glaubt, die Religion der Mohammedaner sei nur durch Waffengewalt eingeführt worden“. Die Spaltung in Sunniten und Schiiten ist für ihn gleichfalls nicht durch Gewalt erfolgt. Denn „die Sekte Omars bekämpft die Sekte Alis durch das Wort“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 272). Von den Sitten der Türken sagt er, dass sie einen großen Kontrast zeigen: „Dieses Volk ist zugleich grausam und wohltätig; es ist eigennützig, und begeht doch niemals Diebstahl. Ihrer Religion unerschütterlich treu, hassen und verachten sie die Christen, die sie als Götzendiener betrachten und die sie aber trotzdem in der Hauptstadt sowie in ihrem ganzen Reich dulden und beschützen“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 235).
Aber was die Amerikaner anbelangt, so stimme man nach seiner Meinung allgemein darin überein, „dass der menschliche Verstand in der |24|Neuen Welt im Allgemeinen nicht so ausgeformt ist wie in der alten“. So waren die Peruaner wegen ihrer wissenschaftlichen, besonders astronomischen Kenntnisse und architektonischen Leistungen in Voltaires Augen zwar „die zivilisierteste Nation der Neuen Welt“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 85). Aber sie waren auch „sanfte und schwache Menschen“, was zugleich die Ursache ihres Untergangs war. Denn sogar dann, als sich die Eroberer Perus, Pizarro und Almagro, in den Haaren lagen und einander blutige Gefechte lieferten, wagten es die Peruaner nicht, die Schwächung ihres gemeinsamen Feindes zu nutzen; im Gegenteil warteten sie „in stupider Ruhe ab, von welche Partei ihrer Vernichter sie unterworfen werden würden“ (Voltaire 1867, 5. Teil, S. 88).
Anstelle des Bildes, das Rousseau vom einsamen Wilden entworfen hat, kann Voltaire, indem er sich bereits auf die Berichte der Reisenden und Missionare beruft, feststellen, dass „unter so vielen von uns und auch untereinander verschiedenen Nationen nirgends isolierte und ungesellige Menschen gefunden, die nach Art der Tiere blind umherirren, sich aufs Geratewohl begatten und ihre Weibchen verlassen, um allein auf Nahrungssuche zu gehen. Es muss wohl so sein, dass sich die menschliche Natur nicht mit diesem Zustand verträgt, und dass der Instinkt der Gattung sie zur Gesellschaft ebenso drängt wie zur Freiheit“ (zit. nach Kohl 1981, S. 163). Mit der Vorstellung, dass die unterschiedlichen Entwicklungsstadien, auf denen sich die Gesellschaften Afrikas und Amerikas zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung durch die Europäer befanden, die einzelnen Etappen der menschlichen Vorgeschichte darstellen, dienen sie Voltaire als lebende Zeugen dafür, welch ungeheuren Zeitraumes es bedurfte, bis sich die Menschheit aus dem tierischen Zustand erhob, in welchem sie so lange verharrt hatte.
Doch diese Annahme von unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Menschheit, die sich im Laufe der Zeit nicht ausgeglichen, sondern eher verfestigt haben, hat heutzutage zu der Vorstellung eines „Kampfes der Kulturen“ geführt, die nicht zu Unrecht als eine Art von „Neorassismus“ bezeichnet wird. Denn sie ist eine Denkweise, die kulturelle Differenzen anstelle von genetischer Ausstattung für „angeboren, unauslöschlich und unveränderbar“ erklärt (vgl. Fredrickson 2004, S. 13).