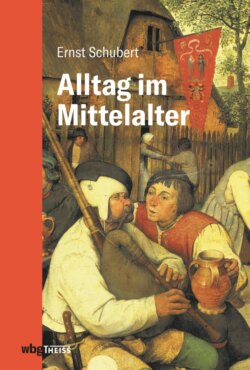Читать книгу Alltag im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Urwald –„Unland“– Kulturland: Überleben im Frühmittelalter
Оглавление„Germanien ist schrecklich mit seinen Wäldern“5 – der Ausruf des Tacitus läßt den Eindruck erahnen, den die Landesnatur auf die Römer machen mußte, die in einem sonnenbegünstigten Gartenland aufgewachsen waren. Ein Wunder sind für Plinius diese Wälder: „Sie bedecken das ganze übrige Germanien und vereinen mit der Kälte das Dunkel.“ Alt wie die Welt, von unsterblicher Lebensdauer, unberührt seit Jahrhunderten sei der herzynische Wald des Nordens. Nur literarische Übertreibungen, wenn nicht gar Phantasien antiker Autoren, die durch Pollenanalysen aus den Hochmooren widerlegbar sind?6 Ohne uns auf diese zwar wichtigen, aber nur für einen regionalen Umkreis aussagekräftigen Analysen zu verlassen, berufen wir uns für die allgemeinen Zustände auf die Forschungen von Ulrich Willerding zur frühmittelalterlichen Flora: „Nach dem Laubaustrieb im Frühjahr bleibt den Bodenpflanzen in solchen Wäldern nur wenig Licht. Es ist daher nicht erstaunlich, daß aus derartig dunklen Wäldern kaum eine im Sommer blühende Zierpflanze kommt.“7 (Die uns so vertrauten Gartenblumen sind erst im Verlauf des Mittelalters, teilweise von weither, in deutsche Lande eingewandert.)8 Ein schlagender Beweis. Germaniens Wälder waren tatsächlich tief dunkel.
Dieser Urwald war im Verlauf der Klimaverschiebung seit der Jungsteinzeit entstanden, als das Landklima vom Seeklima durchsetzt wurde. Den lichten Haselbusch, der, wie Blütenstaubuntersuchungen ergaben, noch in der mittleren Steinzeit das Land überwuchert hatte, verdrängten die ozeanischen Bäume: Buche, Tanne und Eibe wanderten ostwärts.9 Die Linden verbreiteten sich seit prähistorischer Zeit in Nordwesteuropa in einem Maße, das nur mit den Buchen vergleichbar ist.10 Mit diesen Bäumen trat die lichtbedürftige Eiche in Konkurrenz.11 Buchenwälder, auf Mineralböden vorherrschend, gab es wesentlich häufiger als Eichenwälder. Die Buche, die mit einem Drittel des Lichtbedarfs der Eiche auskommt, war auch aufgrund ihres schnelleren Wachstums im Vorteil in den dichten Urwäldern, wo der Kampf um das Licht zur Überlebensfrage wurde. In Feuchtgebieten, in denen die Buche nicht gedeiht, konnte die Eiche dominieren;12 ansonsten ist vielfach ihre Verbreitung Indikator für die Auflichtung der Wälder.13 Daß die Eiche den Konkurrenzkampf mit der Buche bestand, verdankt sie ihrer wesentlich längeren Lebensdauer, ihrer besseren Sturmfestigkeit und ihrer Widerstandskraft gegen Wildfeuer, das die dünnrindigen Buchen leichter zum Absterben brachte. Nadelhölzer spielten noch eine untergeordnete Rolle. Selbst im Harz waren die Fichtenareale auf die moorigen Hochflächen beschränkt; ansonsten dominierte hier der Laubmischwald.14 Die mittelalterlichen Auewälder längs der großen Ströme, für die die ältere Forschung eine Dominanz der Eiche angenommen hatte,15 waren tatsächlich von Ulmen beherrscht und erst in zweiter Linie von Eichen, Ahorn und Esche.16 Vielfarbigkeit des Waldkleides: Wählen wir das Beispiel der Lößböden im Braunschweiger Umland. Hier gedeihen artenreiche Laubmischwälder, auf den mäßig sauren Böden stehen Buchenwälder, in den Auen der Okerniederung sind Esche, Ulme, Weide und Pappel heimisch.17
Sicherlich war nicht die gesamte Germania mit Wald überzogen, zumal die Auflichtung der Wälder mancherorts schon in der Eisenzeit begonnen haben muß, wie Pollenanalysen belegen.18 Die antiken Autoren mögen übertreibend verallgemeinert haben, aber zu viele früh- und hochmittelalterliche Urkunden bestätigen, daß sie den beherrschenden Charakterzug der Landesnatur erfaßt hatten. Dunkelheit herrschte vor allem in den ausgedehnte Lindenwäldern.19 Der Urwald, der die Römer so beeindruckte, war im frühen Mittelalter allenfalls an seinen Rändern und Ausläufern von menschlicher Siedlung angegriffen worden.20 Das Land blieb unwegsam durch seine Wälder und Sümpfe. Urwald: das war im nördlichen Europa die wichtigste Naturerfahrung. Die Worte der Genesis: Und die Erde war wüst und leer, macht um 1150 ein Mönch in diesem Bild verständlich: ein starrender Wald, ein formloses Chaos, ein seinsfremdes Gebilde.21
Nur auf Böden, die nicht vom Urwalddickicht überwachsen waren, hatten sich menschliche Siedlungen im frühen Mittelalter entwickeln können: Kulturinseln in der Wildnis, Siedlungskammern.22 Nicht Gemarkungsgrenzen, sondern Wälder trennten die Menschen voneinander. Noch im Hochmittelalter, auf dem Höhepunkt einer gewaltigen Rodungszeit, sollte man sich in Deutschland erzählen, ein Eichhörnchen könne die sieben Meilen von einem Dorf zum andern laufen, ohne je den Boden berühren zu müssen.23 So fern waren damals die Zeiten noch nicht, als die Menschen die Wälder, die sie nur an deren Säumen nutzen konnten, als das „Unland“, die Wildnis, gefürchtet hatten, das sie als unbebautes Land, als „terra inculta“ in Unterscheidung von dem bebauten Ackerland, der „terra culta“ verstanden.24 Diese Unterscheidung begegnet in einer in fränkischer Zeit entwickelten Pertinenzformel in Tausenden von mittelalterlichen Urkunden.25 „Terra inculta“, das „Unland“ war die menschenferne Wildnis von Urwald, Mooren, Sümpfen.26
So siedlungsfeindlich auch auf den ersten Blick der Wald erscheint,27 so war doch menschliches Leben ohne ihn unmöglich. Er lieferte das Holz und damit das Feuer, den Lebensnerv der Kultur. Holz war das wichtigste Baumaterial. Vorsicht aber ist bei der Vorstellung angebracht, die noch wenig gestörte Natur hätte den Menschen Wildbret in Mengen bereitgestellt. Wie Tierknochenfunde ausweisen, wurde selbst an Fürstenhöfen weniger Wild als Fleisch von Haustieren, vor allem Schweinefleisch, verzehrt.28 Nicht die Jagd ließ in Mitteleuropa den Wald unverzichtbar für das Überleben werden, sondern die Tierhaltung, die er ermöglichte.29 Eicheln und Bucheckern bildeten durch die Jahrhunderte die Grundlage der Schweinemast.30 Aus den Hütten und Pferchen, die im Wald angelegt wurden, konnten sich sogar Siedlungen entwickeln. Das lateinische „buriae“ für diese Schweinehütten lebt in den auf „-beuren“ endenden Ortsnamen weiter.31 Wegen der Waldweide wurde in frühen Kartenspielen des 15. Jahrhunderts auf dem Eichel-Blatt oft noch ein Schwein abgebildet. (Erst seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts ließen Wiesenmeliorationen, Einführung der Stallhaltung und nicht zuletzt die Kartoffel als Futtermittel die Waldweide entbehrlich werden.)
Der Wald als „Unland“ – der Wald aber auch als Voraussetzung für menschliches Überleben: Dieser Gegensatz ist in in einer Anekdote komprimiert, die vom Mainzer Erzbischof Heriger im 10. Jahrhundert erzählt und in den „Carmina Cantabrigensia“ überliefert wurde. Zu Heriger kam ein „Himmelreicher“, einer jener Vaganten, die Sensationelles vom Jenseits berichteten, das sie durchwandert hätten. Der Erzbischof stellte die Frage nach dem Aussehen der Hölle, wozu dem Vaganten nur einfiel, daß diese von dichtem Urwald umgeben sei. Lachend kommentierte der Erzbischof, dann habe man ja genügend Möglichkeiten für die Schweinemast.32
Eichel- und Bucheckernmast belegen bereits – bevor wir auf die weitere Nutzung an den Waldsäumen eingehen –, daß die Urwälder nicht nur ein „starrendes, seinsfernes Gebilde“, sondern zugleich auch eine überlebenswichtige Ressource für die Menschen waren. Und das erst macht verständlich: Wo die „fruchtbaren“ Bäume wie Eiche und Buche standen,33 lag die Residenz der Götter; hier waren die Stätten der Anbetung und des Opfers.34 Das verweist auf ein anderes Verhältnis zur Natur, die als unmittelbares Schicksal empfunden wurde, als in jener Religion, deren Missionare und Bischöfe diese heiligen Haine niederbrannten – der Missionar ist dabei kein Umweltfrevler, er will ja nicht die Natur, er will die Menschen verändern.
Natur als Gegenstand der Devotion ließ den hl. Pirmin mahnen: „Betet nicht Götzenbilder an, weder bei Felsen, noch an Bäumen, noch an abgelegenen Orten, noch an Quellen.“35 Das galt auch der „Admonitio Generalis“, dem Ordnungsprogramm Karls des Großen (789) als Frevel;36 denn der Gott des Kaisers wohnte nicht in der Natur, er thronte über ihr, er war ein aus der Natur entfernter Weltenherrscher. Ein solcher Gott aber fand nicht das Vertrauen der Menschen, welche die Kräfte der Wildnis kannten, scheuten, fürchteten und verehrten. Fränkische Mission? Die heiligen Bäume schweigen und antworten gleichwohl. Es war die gewaltbereite Mission einer Führungsschicht, die von den Erträgen bäuerlicher Arbeit lebte und die Verehrung von Bäumen als Nahrungsspender nicht verstand. Keineswegs nur auf die zwangsbekehrten Sachsen beschränkt war die Erfahrung, welche der fränkische Adel mit dem Heidentum allgemein gemacht hatte, weshalb die „Capitulatio de partibus Saxoniae“ eine nach dem Stand gestaffelte, aber nach dem jeweiligen Vermögen hohe Geldbuße demjenigen androhte, der Gelübde an Quellen, an Bäumen oder in Wäldern ablegte.37 Solche heiligen Haine, wie sie bei den Friesen bis in das 9. Jahrhundert unter Rechtsschutz standen,38 wie sie noch Anfang des 11. Jahrhunderts in den Wesermarschen verehrt wurden,39 sind allein von denen überliefert, die diesen Kult der Natur ablehnen, und erscheinen erst mit dem Vordringen des Christentums im Norden in den Quellen. Adam von Bremen berichtet über den heiligen Hain bei Uppsala, wo Menschen geopfert, Pferde und Hunde den Göttern geweiht worden seien.40 Auch für die Slawen waren bestimmte Wälder Wohnsitze der Götter, Ärgernis etwa für den Merseburger Bischof Thietmar zu Beginn des 11. Jahrhunderts41 und ebenso für den hl. Vizelin, der sich am Ende dieses Jahrhunderts im Holsatenlande nach missionarischer Tradition als Baumfäller betätigte,42 Ärgernis immer noch für den Bischof Gerold von Oldenburg i. H., als er 1156 seine erste Visitationsreise unternahm.43
Wald war im Mittelalter wesentlich verbreiteter als heute. Er konnte in seiner Undurchdringlichkeit als Bedrohung empfunden werden, wie in dieser lombardischen Buchmalerei um 1440 (Dante im Wald der Selbstmörder).
War das Vertreiben der Götter aus den heiligen Hainen nur Folge der Mission? Diejenigen, deren Leben und Überleben von den Wäldern abhing, näherten sich diesen mit frommer Scheu, nicht aber diejenigen, deren Leben auf der Arbeit der Mitmenschen beruhte: Adel und Kirche. Anders als Bauern und Hörige dachten die Herren, Adel und hohe Geistlichkeit. Ihre Grundherrschaften lagen über weite Entfernungen hin verstreut. Schon von ihren materiellen Interessen her hatten sie eine andere Vorstellung vom Raum als die den Boden bearbeitenden Menschen, die entweder als Hörige durch das Recht oder als Freie durch wirtschaftliche Notwendigkeiten an ihre Höfe gefesselt waren. Der Adel, ob geistlich oder weltlich, war im doppelten Sinne des Wortes welterfahren, hatte – zumeist auf den Flüssen, den Fernstraßen des Mittelalters, reisend – im Dienst der beiden raumübergreifenden Mächte Kirche und Königtum das Land kennengelernt, wußte um den Nutzen, nicht aber um den Wert des Waldes für das Überleben. Vom König ließen sich seit der Karolingerzeit Adel und Adelskirche große Waldbezirke, die man Bannforste nannte, schenken. Nicht nur der Missionar, sondern auch der Förster als Diener eines Adeligen vertrieb die Götter aus den Hainen. Das Wirken des Missionars war dabei, wenngleich symbolträchtig, auf die kurzfristige Aktion beschränkt, auf Dauer berechnet war hingegen das Wirken des Försters.
Oder er konnte erschlossen werden, etwa für die Jagd, wie in dieser französischen Buchmalerei vom Anfang des 15. Jahrhunderts (aus: Gaston Phébus, Le Livre de la chasse, Paris, Bibliothèque Nationale).
Als die fränkischen Könige aus der frühmittelalterlichen Wildnis Segmente schnitten, die sie unter dem Namen „Forst“ ihrer eigenen Nutzung vorbehielten, verstanden sie darunter umgrenzte Gebiete innerhalb der „terra inculta“, gleichviel, ob diese von Mooren, Sümpfen oder Bäumen und Buschwerk gestaltet waren. Jagdinteressen standen am Anfang des herrschaftlichen Forstrechts. Wildbänne.
Für die einfachen Menschen im frühen Mittelalter bedeuteten die von den Herren beanspruchten Wildbänne zunächst noch keine existentielle Beeinträchtigung. Während die Adeligen jagten, brauchten sie den Wald für ihr Überleben. Viehhaltung war die wichtigste, aber keineswegs die einzige Nutzungsmöglichkeit, die er ihnen bot.44 Eine kleine Auswahl: Bucheckern und Haselnüsse lieferten vor der Kultivierung des Rapsanbaus im 18. Jahrhundert Speiseöl.45 Das Sammeln von Waldbeeren war schon deshalb für die einfachen Leute so wichtig, weil die Ernährung in einem gesundheitsgefährdenden Maße eintönig war. Die Ausgrabungen der Wurtensiedlung Elisenhof in Eiderstedt ergaben, daß hier vom 8. bis zum 10. Jahrhundert nur vier Kulturpflanzen, vor allem Pferdebohnen angebaut worden waren.46
Schließlich konnte die Bedrohlichkeit der Natur durch radikale Stilisierung gezähmt werden, wie in dieser Buchillumination am Übergang von Romanik zu Gotik (Carmina Burana, Benediktbeuern um 1230, München, Bayerische Staatsbibliothek).
Von den Waldböden wurde die Streu geholt, wurde der Humus auf die bald ausgemergelten Äcker getragen: Plaggendüngung. Laub und Tannengrün bildeten die organischen Stoffe für die Verbesserung der Ackerkrume.47 In diesem Sinne deuten wir auch das „Moos“, das in einer Geschichte des Caesarius von Heisterbach eine Rolle spielt. Um 1220 half ein hoher Kölner Geistlicher den Armen, indem er ihnen das Moos abkaufte, das sie im Wald gesammelt hatten; nicht weil er es gebraucht hätte, sondern weil er sie von der Mühsal des Tragens befreien wollte.48 Der Geistliche erbarmte sich armer Menschen. Aber diese schädigten wie so viele, die um die Düngung ihrer Felder besorgt sein mußten, den Wald. Seinem Boden wurden durch den Plaggenstich unverzichtbare Nährstoffe entzogen.49
Nicht nur Bauern brauchten den Wald, sondern auch die Handwerker des frühen Mittelalters. Gerbrinde von Eichen und manchen Nadelhölzern verwandte die Rotgerberei; abgeschälte Baumrinden lieferten den Bast für die Seilerei. Das Material zum Flechten von Zäunen, Körben, aber auch für das Flechtwerk der Häuserwände wurde in Form der sogenannten Kopfholzwirtschaft gewonnen:50 Die Weiden wurden nicht nur für das Flechtwerk der Häuser und Zäune gebraucht, Weidenruten hielten auch im nagellosen Früh- und Hochmittelalter die Ackergeräte zusammen.51 Wie gelegentlich heute noch „köpfte“ man im Mittelalter alle Arten von Weichholzbäumen, vor allem Erle und Hasel. Die Bäume antworteten darauf mit buschigem Neuausschlag. Nachhaltigkeitsprinzip im kleinen.
Unmöglich ist es, alle Formen der Waldnutzung aufzulisten,52 von dem aus Harz gewonnenen Pech, dem Universalkleber des Mittelalters, bis hin zu den Heilkräutern und Heilpflanzen.53 Die Eiche war dabei ebenso nützlich54 wie der (allerdings keine eigentliche Waldpflanze darstellende) Wacholder (Machandel).55 Selbst die Imkerei war ohne Wald nicht denkbar, sie brauchte Baumhöhlen, die, einen Schlitz für das Ausschwärmen lassend, mit einem Brett verschlossen wurden. Dabei mußten die Bäume entwipfelt oder zumindest stark aufgeästet werden, damit die Sonne das Bienenhaus erwärmen konnte. Jeweils zu Beginn des Frühjahrs wurden die Honigwaben aus den Höhlungen gebrochen. Ohne die Biene aber hätte das Mittelalter weder über Kirchenlichter (wofür man nicht die übliche Beleuchtung mit miefenden Unschlittkerzen oder Kienspänen gebrauchen konnte) noch über Honig verfügt, dem einzigen Süßstoff, bevor im 15. Jahrhundert Zucker von den Kanarischen Inseln eingeführt wurde. Honig ist der Grundstoff des Mets. So gilt für das Frühmittelalter, als es noch wenig Wein gab: ohne Wald kein Rausch.
Ohne Wald kein Rausch, ohne Wald aber auch keine Kultur. Kleine Beispiele für einen großen Zusammenhang: Vor der Erfindung und Verbreitung des Papiers konnte man Notizen oder Entwürfe von Texten nur auf jenen Täfelchen eintragen, auf denen (meist in Gestalt eines Diptychons), in einem Holzrahmen eingefaßt, das mit einem Griffel zu beschreibende Wachs aus der Waldbienenzucht aufgetragen war. In den klösterlichen Skriptorien wußte man, was dem Wald zu verdanken war. Die Tinte wurde aus Eichengalläpfeln hergestellt.56 Vom kleinen zum großen Beispiel dafür, daß es ohne Wald keine Kultur geben konnte. Es reichen die Stichworte Buche – Buchstabe – Buch.
Klöster wurden häufig in Wäldern angelegt, wie die hochmittelalterliche Abbatia Mariae Lacensis am Laacher See in der Eifel.
Wo die Nutzung so vielfältig ist, stellt sich die Frage, was eigentlich Wald ist. So starrend die Urwälder im frühen Mittelalter gewesen sind – einen Wald gab es vor dem 12. Jahrhundert eigentlich gar nicht. Es gab eine Begegnung von Menschen mit Busch und Bäumen, es gab eine Begegnung mit dem herrschaftlich segmentierten Forst, es gab das „Unland“ als Herausforderung, aber es gab keinen eigenständigen Wald im Sinne einer erfahrbaren Landschaftsgestalt. In die Ausläufer der Wildnis, in den Niederwald, reichten noch die Felder hinein. Eine Feld-Wald-Grenze war unbekannt57 (sie sollte erst allmählich mit dem 16. Jahrhundert entstehen). Schließlich waren die Urwälder mit einem weitgeschnittenen „Waldmantel“, mit dem „Vorholz“ umgeben. Eine reichhaltige Strauch- und Kräutervegetation gedieh hier. Immer wieder taucht in Schenkungsurkunden der Begriff „rubeta“ (Brombeergebüsch) auf. Ortsnamen, die auf „-busch“ enden, erinnern noch daran. Durch das Vorholz, das immer mehr durch Weidebetrieb durchlichtet wurde,58 näherte sich der Mensch im frühen Mittelalter dem Wald.
Eingeschlossen in ihren Siedlungskammern konnten die Menschen des frühen Mittelalters den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.59 Sie dachten nicht an Eigentum, sondern an gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten. Der Wald bot ihnen bis hin zum Rausch wichtige Lebensvoraussetzungen, aber er bot ihnen eines nicht: Eigentum.