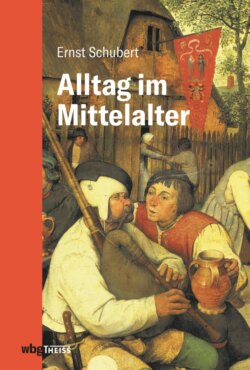Читать книгу Alltag im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rodung: Die Veränderung von Gesellschaft, Wirtschaft und Herrschaft im Hochmittelalter
ОглавлениеWenn Bauern im Umland ihrer Siedlung das Unterholz ausrodeten, wird ihnen bei der schweißtreibenden Arbeit kaum der Gedanke gekommen sein, daß ihre individuelle Arbeit Anfang eines umfassenden Prozesses gewesen ist. Allenthalben wurde seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert in Europa gerodet. Es ging nicht mehr um das Unterholz an den Waldsäumen, es ging um den Wald selbst.60
Rodung – das war mitnichten eine prinzipielle Neuerung des hohen Mittelalters.61 Die Ortsnamen, die auf „-ingerode“ enden (z. B. Wernigerode), bezeugen, daß schon seit dem 9. Jahrhundert die Menschen begannen, die agrarische Nutzfläche auf Kosten des Waldes zu erweitern. Die auf „-ingerode“ auslautenden, noch vor der Jahrtausendwende entstandenen Ortsnamen liegen vielfach als ein Kranz von Kleinsiedlungen um die alten Siedlungskammern. Das Neue des Hochmittelalters ist nicht das Prinzip der Rodung, sondern das Ausmaß, in dem diese betrieben wurde. Das Ausmaß verändert die Struktur des Vorgehens. Die „-ingerode“-Namen waren mit Vornamen gebildet worden, was auf eine personale Verantwortung zurückweist. Es waren die Leute des hochadeligen Wernher, die Bäume für den Siedlungsplatz Wernigerode abholzten. Die Ortsnamen der Rodungssiedlungen des hohen Mittelalters lassen hingegen keine Personennamen mehr erkennen. Die späteren Standesgenossen jenes Werinher, der Wernigerode beherrscht hatte, Hochadelige, wie wir sie jetzt angesichts des neu aufkommenden Standes von Niederadeligen, von „milites“, nennen müssen, Männer also wie Wiprecht von Groitzsch oder Markgraf Diepold III. planten in einem neuen, ganze Landschaften erfassenden Stil,62 als sie anfangs des 12. Jahrhunderts zwischen Mulde und Wiera63 bzw. in der Naab-Wondreb-Senke das Unland zu erschließen befahlen. Um einen einzelnen Siedlungsplatz wie bei Werinher und seinen Leuten ging es nicht mehr. Planung im großen, Planung auch im kleinen. Regelmäßige, auf vorbereitende Vermessung zurückgehende Flurformen charakterisierten die Kolonistendörfer.64
Planender Eingriff in die Umwelt, das im 12. Jahrhundert erstmals in weitem Umfang begegnende Thema der europäischen Geschichte, begegnet in diesem Jahrhundert im großen Stil bei dem Landesausbau und im kleineren Maßstab vor Ort. Welche Grundsätze in den jeweiligen Rodungssiedlungen verfolgt wurden, können wir nicht rekonstruieren; daß aber Expertenrat in Planung und Voraussicht gefragt war, zeigt der Seitenblick auf eine andere Form der Begegnung mit dem Unland, dem versumpften Land. Sielgräben mußten gezogen werden, um hier fruchtbare Böden zu schaffen; dazu brauchte es Erfahrung und Wissen, um die Achterdeiche zur Abdämmung des Wasserzuflusses an der geeigneten Stelle anzulegen, um zum Beispiel an der Unterweser einschätzen zu können, daß die geringe Fließgeschwindigkeit dasWasser aus den Sielgräben nur langsam fortschwemmte. Deshalb gestand der Bremer Erzbischof 1181 zu, daß in dem bezeichnenderweise so genannten Oberneuland diese Gräben („weteringe“) dort gezogen werden sollten, wo es die Geschworenen, die Experten („qui sworen dictuntur“) für richtig hielten.65 Seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts hatten die Bremer Erzbischöfe im großen Stil die Urbarmachung und Besiedlung der Weserniederung geplant. Das Ergebnis blieb genauso wie bei der Rodungsplanung im Erscheinungsbild der neuen Siedlungen sichtbar, war doch hier wie dort Vermessung des Landes Ausdruck der Planung. Die Marschhufendörfer im Bremischen entsprechen mit ihren Parallelstreifenfluren den Waldhufendörfern.
Der Wald konnte gerodet werden, wie hier durch Mönche in einer Initiale einer Handschrift aus der Abtei von Citeaux aus dem 12. Jahrhundert (Bibliothèque Municipale de Dijon).
Die Zeit zwischen dem 11. und dem ausgehenden 13. Jahrhundert ist die Epoche des Landesausbaus. Auf deutschem Boden wurde ein Gebiet von der Größe Englands dem Wald und der Wildnis abgerungen. Die jener Zeit entstammenden Ortsnamen auf „-rode“, „-reuth“ und „-ried“ bezeichnen den Weg, den Rodung und Siedlung nahmen. Endungen auf „-brand“ und „-lohe“, auf „-sang“ und „-schwand“ erinnern noch an besondere Techniken der damaligen Rodung, an das Abbrennen, das Sengen des Holzes66 – meist nur in Tannenwäldern möglich –, an das Abschälen, das Schwenden, der Rinde, das den Baum zum Absterben brachte.
Der Mensch des frühen Mittelalters hatte den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Was er wahrnahm, war Wildnis. Die Landschaftsnamen wie Schwarzwald oder Steigerwald entstehen erst im Zuge der Binnenkolonisation des 12. Jahrhunderts; oder anders formuliert: Der Mensch nimmt den Wald erst wahr, als er sich ihm in großem Stile mit Axt und Brand nähert. Als bis in die engen Täler der Mittelgebirge hinauf die Siedlungsfläche ausgedehnt wurde, wurde auch „Wald“ wahrgenommen, es entstanden die uns vertrauten Namen dieser Gebirge mit ihrer bezeichnenden Endung: Odenwald, Steigerwald, Bayerischer Wald usw.
Nur bedingt sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der modernen Kognitionspsychologie für die Mediävistik zu nutzen. So wichtig die Erkenntnis ist, daß menschliche Erfahrung keineswegs über die Segmentierung der Sinne zusammengesetzt werden kann, sondern aus einem höchst subtilen Zusammenspiel von Hören, Sehen, Fühlen und Riechen beruht, so fehlt dem heutigen, sich als Teil einer sogenannten Informationsgesellschaft verstehenden Zeitgenossen die von dem Körperbewußtsein ausgehende „Kognition“ des Mittelalters. Vereinfacht: Welche psychischen Wirkungen löst der nach einem Unwetter dampfende, schweigende Wald in dem Menschen aus, der sich mit kleiner Axt der mächtigen Buche nähert?
Das starke Bevölkerungswachstum67 zwang neue Ackerflächen zu gewinnen, zwang zur Rodung. Rodung: Das ist leichter geschrieben als getan.68 Licht war in die Wildnis zu bringen, die ineinander verwachsenen Bäume mußten zunächst mühsam entästet und entwipfelt werden, und dann begann nach dem Fällen das Schwierigste, das Ausroden der Baumstümpfe mit ihrem weitverzweigten Wurzelwerk. Meist wurde noch jahrelang um stehengebliebene Baumstümpfe herum der Acker bestellt. Nur mit dem Haken, nicht mit dem schwerfälligen, ungefügen Pflug konnte der Boden bearbeitet, konnte er lediglich aufgeritzt werden. Der anspruchslose Hafer ist fast stets das erste angebaute Getreide. Es war schon viel, wenn auf solchen Böden das Dreifache der Aussaat geerntet werden konnte. Mit immer neuem Stockausschlag rächte sich der Wald. Eiserne Spaten gab es noch nicht – übrigens ist Spaten kein gemeingermanisches Wort. Grabscheite wurden benutzt, die aus festem Holz herausgespalten waren. Ein großer Fortschritt war es bereits, wenn dieser hölzerne Spaten an seinem Ende einen eisernen „Schuh“ hatte.69 Dem Bau der Pyramiden ist die Leistung der Menschen vergleichbar, die in generationenlanger Arbeit schließlich Felder schufen, die in nichts mehr an die einstige Bewaldung erinnern. Und Rodung hieß im hohen Mittelalter vielfach gar nicht Waldvernichtung, sondern Waldverlichtung mit Wald-Feld-Wechselwirtschaft.70 Auch nach der großen Rodungsphase blieb die Waldnutzung integraler Bestandteil der bäuerlichen Ökonomie, was erst seit dem 19. Jahrhundert durch die Wissenschaft, welche eine strikte Trennung von Land- und Forstwirtschaft behauptete, in Vergessenheit geriet.
Rodung ist nicht nur wegen der schweren körperlichen Arbeit, ist nicht nur wegen der Not der ersten Siedler leichter beschrieben als getan, Rodung weckte auch lange verschwiegene Gegensätze, führte zwischen Nutzung des Waldes und Jagdinteressen zum Konflikt. Drama (und Film) haben dazu geführt, daß sich der Mensch der Gegenwart Konflikte nur in personaler Gestalt vorstellen kann; was wir hingegen in seiner Dramatik anzudeuten versuchen, ist etwas, was sich nicht in vier Akte (oder in 90 Minuten) pressen läßt, ist in seiner prinzipiellen Gegensätzlichkeit zwar ein dramatisches, in seinen Verlaufsformen hingegen episches Szenario. Selbst in spröder Urkundensprache ist die Schärfe dieser Auseinandersetzung in dem „Brief“ des thüringischen Landgrafen Ludwig (1140 – 1172) über die „silvatici exstirpatores“, über die Kolonisten spürbar. Fürstenwut. Der Landgraf drohte dem Führer eines Rodungstrupps („silvanorum exstirpatorum preposito“), er solle schnellstens die Wälder verlassen, sonst werde er, der Fürst, kommen „und alles, was Euch gehört, mit Feuer und Plünderung und Lebensgefahr für Euch verwüsten lassen“.71
Jagd von Wild spielte eine große Rolle (aus: Henri de Ferrières, Le roy Modus et la royne Ratio, 1379).
Der Brief des Thüringer Landgrafen weist bereits auf ein Konfliktfeld hin, welches breiten Raum in der jahrhundertelangen Auseinandersetzung zwischen Adel und Bauern einnahm. Die Jagd der Herren zog hohe Wildschäden auf den Feldern nach sich. Das Wild, das die Äcker zertrat oder durchwühlte, sollte jedoch in hohen Beständen erhalten bleiben, um adeligem „Sport“ zu dienen. Ein Thema des Bauernkrieges,72 ein Thema auch unzähliger Beschwerdeschriften von Gemeinden in der frühen Neuzeit.73 Der Thüringer Landgraf aber hatte keineswegs allein an die Jagd gedacht. Sein Brief wirft ein Schlaglicht auf die im 12. Jahrhundert dem Adel bewußt werdenden ökonomischen Chancen: Die wirtschaftliche Nutzung im Interesse der Herrschaft wurde wesentlichster Inhalt des auf dem Wildbann aufbauenden Forstrechts. Im Forst mußte durchgesetzt werden, was der älteren Waldnutzung noch fremd gewesen war: Eigentum. Ein Sprichwort deutet den nunmehr entstehenden Konfliktbereich an: „Die Furcht hütet den Forst.“74
Die Welt hatte sich verändert, nachdem die Erde vielerorts ihres Waldkleides beraubt worden war. Um 1300 fiel einem Dominikaner in Colmar diese Veränderung auf, als er das Elsaß beschrieb, wie es vor hundert Jahren bestanden habe: „Es gab damals im Elsaß viele Wälder, welche das Land unfruchtbar machten.“ Der Mönch sah bereits Folgen der Rodung: „Gießbäche und Flüsse waren damals nicht so groß wie jetzt, weil die Wurzeln der Bäume die Feuchtigkeit von Schnee und Regen längere Zeit in den Bergen zurückhielten.“75 Die nackte Nachricht sollte nicht verkennen lassen, durch wen die Wahrnehmung des Dominikaners geschult war, durch seinen Ordensbruder Albertus Magnus. Die moderne Wissenschaft bestätigt mit anderen Methoden die Veränderung der Welt um 1300. Im Norddeutschen Tiefland sind bis zu 60 Meter hohe, offene Sanddünen, wie sie heute nur noch auf den Friesischen Inseln bekannt sind, als Indikatoren der Waldvernichtung vielfach bezeugt.76
Während tapfere Kriegstaten von Rittern Lob und Preis in der Geschichtsschreibung gefunden haben, ist die schwere Kulturarbeit rodender Menschen kaum beachtet worden. Diese Arbeit aber war viel folgenreicher als alle mittelalterlichen Fehden zusammen. Die Rodungsphase des 12. und 13. Jahrhunderts, als Landesausbau ein gesamteuropäischer Vorgang,77 war viel geschichtsmächtiger als der institutionelle Ausbau des Papsttums, als der staufisch-welfische Gegensatz;
Im Wald fanden die Schweine Futter, wie in dieser Darstellung des Julius-Kalenders und Chorbuches aus dem frühen 11. Jahrhundert (London, British Library). denn Rodung bedeutete mehr als nur eine quantitative Vergrößerung der kultivierten Fläche. Zutiefst veränderte der Landesausbau die Bedingungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Herrschaft.
Sauhatz. Wandmalerei des 16. Jh. (Schloßmuseum Büdingen).
Versucht sei, mit wenigen Strichen diesen Wandlungsvorgang anzudeuten.
Gesellschaft ist genau besehen für das Mittelalter ein anachronistischer Begriff. Erst über das entbehrungsreiche Roden entstand eine Vorform dessen, was seit dem frühen 16. Jahrhundert als „Gesellschaft“ bezeichnet werden könnte.78 Im Verlauf der hochmittelalterlichen Rodungsphase, des Landesausbaus, wurde über die frühmittelalterlichen Siedlungsinseln ein Verbindungsnetz der Straßen und Wege gespannt. Und innerhalb der früheren Siedlungsinseln entstand das, was – vereinfacht – die „Verdorfung“ des hohen Mittelalters genannt worden ist; der Komplementärvorgang zum Anwachsen der Städte. Vorform von „Gesellschaft“: Aus Siedlungskammern wurden im Zuge des Landesausbaus Siedlungsräume. Ein differenziertes Wegenetz entstand. Menschen lernten über den engen Kreis ihrer angestammten Siedlung hinaus in überlokalen Beziehungen zu denken. Damit gerieten Herrschaftsformen, die sich in eng umgrenzten Siedlungskammern hatten durchsetzen lassen, in Gefahr; die Landflucht wird seit der Rodungszeit ein alle Herren beunruhigendes Problem.79 Den neuen Bedingungen mußte die hergebrachte Grundherrschaft angepaßt werden. „Auflösung der Villikationsverfassung“ nennen Historiker diesen Prozeß: Aus Hörigen, die für einen Fronhof arbeiten, werden Bauern, die Abgaben leisten, die mit Absatzmärkten wirtschaften lernen, der Ware-Geld-Beziehung und nicht nur den Befehlen eines Herren folgen.
Verdorfung und Entstehen einer Vorform der Gesellschaft aus den Bedingungen der Waldnutzung: Der Wald entschied letztlich darüber, wieviel Vieh in den Siedlungen gehalten werden konnte.80 Und das bedeutete: Die Menschen mußten Regelungen finden, wie sie gemeinsam diese Weide nutzen konnten, wie viele Tiere ein jeder halten durfte, zu welchen Zeiten im Herbst die Schweinemast beginnen und enden sollte. Für die genossenschaftlichen Formen des bäuerlichen Lebens, die dann zur Entwicklung der Dorfverfassung im hohen Mittelalter führen sollten, bildete die Organisation der Waldweide einen nicht geringeren Anstoß als die gemeinsame Regelung bei der Feldbestellung. So richteten sich im Niedersächsischen Ort und Zeit der „Holtinge“, der genossenschaftlichen Versammlungen zur Vereinbarung über die Waldnutzung, nach der Eichelernte, da sie über den Eintrieb zur Mast entschied.81 Verkürzt oder verlängert wurde die in etwa zwischen Michaelis (29. September) und Mariä Lichtmeß (2. Februar) liegende Zeit der Waldweide je nach dem Ertrag der Bäume.82 Gemeinsam mußten die Gemeindegenossen darauf achten, daß allen Schweinen ein Ring durch die Nase gezogen wurde, um das Wühlen im kostbaren Waldboden zu verhindern.83 Die selbstverwaltete Gemeinde als Ausdruck von Gesellschaft: Wie wichtig dabei der Wald ist, erweist sich während des Bauernkrieges 1525. Zentrale Forderungen der Aufständischen kreisen um Holzrechte und Waldweide,84 um die Allmende also, die allen Gemeindegenossen zur Verfügung stehen sollte.
Wildschweinjagd (aus: Gaston Phébus, Le Livre de la chasse, Paris, Bibliothèque Nationale).
Die Holtinge im Norden und die Weistümer im Süden gehen von der genossenschaftlichen Verantwortung, von der Gemeinde bei der Nutzung des Waldes aus,85 berufen sich auf regelmäßig abzuhaltende Holzgerichte,86 in denen auch über die Ansprüche der Herrschaft verhandelt wurde.87 Immer wieder begegnet in diesen bäuerlichen Rechtsaufzeichnungen eine Pflicht des Menschen nach beendeter Arbeit. Er soll dem Wald danken. Diese Pflicht hat selbst der Lüneburger Herzog. Wenn er seine Rechte im Truwald wahrnehmen möchte, soll er zunächst einen Kranz flechten; wenn er dann aus dem Wald herausreitet, „schal er den kranz wedde in den wolde werpen und dancken den wold“.88
Waldnutzung, Herrschaft und Genossenschaft bildeten ein Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten, ein Geflecht, das von Fall zu Fall verschieden ausgestaltet war, aber bei allen Unterschieden gemeinsame Prinzipien erkennen läßt. Sie seien am Beispiel der Rechte der Bienenzüchter, der Zeidler, im Nürnberger Reichswald, die 1350 aufgezeichnet wurden,89 dargestellt. Die Zeidler, in anderen deutschen Landen auch Bütener oder Beutner genannt, lebten im Walde, begütert mit einer Zeidelhube. Sie unterstanden einem Zeidelmeister, der wie der Bauermeister im Dorf gewählt bzw., wie die Urkunde von 1350 besagt, „mit der Zeidler rath und nach ihrem Willen“ eingesetzt wurde. Wie die Bauern ihr Dorfgericht hegten auch sie ihr eigenes Zeidelgericht, das in den Nürnberger Reichswäldern bis 1779 Bestand hatte. Ihrer Herrschaft waren die Zeidler zur „Reis“ verpflichtet, zur Kriegsfolge und zu Abgaben; alljährlich war das „Honiggeld“ fällig. Das auf die alleinige Gebotsgewalt zielende, Schritt für Schritt erfolgende Vorgehen des Nürnberger Rats spiegelt sich in Ordnungen, wie unter möglichster Schonung des Waldes die Waldbienenzucht betrieben werden sollte.
Der Wald als Thema der Gesellschafts-, Wirtschafts- und Herrschaftsgeschichte. Zum ersten Thema haben wir viele Erklärungen benötigt; beim zweiten können wir uns kürzer fassen. Wirtschaft: Da wir noch eigens darauf eingehen müssen, welche Bedeutung der Wald für Handel und Gewerbe im Spätmittelalter hatte, sei der Wandlungsvorgang auf andere Weise beschrieben. Der Met, für den die Waldbienenzucht unverzichtbar war, blieb nur noch bis ins 13. Jahrhundert hinein ein Volksnahrungsmittel. Im 14. Jahrhundert wurde er – mit Ausnahme des Baltikums – vom Bier verdrängt, das haltbarer und damit exportfähiger war. Vor allem aber stieg mit der Verringerung der Waldfläche der Preis des Honigs; diesen brauchte man vor allem als – teures – Süßmittel, das, Grundlage des Lebküchner-Handwerks, nach wie vor durch Waldbienenzucht gewonnen wird.90 Für ein Massengetränk war der Met zu teuer geworden; er taugte wegen seiner geringen Haltbarkeit auch nicht zum Luxusgetränk. (Denn schon damals galt: Luxus muß von weither kommen. Der Met war aber nicht über längere Strecken transportierbar.)
Herrschaft: In der Rodungsphase entschied Waldbesitz und nicht etwa Fehde oder Politik über das Schicksal großer Grundherrschaften. Gleichermaßen reich waren zum Beispiel in karolingischer Zeit die Abteien Reichenau und Fulda beschenkt worden. Von Ulm bis an den Comer See reichte der weit verstreute Besitz des Inselklosters am Bodensee, von den Alpen bis Friesland jener der Abtei des hl. Bonifatius: typische Beispiele der frühmittelalterlichen Grundherrschaft. Mit der Auflösung der Villikationsverfassung, mit der Entwicklung zur hochmittelalterlichen, „jüngeren“ Grundherrschaft, schwand die Bedeutung der weit auseinandergezogenen Besitzungen, die einst auch darin gelegen hatte, Mißernten in einer Region durch Erträge aus anderen Gebieten ausgleichen zu können. Die Zukunft sollte der konzentrierten Herrschaft gehören. Die Reichenau zählte zu den Verlierern dieses Prozesses. Ihre Besitzungen konnten sich nirgends zur geschlossenen Landesherrschaft verdichten. Der Abtei Fulda aber gelang der Ausbau eines eigenen Fürstentums. Rückhalt dafür war – was den Mönchen am Bodensee fehlte – ein großer Waldbesitz, die Buchonia.91
Der Landesausbau und die Veränderung von Herrschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bilden ein gesamteuropäisches Thema. Als eine indirekte Zusammenfassung bietet sich etwa der Seitenblick auf Portugal an.92 Hier war mit der Einführung des Weinbaus im 12. Jahrhundert das Landschaftsbild durch die unzähligen Terrassen an den Berghängen verändert worden. Zugleich setzt eine große Waldrodung mit einer Verdichtung des Siedlungsnetzes ein. Die Veränderung des Landes ist geradezu personifiziert in der Herrschaft des Königs Dinis (1279–1325), dem der Beiname „der Landwirt“ gegeben wurde. Die Trockenlegung von Sümpfen, die Urbarmachung des Unlandes galt ihm als Herrschaftsaufgabe; aber es war nicht die einzige, die er sich stellte. „Der Landwirt“ war der erste portugiesische König, der lesen und schreiben konnte. 1290 gründete er die Universität Lissabon.
Herrschaftsstrukturen bildeten sich unter dem Eindruck der Rodungsphase aus, die ja nicht nur eine Phase der Waldverlichtung und Waldvernichtung, sondern auch eine Phase der Intensivierung der Waldnutzung war. Erst letztere ließ offenbar werden: Mit den umfangreichen Forstvergabungen an weltliche und geistliche Große hatte sich das Königtum des 10. und 11. Jahrhunderts in deutschen Landen einer Machtgrundlage beraubt, die seine Zukunft im Hochmittelalter ganz anders hätte gestalten können. In England dagegen hatte eine straffe Forstpolitik wirksame Herrschaftsgrundlagen für die Zentralgewalt geschaffen. Lange hatte der hohe Adel – vergeblich – gegen die königlichen Einforstungen gekämpft. Die Magna Charta von 1215 ist nicht ein Markstein auf dem Wege zum englischen Parlamentarismus, sondern zunächst ein Kompromiß im Kampf zwischen Königtum und Adel um den Wald.93 Lediglich als Forstgesetz wurde sie im 14. und 15. Jahrhundert herangezogen; daß Robin Hood in den grünen Forsten von Nottingham zum Mythos werden konnte, spiegelt die Wirkungsgeschichte der Magna Charta wider, jene Wirkungsgeschichte, die erst unter den Stuarts auf andere Wege gelenkt wurde, als unter vielen Bestimmungen der Paragraph 61 entdeckt wurde, der, 1215 eher beiläufig ein Einspruchsrecht gegen königliche Verfügungen fixierend, nunmehr als Begründung eines Widerstandsrechts gegen die monarchische Gewalt tauglich war.
In Frankreich hatte die königliche Herrschaft über die Kronwälder 1376 zu einer vorbildlichen Regelung geführt. Die Juliordonnanz Karls V. (des Weisen) bildet den „Gipfel mittelalterlicher Forstgesetzgebung“,94 die von der Selbstverjüngung des Waldes ausgeht. Auf den Schlägen bleiben immer Überhalter stehen, aus deren Samen die neuen Schößlinge treiben. Auch wenn damals in den Kronwäldern die Mittelwaldwirtschaft entsteht, so ist man doch weit entfernt vom Försterwald mit seiner am Ertrag orientierten Nutzung.
Als im frühen 19. Jahrhundert der englische Parlamentarismus als Alternative zum altdeutschen Ständestaat Thema politischer Debatten wurde,95 war – mit bis heute nachwirkenden Folgen – vergessen worden, daß die Geschichte des Königtums in deutschen Landen sich im Vergleich zu der in England wegen der mittelalterlichen Prädisposition anders entwickeln mußte. Und die Hauptrolle spielt dabei Robin Hoods Rückzugsgebiet, der Wald. Zur Zeit, als Wilhelm der Eroberer in England landete (1066) und nach normannischer Tradition die Forstpolitik als wichtigste Grundlage seiner Herrschaft handhabte, hatte in Deutschland das Königtum den Kampf um den Wald bereits verloren. Die Mehrzahl der Forsten war in kirchlicher oder hochadeliger Hand. Das sollte entscheidend werden. Was als Wildnis vergeben worden war, erwies sich im Verlauf von Rodung und Landesausbau seit dem 12. Jahrhundert von unschätzbarem Wert. Wer den Wald besaß, entschied über die Zukunft, besaß den Schlüssel zur wirtschaftlichen Macht.
Scheinbar sind wir weit von unserem Gegenstand abgewichen, sind bei verfassungsgeschichtlichen Grundsatzfragen gelandet. Das aber liegt nicht an mangelnder argumentativer Disziplin, sondern an dem Gegenstand. Im Umgang mit dem Wald veränderten die Menschen ihre Geschichte vom frühen Mittelalter mit seinen Wildbäumen zum hohen Mittelalter mit seiner Rodungsphase und Forsthoheit. Und auch im Spätmittelalter sollte sich diese Geschichte noch einmal tiefgreifend verändern. Arme Leute wählen wir, um eine Vorstellung von dieser Veränderung zu gewinnen.
Folgen der Rodung: Als Individuen werden Bäume wahrgenommen, nachdem die Urwald-Gesellschaft ausgeholzt worden ist (Wolfgang Huber, Gebirgslandschaft mit großem Baum, 1515).