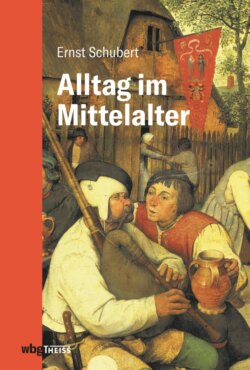Читать книгу Alltag im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Das Klima und die Sorge um frische Luft
ОглавлениеUnter allen Umweltfaktoren ist das Wetter dasjenige, das der Mensch am wenigsten beeinflussen kann. Die Faszination der Wetterkarte ist nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, daß der planende Mensch der Neuzeit eine Ohnmachtserfahrung kompensiert: das nicht planbare Schicksal.
Paläoklimatische Daten aus der jüngsten geologischen Vergangenheit belegen, nach Jörn Thiede, daß in dem vom Menschen noch nicht gestörten Ökosystem Erde innerhalb weniger Jahre schnelle klimatische Wechsel eintreten konnten, welche die langfristigen zyklischen Klimaänderungen modulierten. Die schnelle Erwärmung des Erdklimas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts läßt sich aber, so Lennart Bengtsson, nicht mehr mit natürlichen Klimaschwankungen erklären. Die 1990er Jahre waren die wärmsten des abgelaufenen Jahrhunderts, was vermutlich, aber selbst mit Modellrechnungen noch nicht mit Sicherheit beweisbar, auf den Treibhauseffekt zurückgeht.1
Das mit wissenschaftlichen Methoden kurzfristig vorhersehbare Wetter ist Teil des Klimas, von dem heutzutage befürchtet wird, daß es der Mensch durch die verstärkte Freisetzung unter anderem von Kohlendioxid und Methan beeinflußt habe. Dann wäre eine globale historische Entwicklung in Gang gesetzt, die in früheren Zeiten allenfalls in ihrer regionalen Historizität erfaßbar gewesen ist. Denn zu den Anfängen der modernen historischen Methodik gehört das Aufgreifen antiker Theorien durch Jean Bodin, der 1566 die Unterschiede von Schicksal und Charakter der Völker aus dem jeweiligen Klima herleitete.2
Klima als unbeeinflußbares Schicksal. Einige Grundtatsachen: Es gab eine von 500 bis 1200 reichende frühmittelalterliche Wärmezeit, deren Optimum etwa um das Jahr 1000 erreicht war.3 In dieser Epoche lag die Temperatur im Jahresdurchschnitt etwa 1 ° Celsius über der von 1900. Was zunächst als unerheblich erscheinen mag, hat schwerwiegende Folgen, die durch Impressionen verdeutlicht seien: Die ersten Siedler Islands haben 874 wesentlich geringere Gletscherareale angetroffen als wir sie heute kennen. Grönland war damals noch das grüne Land und kein eiswüstes „Unland“. Die Wikingerfahrten nach Vinland um 1000 fallen mit dem Klimaoptimum zusammen. Im 8. und 9. Jahrhundert wachsen in England Ölbäume.4 Auch um nur 1 ° Celsius höhere Temperaturen im Jahresdurchschnitt verlängern die Sommer und vermehren damit agrarische Nutzungsmöglichkeiten; kürzere Winter bewirken mit häufigeren Niederschlägen größere Fruchtbarkeit. Ein Beispiel für die Folgen nur scheinbar geringfügiger langfristiger Klimaveränderungen: Das heutige Wüstengebiet östlich des antiken Antiochia erlebte im 5. und 6. Jahrhundert zahlreiche Stadtgründungen inmitten einer blühenden Agrikultur.5
Die Erforschung der Klimageschichte wurde 1966 auf neue Grundlagen gestellt. Das im Gletschereis geborgene Klimaarchiv der Erde wurde geöffnet.6 Vergleichbar den Wachstumsringen des Baumes enthält auch ein Eisberg Informationen über die zwischen Tauwetter und erneuter Vereisung liegenden individuellen klimatischen Bedingungen eines Jahres. Es gelang einem amerikanischen Forscherteam, bei Camp Century in Grönland aus der senkrecht durchbohrten Eisdecke einen Bohrkern zu entnehmen, der mit einem Durchmesser von 12 cm 1390 m lang war und damit tief in die Geschichte hineinreichte.7 Die Altersbestimmung der einzelnen Schichten des Eiskerns wurde über das Sauerstoffisotop O 18 vorgenommen, das in mehr oder weniger großen Mengen im Gletschereis vorkommt. Dieses Isotop bildet den entscheidenden Indikator für die Klimaschwankungen, weil seine Konzentration hauptsächlich von der Kondensationstemperatur der jeweiligen Niederschläge abhängt. Ein Abnehmen der Temperatur bewirkt eine abnehmende O-18-Konzentration.
Natürlich kann der O-18-Gehalt im Bohrkern der Höhle von Camp Century nur das globale Makroklima, nicht aber das jeweilige regionale Mikroklima anzeigen. Daran können auch die seit 1966 immer mehr verfeinerten, in immer tiefere Zeiten der Erdgeschichte vordringenden Verfahren der Glaziologie nichts ändern. Sie liefern jedoch harte Fakten. Das Makroklima sinkt von durchschnittlich 12,1 ° Celsius im Jahre 1000 auf 11,5 ° im Jahre 1150 und auf 11 ° um 1450, um dann (nach Überwindung der kleinen Eiszeit der frühen Neuzeit) auf 11,7 ° im Jahre 1940 anzusteigen. Eine Wärmezeit wie die des frühen und hohen Mittelalters hat aber nicht nur Vorteile. Beim Wasserhaushalt zeigt sich: Stagnierende seichte Gewässer bilden Brutstätten für Insekten, die gefährliche Krankheitserreger auf den Menschen übertragen können. Unter ökologischen Gesichtspunkten gelesen sind Heiligenviten eine aufschlußreiche Lektüre, die etwa belegen, daß die Malaria im Inneren Frankreichs8 und noch im Deutschland des 12. Jahrhunderts die Menschen heimsuchte.9
Klima, ungesunde Sümpfe, Politik: Otto II. erlag 983 der Infektion durch Malaria und Ruhr. Als die Nachricht Deutschland erreichte, erhob sich ein großer Aufstand der Slawen. Die Katastrophe Friedrich I. 1167 vor Rom, als eine Ruhr- und Malariaepidemie sein Heer dezimierte, war vor allem deshalb von großer Folgewirkung, weil zahlreiche Hochadelssöhne der Krankheit erlagen – so starb die schwäbische Linie der Welfen aus –, was die politische Szene in deutschen Landen zutiefst veränderte.
Ab 1300 wird es kälter in Europa.10 Es bahnte sich die sogenannte kleine Eiszeit an, wie man das Absinken der durchschnittlichen Jahrestemperaturen zwischen 1550 und 1850 übertreibend genannt hat. 1303 und 1306 fror die Ostsee in ihrem südlichen Teil zu.11 In jener Zeit brach die normannische Besiedlung auf Grönland zusammen. Das kältere Klima wirkte sich von Nord bis Süd in den deutschen Landen aus, beeinträchtigte den Weizenbau im Norden und erzwang in den Höhenlagen der Alpenregionen die Aufgabe von Siedlungen.
Aus den wechselnden Daten des Beginns der Weinlese gelang es Christian Pfister, die Klimaverschlechterung des Spätmittelalters, die kälteren Spätsommer seit 1340 nachzuweisen.12 1347 erlitten die Menschen den kältesten Sommer seit 700 Jahren13 – und das inmitten einer Kette von Unglücksjahren.14 1365 und 1435 herrschten so kalte Winter, daß man unterhalb Kölns über den vereisten Rhein gehen konnte.15 Besonders schneereiche Kälteperioden bildeten die Jahrzehnte zwischen 1475 und 1497.16
Die nüchternen Zahlen der Klimageschichte abstrahieren alltägliche Nöte. Winterkälte ist für die Menschen mehr als Zähneklappern in dünnwandigen Häusern, wo bestenfalls nur ein Raum beheizbar ist. Frost und Schnee sind, Klima als Drama, drastische Einschnitte in die Lebensbedingungen. Verständlich wird der Stoßseufzer: „Mohte ich verslâfen des winters zît“.17 Verflucht wird diese Zeit, welche die Natur ihrer Schönheit, ihres Trostes für die Menschen beraubt. „Veiger winter“,18 „wê dir winter ungehiure … heide und ouwe ist bluomen bar“.19 Mit Schaudern erinnert sich Walther von der Vogelweide an die Zeiten, in denen er als Fahrender den „Hornung“ an den Zehen spürte.20
Privilegiert ist der Dichter, der mit Schilderungen der Kälte lediglich den Verlust des Erbarmens beklagt, das die Natur der geschundenen, der trauernden Seele bot. Mehr ist zu befürchten. Man vermied es nach Möglichkeit, im Winter zu reisen.21 Hunderte von chronikalischen Notizen, von denen nur einige ausgewählt seien, lassen die Gründe erkennen.22 Was zunächst als lapidare annalistische Nachricht erscheint, wurde von den Zeitgenossen mit Erschrecken wahrgenommen: Am 16. Januar 1294 herrschte im Elsaß so große Kälte, „daß um Hagenau die Weinstöcke erfroren, die Linden sich spalteten, im Wasser die Fische, im Wald Vögel und Menschen umkamen.“23 Strenge Winter sind für die meisten Menschen eine existentielle Gefahr. Wenn sogar Hirsche in den Wäldern erfrieren mußten,24 war auch der kleine Mann auf einsamer Straße vom Tod durch die Kälte bedroht.25 Zum Beispiel fiel im Winter des Jahres 1392 so viel Schnee, daß Reisende auf den Straßen umkamen und erst im Tauwetter aufgefunden wurden.26 Wer im harten Winter 1442/43 von der Straße abkam, war im tiefen Schnee verloren.27 Die Gefahr war den Menschen bewußt. Deswegen kann im ausgehenden 15. Jahrhundert Sigmund Meisterlin die ihm überlieferte Nachricht, wonach bei einem königlichen Hochzeitsfest in Nürnberg 1215 viele Menschen umgekommen seien, nur so deuten: „do was soliche große scharpfe keltin, dass große schar der menschen erfruren.“28 Tatsächlich aber waren die Menschen gestorben, als der Festsaal durch das große Gedränge eingestürzt war.
Der Mensch des Mittelalters war uneingeschränkt abhängig von den Jahreszeiten: Die Arbeiten der 12 Monate (Karolingische Buchmalerei, 9. Jh., Wien, Österreichische Nationalbibliothek).
Es mögen nur einzelne gewesen sein, die zum Erschrecken ihrer Mitmenschen erfroren sind; sie zollten aber in extremer Weise dem Schicksal der Witterung Tribut, das alle Menschen gefährdete. Die häufigen rheumatischen Krankheiten gingen auch darauf zurück, daß Haus und Kleidung wenig Schutz gegen grimmigen Frost boten.29 Die sich erst später herausstellenden gesundheitlichen Folgen waren dem Menschen wohl weniger bewußt als diejenigen, die er unmittelbar erfuhr. Das Hungerjahr 1226, in dem die Barmherzigkeit der hl. Elisabeth in den Viten hervorgehoben wird, nahm von einem ungewöhnlich langen Winter seinen Ausgang, der ein Viehsterben zur Folge hatte.30 Zu kalte Winter beschworen die Gefahr der „Auswinterung“ der Saaten herauf. Und wenn ein Nürnberger Chronist zum Jahre 1440 bemerkt, „do was ein heftiger langer winter, der wert untz viertzehen tag nach Ostern hinaus“,31 so wußte jeder damalige Leser, was das bedeutete: erstens die Gefahr, daß die Frühjahrssaat, die bis zum 23.4., allerspätestens aber bis Walburgis (1.5.) in den Boden gebracht werden mußte, in dem durchfrosteten Erdreich nicht anging oder durch Frühjahrsfröste die Wintersaat verdarb,32 zweitens daß das Vieh noch nicht auf die Weide getrieben werden konnte, obwohl das Futter in den Ställen längst ausgegangen war („man mußte die schaf abstechen von hungers wegen“),33 und drittens, daß Arbeiter und Tagelöhner in Stadt und Land keine Arbeit bekamen. Der Nürnberger Chronist begnügte sich mit der klimatischen Notiz, sein Zeitgenosse, der Erfurter Hartung Cammermeister erklärte seine Nachricht vom kalten Winter des Jahres 1435: „Davon stund armen luten groz kummer unde jammer uff …, das sie nicht zu arbeit konden komen.“34 Hinter der scheinbar nüchternen Notiz des Nürnberger Chronisten steckt tiefe Sorge. 1440 war die Hungersnot des Jahres 1438 noch in frischer Erinnerung; jedermann wußte, daß die Ursache dieser Not in den harten Wintern lag, die in den zurückliegenden Jahren aufeinander gefolgt waren.35
Ein verregneter Sommer konnte die ganze Ernte vernichten (Petrarcameister, Von Wartung besserer Zeit, 1532).
Witterung und Arbeit:36 Schneefälle konnten von einem Ausmaß sein, daß bis in den März hinein die Waldarbeit unmöglich war.37 Oder: Kälte und Eisgang legten den Betrieb der Mühlen lahm – ein Problem, mit dem sich die Speyerer Domherren im Winter des Jahres 1500 herumschlagen mußten.38 Winterkälte behinderte selbst das Kriegshandwerk wie im Jahre 1388. Viele Pferde der Nürnberger Truppen erfrieren. Die Mannschaften beginnen zu meutern.39 Von den speziellen zu den grundsätzlichen Folgen langer Frostperioden. Vor Hunger brüllendes Vieh in den Ställen,40 stille Verzweiflung bei den Tagelöhnern: Vor diesem Hintergrund gewinnen zahlreiche Nachrichten der städtischen Chronistik über langdauernde Winterkälte kantige Konturen. Ein Beispiel zur Beleuchtung politischen Agierens innerhalb des gefährdeten Alltags: Weil man normalerweise im Winter nicht bauen konnte, hebt der Nürnberger Chronist besonders hervor, daß die Nürnberger ihren Stadtturm, den Luginslant, 1377 im Winter errichten mußten. Man war gezwungen, den Mörtel mit teurem Salz anzurühren. Der Grund für die Eile, welche den Nürnberger Rat keine Kosten scheuen ließ, lag in dem politischen Zweck des Turmbaus, Einblick in die Vorgänge auf der burggräflichen Burg zu gewinnen, „das man darauf ins marggrafen purk moecht gesehen“.41 Nicht nur Akten spiegeln die spannungsgeladene Situation wider, sondern, vielleicht eindrücklicher, auch der mit Salz angerührte Mörtel.
Ein guter Sommer konnte reiche Vorräte für den Winter bedeuten (Pieter Bruegel d. Ä., Die Kornernte, 1565).
Selbst für die höheren Stände, die nicht wegen der Kälte um ihre Arbeitsmöglichkeiten fürchten mußten, waren harte Winter eine Plage. Eine Urkunde für das reiche österreichische Kloster Lilienfeld erinnert daran. Den Mönchen wird die Einrichtung eines Winterrefektoriums gestattet, weil immer wieder Speisen und Getränke eingefroren waren.42
Noch größere Gefahren als strenge Winter beschworen kalte und verregnete Sommer herauf.43 Die Jahre 1314/15 brachten derart hohe Niederschläge, daß allenthalben die Ernten vernichtet wurden. Die europaweite Hungerkatastrophe, die sich in vielen Regionen bis 1318 erstreckte,44 hat die Geschichte genauso stark verändert wie die viel bekanntere Pest der Jahre 1347–1349.45 Die größte Erntekatastrophe des Spätmittelalters darf in ihrer Singularität nicht verkennen lassen, was alljährlich die Menschen mit Sorge erfüllen mußte. Verregnete Sommer:46 Die Erträge der Weinberge verminderten sich dramatisch, eine wirtschaftliche Katastrophe für ganze Regionen,47 und oft genug wußten die Menschen schon Monate zuvor von kommenden Nöten, von Teuerung oder gar Hungerszeit, wenn in naßkalten Sommermonaten die Ernte verdarb. (Erst der Regelungsbedarf des frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaates bündelt wohlmeinend und selbstgefällig Furcht und Freude: Erntedankfest.)
Die Jahreszeiten in einer französischen Buchmalerei um 1460 (aus: Petrus de Crescentiis, Le Rusticana, Chantilly, Musée Condé).
Nicht die Behauptungen einzelner Theologen über Hölle und Fegefeuer lehrten die Menschen existentielle Furcht, sondern die vom Himmel herabschwebende Witterung. Die klimatischen Unglücksjahre mit ihren von Verzweiflung durchsetzten Hungerzeiten waren in der Erinnerung gegenwärtig, wenn sich der Blick besorgt gen Himmel richtete. Zu fürchten waren nicht allein dramatische Katastrophen, zu fürchten waren selbst unspektakuläre Wetterschwankungen. Sogar am Wiener Hof wuchs im Sommer 1444 die Sorge, daß die Dürre eine große Teuerung zur Folge haben könnte.48 In der Welt des Mittelalters mußte ökonomische Planung für den gemeinen Mann ein unverständlicher Begriff bleiben. Zu planen war allenfalls die Arbeit – der Hintergrund so mancher Bauernregel angesichts der Launen der Natur: „An Jerry und Marx / gschieht manch Args.“49 Dieses elsässische Sprichwort ist gleichermaßen Warnung und Mahnung. Angesichts der häufigen Frühjahrsfröste zu St. Georg („Jerry“) und St. Markus (23. bzw. 25. April) muß der Winzer mit Schneiden, Sticken, Biegen und Hacken der Reben zu dieser Zeit bereits fertig sein.
Zu bedenken ist die heute kaum mehr bekannte frühere Bedeutung des Weinbaus für den Arbeitsmarkt (zumal in deutschen Landen die Anbaufläche des Weins seit dem Mittelalter auf ein Drittel geschrumpft ist), um zu ermessen, was kalte Tage im Spätsommer, auf die wir heute nur mit Unmut und wärmerer Kleidung reagieren, für Folgen hatten: Frosttage ließen den Wein verderben50 oder wie 1392 nur einen sauren Wein gedeihen, der von den Menschen „ratzemann“ genannt wurde.51 Und umgekehrt: Allzu heiße Sommer beschworen die Gefahr der Trockenheit herauf.52 1393 herrschte in Österreich die größte Dürre seit Menschengedenken, und 1401 sollen hier in der Sommerhitze alle Brunnen versiegt sein.53 Mitte des Jahres 1388 hatte der Rhein einen so niedrigen Wasserstand, daß man in Köln Wasser auf den Straßen verkaufte.54 Eine große Teuerung folgte dem heißen Sommer des Jahres 1375, als drei Monate lang kein Regen gefallen war.55 Der überaus trockene Herbst des Jahres 1513 ließ am Niederrhein die Wasserstände so stark sinken, daß im Winter alle Bäche und Teiche, durch welche die Mühlen betrieben werden konnten, vereist waren. Hungersnot drohte.56
Dankbar waren die Menschen über gutes Wetter aus existentiellen Gründen: „guter, warmer, trukner, seliger sumer“.57 Die Tische waren reicher gedeckt nach einem solchen „seligen Sommer“ des Jahres 1471. 1442 war „dat beste winjair, dat man ie gedenken mochte“.58 Begeistert spricht Burkard Zink von dem „guet fruchtbar jar“ 1467: „der winter was mittel, weder zu kalt noch zu warem … der summer ward nit ze haiß und regens genueg … der hörbst was guet warem und regnet zu gueter maß.“59
Wie schon in mittelhochdeutscher Zeit beklagt um 1500 ein Lied auf einem Einblattdruck das Herannahen des Winters. Spielende Mädchen sollen die bald verlorenen Freuden des Sommers darstellen.
Mochten auch Frühjahrsfröste und Sommerregen gefürchtet werden, so waren sie doch leichter zu ertragen als die Winterzeit.60 Das ist die Realität, deretwegen Dichter die „sueze sumerzît“, ja die „saeligiu sumerzît“ preisen können.61 Es leuchtet ein, daß man im Frühling auf den Kreuzzug zieht, wenn, um mit Otto von Freising zu sprechen, „das junge Grün der Felder ein heiteres Antlitz der Erde bietet und der Welt zulächelt.“62 Der Mai ist den medizinischen Monatsregeln entsprechend der für den Menschen gesündeste Monat, weil die Natur alle Kräfte regeneriert.63 Frühjahrspflanzen wie der Schlüsselblume werden besondere Heilkräfte zugeschrieben, und sie dienen unter anderem auch als Schönheitsmittel.64
Unberechenbare Natur. So beginnt die Limburger Chronik: „Item da man zalt nach Cristi geburt dusent druhondert unde ses unde drißig jar uf daz fest Simonis unde Jude da was der große wint, der tet großen schaiden, der warf groß huis, gezimmer unde torne umb unde fellet große baume in den welden.“65 Die Macht des Windes konnte den Menschen gefährlich werden. Am Ende des prächtigen Mainzer Hoftags im Mai 1184 zerstörte ein Sturm die Zelte und mit der kaiserlichen Kapelle auch die Behelfsbauten, die für den Hoftag auf den Rheinwiesen errichtet worden waren. 15 Menschen kamen dabei um.66 Hier ist bereits bezeugt, was dann in der besonders stürmischen „kleinen Eiszeit“67 den Menschen Sorgen bereiten mußte. Immer wieder ist in den Chroniken von Stürmen die Rede, die von den Kirchen die Dachstühle wegfegten und fest gezimmerte Häuser einrissen.68 Uns interessiert an der einleitend zitierten Nachricht der Limburger Chronik noch etwas weiteres: Der Verfasser erinnert an eine Begebenheit, die etwa elf Jahre vor seiner Geburt stattfand. Das Typische: An Witterungsunbilden erinnern sich Menschen zeitlebens; Naturkatastrophen gar leben noch Generationen später in der Erinnerung.69
Natur – das war auch immer das Unvorhersehbare. Wenn 1446 Würmer die Wurzeln des Getreides in katastrophalem Ausmaß zerfressen, notiert Burkard Zink, daß selbst alte Leute sich nicht an ein vergleichbares Unglück erinnern konnten.70 Und das ist die Wendung, mit der immer wieder Chronisten auf die Unberechenbarkeit der Natur reagieren: Seit Menschengedenken habe man das nicht erlebt;71 eine Steigerung benutzt der Kölner Chronist, der zum Winter 1434/35 notiert: „do was der kaldeste winter, der sint gotz geburte je gewas.“72 Nur ausnahmsweise finden sich präzise Zeitangaben: das größte Unwetter seit 20 Jahren.73 Wie wenig man solchen Zeitbestimmungen trauen darf, zeigt Heinrich Deichsler, der zu 1498 von dem kältesten Winter seit 20 Jahren spricht74 und offenbar vergessen hat, daß er für das Jahr 1490 den kältesten Winter seit 50 Jahren vermerkt hatte.75
Unberechenbare Natur. An überaus milde Winter konnten sich Zeitgenossen erinnern, etwa als in Österreich um 1408 schon Anfang Februar Veilchen und Palmkätzchen zu sehen waren, als 1424 zu Weihnachten die Sonne wie zu Ostern schien und bereits Mücken herumschwirrten.76 Am Niederrhein fingen zu Weihnachten 1504 die Blumen an zu blühen, Bäume trieben Blätter.77 Und umgekehrt konnte im Mai Schnee fallen.78 Die Natur überrascht die Menschen stets aufs neue und oft aufs grausamste.79 Große Stürme wie etwa 139780 und Erdbeben wie etwa 134881, 135682 und 1395.83 Das Erdbeben von 1348, dessen Epizentrum bei Villach lag und ein Schüttergebiet von 600 km im Durchmesser heimsuchte, war eines der die Zeitgenossen bedrückendsten Ereignisse, wie die erstaunlich hohe Zahl von 80 Belegen in Chroniken erkennen läßt.84 Selbst wenn leichtere Beben keinen größeren Schaden anrichteten wie jenes, das 1504 zwischen Duisburg und Köln das Geschirr an den Wänden klirren ließ, so lösten sie doch großen Schrecken aus.85 Lokale Ereignisse, die gleichwohl zum gefährdeten Alltag gehörten, waren die Hagelschläge – immer wieder begegnen Nachrichten über solche Schauer mit Körnern von der Größe von Steinen oder Hühnereiern, die Dächer und Kirchenfenster einschlugen.86 Sogar die damals noch seltenen Steinhäuser konnten 1279 in verschiedenen Orten des Elsaß durch Hagelschlag beschädigt werden.87
Eine seit der Karolingerzeit immer wieder, allerdings in großen zeitlichen Abständen bezeugte88 Naturkatastrophe bedeuteten die an die biblischen sieben Plagen gemahnenden Heuschreckenschwärme.89 Das Jahr 1338 erschien den Chronisten weniger als das Jahr des reichspolitisch so bedeutsamen Rhenser Weistums, sondern als das Jahr jener Tiere bemerkenswert, die mit ihren „behelmten Köpfen“ in dichten Schwärmen sich auf den Feldern niederließen und ganze Landstriche kahlfraßen.90 Historische Merkverse komprimierten die allgemeine Erinnerung an die Katastrophe,91 die von manchen Zeitgenossen in einen Zusammenhang mit den Judenpogromen gestellt wird.92 Heuschreckenschwärme in den folgenden Jahrzehnten waren, wie etwa 1362, offenbar nur regionale Ereignisse – aber immerhin, für die betroffenen Landschaften bedeutete es die Vernichtung von Ernten, wenn die Heuschrecken „wie Schnee“ auf den Feldern niedergingen.93
Labile Welt. Lawinen und Bergrutsche verursachten menschliche Tragödien.94 Das wenigste davon ist in den Quellen überliefert und läßt sich nur andeutungsweise erfahren, wenn die Herrschaftswelt in Mitleidenschaft gezogen, wenn also etwa die Grande Chartreuse bei Grenoble durch eine Lawine nahezu vollständig zerstört wird.95 Als Abt Rudolf von St. Trond im Winter 1127 über die Alpen reiste, verschüttete eine Lawine zehn seiner Begleiter.96 Das läßt verstehen: Wer im Winter über die Alpen steigen muß, und das sind im 12. Jahrhundert bereits Tausende, pflegt am Morgen des ersten Aufstiegs zu beichten.97 Gefahren und Solidarität des Erbarmens: Um 1050 wurde das Hospiz auf der Paßhöhe von jenem Adeligen gegründet, nach dem der Berg heute heißt: St. Bernhard – für Jahrhunderte der höchste dauernd bewohnte Platz Europas.98
Den Bergrutschen in den Alpen entsprechen die Abbrüche an den Steilküsten der Meere. Die Kliffs an der dänischen und mecklenburgischen Ostsee sind in historischer Zeit entstanden, als die Küste teilweise mehrere hundert Meter vor dem Meer zurückwich.99 Noch weniger aber als von den Gefahren des Alpenübergangs erfahren wir von den Gefahren auf See. Erst im Spätmittelalter finden sich vereinzelte Nachrichten. Bis nach Köln drangen 1424 Berichte von einem verheerenden Orkan in der Nordsee, durch den viele Menschen ertranken und viele Kaufleute ihr Gut verloren.100
Erdbeben und Flutkatastrophen hatten schon die antike Zivilisation schwer heimgesucht. Selbst das Stadtbild der weltbeherrschenden Metropole Rom wurde zwischen 193 und 148 v. Chr. durch Erdbeben, Überschwemmungen und Brände zutiefst umgestaltet. Auch in der hochentwickelten mediterranen Kultur wird nicht intensiv nach seismologischen und vulkanologischen Ursachen gesucht, vielmehr versuchen die Menschen, sich durch Tempelbauten und Gelübde vor den Naturgewalten zu schützen. Der Unterschied zum Mittelalter besteht in einem übergreifenden Katastrophen-Management, das in der römischen Kaiserzeit entwickelt wird.101
Klima – Gott – Natur: Gottes Zorn drücke sich, so fürchteten die Menschen, in Unwettern, in Hagelschlag und Frösten aus.102 Kollektivstrafen, die alle trafen. Gott lebte nicht in der Natur, sondern er argumentierte mit ihr. Die Missetat des einzelnen kann Gottes Strafe nach sich ziehen, die dann alle trifft. Die Ehescheidung König Ottokars II. von Böhmen beantwortet der Himmel, wie der Steirische Reimchronist meinte, mit Unwettern.103 Entgegen dieser allgemeinen Auffassung hatten einzelne immer wieder versucht, den rationalen Ursprung von Naturkatastrophen zu erweisen;104 es lag nicht zuletzt an den schwierigen Bedingungen wissenschaftlicher Kommunikation, daß diese individuellen Erklärungsansätze lange keinen größeren Einfluß gewannen.
Konnte auch der Teufel mit der Natur argumentieren? Offensichtlich haben dies viele gefürchtet. Einsichtige sollten hingegen immer davor warnen, die Heimsuchung der Menschen durch Unwetter, Pflanzenkrankheiten, Raupen- und Heuschreckenfraß für Hexenwerk zu halten.105 Schon im frühen 9. Jahrhundert hatte der einflußreiche Erzbischof Agobert von Lyon gegen die Vorstellung vom Wetterzauber angekämpft,106 wie nach ihm noch zahlreiche weitere Theologen: Gott ließe sich doch von niemanden, weder von Teufeln noch von alten Weiblein, ins Handwerk pfuschen. Dennoch blieben seit dem Frühmittelalter, als die Volksrechte den Wetterzauber mit Strafen bedrohten,107 das ganze Mittelalter hindurch entsprechende Vorstellungen lebendig,108 in Teuerungszeiten massiv auftretend.109
Wandelhaft war das Klima. Konstant aber erschien den Menschen die Beschaffenheit der Luft in ihrer Region. Nur vorübergehend irritiert durch starke Gewitter oder anhaltende Trockenheit110 gehörte die jeweilige Beschaffenheit der Luft zur – Verzeihung – „regionalen Identität“. Gefahren drohten allerdings auch hier. Ein Deutungsversuch Konrads von Megenberg, der auch vor dem zeitgenössischen Hintergrund der Katastrophenjahre zwischen 1338 und 1348 zu sehen ist: Dünste, die sich im Erdinneren ansammelten, könnten – wie Aristoteles und Albertus Magnus lehrten –, faulig geworden, an die Oberfläche dringen und Ursache für Pest und Erdbeben werden.111
Ebenso wie in der frühneuzeitlichen Modegeschichte hinter der höfischen Kleidung der verflogene Duft des Parfums nicht mehr zu rekonstruieren ist, ist auch die zentrale Bedeutung der Luft in ihrer jeweiligen regionalen Beschaffenheit kein historiographisch zu vergegenwärtigender Sachverhalt mehr. Bestenfalls kann es gelingen, den Verlust einer geschichtlichen Dimension anzudeuten. Ein Beispiel: Michael Gaismairs Tiroler Landesordnung von 1525 fordert die Trockenlegung der Moore im Land, damit „die pösen Tämpf von den Mösern vergiengen und daz Land frischer wurd.“112 Die Ausdünstungen waren schon zuvor häufiger beklagt worden. Herzog Siegmund der Münzreiche hatte sogar versucht, die Sümpfe durch Gräben zu entwässern.113 Was die Forderung Michael Gaismairs so aufschlußreich macht, ist ihre programmatische Wucht im Tiroler Bauernkrieg. Der Führer der Aufständischen formuliert allgemeine Anliegen. Es war von allgemeinem Interesse, daß die stickige Luft, die von den Sümpfen ausging, sauber wurde. Ein Einzelbeispiel? Keineswegs, wie im folgenden deutlich werden wird. Wie so häufig in der Geschichte: Forderungen von Revolutionären können tief in der Vergangenheit wurzeln. Auch die Forderung, daß „daz Land frischer wurd“, hat eine lange Tradition.
Arabischen Reisenden des 10. Jahrhunderts, die aus einem Sonnenland kamen, fiel als Besonderheit Nordeuropas auf: Kälte und – in ihren Nasen – stickige, dicke Luft. Qazwînî, ein arabischer Geograph des 10. Jahrhunderts, urteilte über das Frankenreich: „Seine Kälte ist ganz fürchterlich und seine Luft dick wegen der übergroßen Kälte.“114 Die arabischen Gelehrten, die einen solchen Satz lasen, verstanden sofort, daß der Reisende ihnen weit mehr als eine Klimabeschreibung lieferte: Er sagte auch etwas über die Menschen aus; denn davon waren die Gelehrten überzeugt: Luft wirkt auf den menschlichen Charakter. Aber deswegen wäre niemand auf den simplen Kurzschluß verfallen: Rauhe Luft bedingt rauhen Charakter. Qazwînî hütet sich, vorschnelle Lösungen auf Fragen zu bieten, die erst noch der Klärung bedurften.
Was ein arabischer Gelehrter des 10. Jahrhunderts notierte, wäre hier nicht mehr als eine Anmerkung wert, wenn nicht die Prinzipien seiner Urteilsbildung seit der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet worden wären. Salerno! Für den Alltag der Menschen war diese nur bis Mitte des 13. Jahrhunderts blühende Gelehrtengemeinschaft viel wichtiger als die berühmteren Universitäten von Paris und Bologna. Nach Salerno zieht Hartmanns von Aue Armer Heinrich, um Heilung zu erfahren. Die verbreitetsten Gesundheitsregeln des Mittelalters liehen sich die Autorität: „Regimen sanitatis Salernitanum“. Bis heute lebende Weisheiten – „nach dem Essen sollst du ruhn“ usw. – gehen auf dieses Regimen zurück. Von Salerno wurde Europa belehrt, wie wichtig die frische Luft für das Leben ist. Die mittelalterliche Medizin griff diesen Gedanken auf. Saubere Luft in den Städten forderten schon 1231 die Konstitutionen von Melfi.115 Sie wollten alle Gewerbe, die unter üblen Gerüchen arbeiteten, aus den Wohngebieten verbannen. Die geistige Herkunft dieser Bestimmung aus der Schule von Salerno, die in der gleichen Herrschaft Friedrichs II. lag, der die Konstitutionen von Melfi erlassen hatte, ist mit Händen zu greifen.
Die Schule von Salerno ist nach ihrer Gründungslegende von einem Griechen, einem Araber, einem Juden und einem Christen geschaffen worden. Personifiziert sind hier, im Prinzip durchaus zutreffend, die kulturellen Vermittlungs- und Rezeptionsvorgänge.116 Abgesehen davon, daß man an dem Juden angesichts des Ansehens jüdischer Ärzte nicht vorbeigehen konnte und daß man den Christen aus Proporzgründen erwähnen mußte, hält die Gründungslegende einen epochalen Vorgang fest: Aus der griechischen Medizin hatten die Araber die sogenannte Humoralpathologie übernommen und weiterentwickelt.117 Der Mensch besteht aus Säften, die den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft entsprechen – und die jeweilige Mischung und Zusammensetzung dieser Säfte entscheidet über den Charakter des Individuums: Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker und Sanguiniker. Über die Araber lernte das Mittelalter durch die Vermittlung Salernos seit dem 11. Jahrhundert dieses Konzept der Griechen schätzen. Die Säftelehre sollte dann zum Grundbestand medizinischer Gelehrsamkeit bis in das 18. Jahrhundert gehören – der Hintergrund der Forderung, daß „daz land frischer würd“.
Auch wenn wir es uns hier versagen müssen, näher auf die Humoralpathologie einzugehen,118 sei doch nachdrücklich darauf hingewiesen, daß sie mehr war als eine medizinische Grundauffassung im heutigen Verständnis. Die Säftelehre enthielt eine seelische Interpretation des Körpers, weil sich von den körpereigenen Säften in ihrer jeweils individuellen Zusammensetzung die Temperamente der Menschen ableiteten. Sie ist also im Kern eine – von der Theologie unabhängige – Anthropologie.119 Innerhalb dieser besagte die gute Luft für den Menschen mehr als nur Wohlbefinden.120 (Deshalb reagierte selbst die asketische hl. Elisabeth empfindlich auf schlechte Luft.)121
Die gute Luft wird im Mittelalter keineswegs als selbstverständlich hingenommen. Wie die Fürsten nach dem Willen des einflußreichen Fürstenspiegels des Aegidius Romanus (1277/ 79)122 haben auch die Stadträte für die gute Luft zu sorgen. Das ist Teil ihrer Verantwortung für den Gemeinnutz. Nicht zu beweisen, aber zu vermuten ist dabei eine Rezeption des Römischen Rechts, fanden sich doch im Codex Theodosianus (14.6) spätantike Gesetze gegen die Luftverschmutzung.123
Natürlich braucht man keine gelehrten Werke, um den Wert frischer Luft zu erkennen. Die meisten entsprechenden Maßnahmen sind nicht überliefert. Zufällig nur ist folgende Nachricht erhalten: Das Stift St. Peter in Mainz läßt 1234 in den Rheinniederungen Reben anpflanzen, um die Luft zu reinigen.124
Zum spätmittelalterlichen Städtelob gehörte der Hinweis auf die gute Luft. So rühmt Aeneas Sylvius die gesundheitsfördernde Lage Basels in der Mitte zwischen Bergeshöhe und dunstgeschwängerter Ebene,125 so rühmt er die milden Winde und die überaus heilsame Luft („aer saluberrimus“) in Passau.126
Die jeweilige, von Landstrich zu Landstrich unterschiedene Zusammensetzung der Luft und ihre Bedeutung für den Charakter eines Menschen bilden den Hintergrund einer Erzählung des Caesarius von Heisterbach anfangs des 13. Jahrhunderts. Ein besorgter Vater schickte seine Tochter über den Rhein, weil ihr dort die Luft besser bekäme. Dieser Vater – Caesarius nimmt keinen Anstoß daran, daß es sich um einen Geistlichen handelt – war besorgt, daß seine Tochter den Verführungskünsten der Männer erliegen könnte. Als eines Tages gar der Teufel sich in Gestalt eines bildhübschen Jünglings nahte, half nur eines: die den Charakter stabilisierende, die ‚bessere‘ Luft jenseits des Rheins.127 Die Luft ist nicht nur für die physische, sondern auch für die psychische Konstitution wichtig. Gemäß dieser Regel handelte noch 1734 jener Arzt, der das dauernde Nasenbluten des neunjährigen Giacomo Casanova und dessen „stumpfsinnigen Gesichtsausdruck“ auf die „Dickflüssigkeit in der Luft“ Venedigs zurückführte und dringend zu einer Luftveränderung riet. Diesem Rat, so Casanova in seinen Erinnerungen, verdanke er sein Leben.128
Luft und Charakter: Dieser Zusammenhang gilt noch den Humanisten, die vielfach mit der mittelalterlichen Gelehrsamkeit nichts anzufangen wissen, als eine Selbstverständlichkeit. So kann die „Norimberga“ des Konrad Celtis, ein Städtelob auf Nürnberg, auf einen Konsens zurückgreifen, wie er zur Gattung des Stadtlobes gehört: Der „Witz“, also die geistige Beweglichkeit und die Erfindungsgabe der Nürnberger, kommt – so Celtis – von der trockenen Luft in der Stadt. Daß diese Luft nicht von schädlichen Dünsten geschwängert sei, wäre nicht allein der Gesundheit förderlich, sondern auch der Spannkraft des Geistes. Wie schädlich schlechte Luft sei – so weiterhin Celtis –, wäre im Kontrast zu den Nürnbergern an den Menschen, die an der Donau lebten, zu erfahren.129 Unabhängig davon, wie ernst Celtis sein Pauschalurteil genommen hat, sind seine Bemerkungen Teil eines Traditionsstranges, der von der antiken Klimatheorie bis zur einleitend zitierten Geschichtsauffassung Jean Bodins reicht.130
Die Frage der guten Luft, die schon im Mittelalter als eine Frage nicht nur des physischen, sondern auch des psychischen Wohlbefindens angesehen wurde, läßt klaffende sozialen Unterschiede erkennen.131 Zu den Gesundheitsregeln, die der Arzt in Heinrich Wittenwilers „Ring“ gibt, gehört, ganz in salernitanischer Tradition, das Leben in frischer Luft und das Schlafen in gut gelüfteten Zimmern.132 Aber solche Zimmer besaßen die meisten Menschen gar nicht. Ihre Katen konnten im Inneren allenfalls durch Vorhänge abgeteilt werden; und wie sollte man das typische „Rauchhaus“ der kleinen Leute lüften, in dessen Mitte ein offener Herd stand, dessen Rauch das Reet- oder Strohdach beizte und undurchlässig machte?
Luft und Gesundheit:133 Im Mittelalter war dieser Zusammenhang so selbstverständlich, daß bei Seuchen zunächst hier die Ursache gesucht wurde. Luftverbesserung bzw. das Aufsuchen von Gegenden mit sauberer Luft gilt in Pestzeiten als Vorsichtsmaßnahme.134 Selbst bei der seit 1495 in deutschen Landen sich schnell verbreitenden Syphilis dachte man wegen des starken Mundgeruchs der Erkrankten als erstes an verdorbene Luft,135 und als 1529 die in England seit 1485 ausgebrochene Seuche des sogenannten „englischen Schweißes“ auf den Kontinent durch Söldner eingeschleppt wurde und vor allem den Norden Deutschlands heimsuchte, war man sicher, daß diese teilweise mit Todesfolgen verbundene Epidemie „aus bösem und vergifftigem Lufft geursacht“ sei.136 Solche Auffassungen hielten sich lange. Als ein Göttinger Professor bereits im Gründungsjahr der Georgia Augusta 1737 starb, wurde von Gegnern der neuen Gründung sofort die Behauptung verbreitet, der Todesfall zeige, wie schlecht es um Luft und Wasser in Göttingen bestellt sei.137
Luft und Geruchsbelästigung: Das Problem ist in Mitteleuropa mit seinen vielen Niederschlägen größer als in ariden Gebieten, etwa im islamischen Nordafrika, wo die Sonne die raschere Entsorgung stinkenden Unrats bewirkt. In deutschen Landen kannte man im Mittelalter allerdings noch nicht den dramatischen Zusammenhang von Siedlungsverdichtung und extremer Luftverschmutzung. Es gab hier keine Großstädte wie Paris, Mailand oder London, die bereits zu Anfang des 14. Jahrhunderts 100 000 Einwohner zählten, zu einer Zeit, da in Köln als größter deutscher Stadt bestenfalls 20 000 Menschen lebten. Stadt und schlechte Luft gehörten zwar auch in deutschen Landen zusammen, aber die Misthaufen als Dauerproblem kommunaler Geschichte im Spätmittelalter können wir in anderen Zusammenhängen behandeln. Hingewiesen sei aber darauf, daß die Luftverschmutzung in europäischen Großstädten schon im Mittelalter bedrohliche Ausmaße annehmen konnte. Im nebligen London sollte dies zu einem Politikum werden. Die Steinkohle, auf der Englands Aufstieg zur führenden Industriemacht im 19. Jahrhundert beruhte, war im Mittelalter nur als Holzsurrogat für das Heizen bekannt; aber sie war hier viel häufiger in Gebrauch als auf dem Kontinent, denn sie war wesentlich billiger als das Holz.138 Schon 1285 kam eine vom König eingesetzte Kommission zu dem Ergebnis, daß in vielen Regionen die Luft durch das Heizen mit Steinkohle „verunreinigt und verdorben sei und eine Gefahr für alle darstelle“.139 Entsprechende königliche Verbote, etwa 1307 ausgesprochen, konnten nichts gegen die Marktgesetze ausrichten.140 Insbesondere in London war die Luft durch das Verfeuern der Steinkohle stickig und rauchgeschwängert.
Wenn auch nicht so drastisch wie in London, gehörten doch üble Gerüche zur mittelalterlichen Stadt.141 Die Ratsherren bemühten sich, ganz im Sinne der Konstitutionen von Melfi, die Gerber am Stadtrand anzusiedeln,142 denn von deren Werkstätten stieg ein übler Fäulnis- und Verwesungsgeruch der noch nicht entfleischten und enthaarten Häute auf, und weiterhin stank der bei der Sämischgerberei in großen Mengen verwendete Fischtran.143 Selbst wenn die Gruben mit der ätzenden Gerberlohe durch Eichenbohlen abgedeckt wurden, war eine Geruchsbelästigung der Nachbarschaft unvermeidlich.144 Bei der Verlegung an den Stadtrand ist zu berücksichtigen, daß der Gerber zwar ein anrüchiges, aber wegen des beträchtlichen Kapitaleinsatzes hochgeachtetes Gewerbe ausübte.145 Die Geruchsbelästigung muß schon arg gewesen sein, um ihn an den schlecht beleumdeten Stadtrand zu verdrängen.
Die Gerber bilden zwar das wichtigste, aber keineswegs das einzige Gewerbe, dessen Ausdünstungen zu Nachbarschaftsprozessen und zum Eingreifen der Stadträte führte. Färber, Seifensieder und die angesehenen Kürschner sind weiterhin zu nennen.146 Vor allem die Färber, die zum Beizen der Stoffe Alaun, Kupfervitriol und Kuhmist verwendeten, verschmutzten Luft und Gewässer.147 Der Zürcher Rat erlaubte die Anlage eines Färberkessels nur unter der Bedingung, daß die Nachbarn nicht „von gesmak und von rouches wegen“ belästigt würden.148 Der Kölner Rat schloß trotz zahlreicher Bittschriften 1464 aus Gründen des Umweltschutzes die Messingschmelze, welche bis zu 100 Menschen Arbeit gegeben hatte.149
Mittelalter und Neuzeit sind, so zeigt die Sorge um die gute Luft, enger miteinander verbunden, als man gemeinhin glaubt. Der Gesetzgeber der Konstitutionen von Melfi, der hochgebildete Staufer Friedrich II., kannte, beeindruckt von der arabischen Kultur, die Miasmen-Theorie. Krankheitsübertragungen erfolgen durch verdorbene Luft, durch Miasmen, die in belasteten Klimaverhältnissen gedeihen. Diese Überzeugungen, von denen unter anderem auch die spätmittelalterlichen Stadträte geleitet waren,150 hielten sich über die Zeiten hinweg, kaum modifiziert, bis ins frühe 19. Jahrhundert: So entwarf Johann Adolph Behrends 1771 eine Art „Lufttheorie“,151 wonach frei zirkulierende Luft lebensfördernde Grundbedingung für die Gesundheit sei. Daß dies nicht ganz falsch sein kann, belegt die bibliothekarische Erfahrung, daß alte Bücher um so mehr leiden, je weniger ihnen die Luftzirkulation – und sei sie auch nur durch undichte Fensterspalten gewährleistet – das Wohlbefinden sichert.
Gesunde Luft: Die Quellen erlauben nur, das Problem aus der Sicht städtischer Gebote und aus Nachbarschaftsstreitigkeiten zu umreißen. (Der Sachsenspiegel schrieb bereits vor, wie weit ein Abort vom Nachbargrundstück entfernt sein solle.)152 Aber die Reinhaltung der Luft muß an vielen Arbeitsplätzen Schwierigkeiten bereitet haben. Das galt vor allem für die personalintensive Montanindustrie. In der für den Historiker verlorenen, weil nur mündlich geführten Diskussion wurzelt die Schrift des Memminger Stadtarztes Ulrich Ellenbog, der als Leibarzt Herzog Siegmunds von Tirol mit dem Berg- und Hüttenwesen vertraut war. Wenn wir diese Schrift von 1473, eine Warnung an die Augsburger Goldschmiede, als erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Gefährdungen am Arbeitsplatz würdigen, so verstehen wir sie doch zugleich als Teil einer breiteren und älteren Kommunikation über die Auswirkungen verdorbener Luft und schädlicher Dünste bei der Metallverarbeitung: „Von den giftigen besen Tempfen und Reuchen der Metal.“153
In der mittelalterlichen Sorge um die gute Luft wurzelt die Frühgeschichte des deutschen Vorgartens mit seiner Eigenheimideologie. „Garten“ war dem Mittelalter ein eingezäuntes Nutzareal,154 das im Frühmittelalter ortsnamenbildend werden konnte – Weingarten zum Beispiel. Daneben gab es Gärten im Klosterbereich, meist der Anpflanzung von Heilkräutern dienend,155 und seit dem 12. Jahrhundert auch in den Burgen.156 Den Gedanken des Nutzgartens, dem nicht zuletzt die Obstbaumzucht zu verdanken ist,157 griffen die Bürger auf. Ihren Gärten entstammten die wenigen Vitamine, an denen die mittelalterliche Küche so arm war.158 Zu einem der erfolgreichsten Werke der spätmittelalterlichen Fachliteratur sollte das „Pelzbuch“ des Gottfried von Franken werden, ein Buch, das sich mit dem „Pelzen“, dem Pfropfen der Obstbäume, der Obstkonservierung und der Herstellung von Obstweinen beschäftigte.159
Einen ganz anderen Typ als den der eingezäunten Sondernutzung beschreibt hingegen Albertus Magnus, den Garten nämlich, der den Menschen zur Rekreation dient. Wir übergehen seine Empfehlungen, wie etwa: kochendes Wasser auf die Erde zu gießen, um zu verhindern, daß Unkraut nachwächst. Aber – und hier ist der große Naturwissenschaftler ein Prophet der neuzeitlichen Gartenkultur – er empfiehlt Bäume nicht wegen ihres Nutzens zu pflanzen, sondern zum menschlichen Wohlbehagen. Die Bäume nämlich sollen Schattenkühle schaffen, auf keinen Fall schwere und damit schädliche Düfte verbreiten, sie sollen gesunde Luft spenden, die nicht zu heiß und nicht zu kalt sein darf.160
Rasenbank und eingefaßte Quellen gehörten zur Vorstellung des Albertus Magnus von einem Erholungsgarten.161 Er belebte damit eine alte monastische Tradition, denn schon um 820 kennt der auf der Reichenau konzipierte sogenannte St. Galler Klosterplan neben dem Areal für die Heil- und Küchenkräuter auch eines der Ruhe und Kontemplation.162 Was Mönche entwickelten, was Albertus Magnus beschrieb, wird in der höfischen Kultur Italiens im 15. Jahrhundert zur Gartenbaukunst weiterentwickelt, die dann in der frühen Neuzeit zum europäischen Schloßbau gehören sollte.163
Wo war die Anlage eines solchen Gartens, wie sie der Grafensohn Albertus Magnus beschrieben hatte, überhaupt möglich? Wir deuten hier nur an, daß bestenfalls die Oberschicht oder Kleriker und Mönche im urbanen Milieu Hoffnungen auf eine Gartengestaltung hegen konnten, die sich vom Nutzgarten so entschlossen entfernte.164 Urbanes Milieu? Allein vor den Stadtmauern etwa Nürnbergs im 15. Jahrhundert165 konnten die Vorstellungen des Grafensohnes realisiert werden. Zur spätmittelalterlichen Bebauungsverdichtung in der Stadt gehört auch die Anlage von Gärten am Stadtrand oder vor den Mauern.166 Das scheinbar Widersprüchliche erweist sich als komplementärer Vorgang. Die Bebauungsverdichtung ging von der Innenstadt aus; wer dort in Giebel- oder Traufstellung zur Straße ein Haus besaß, legte nach Möglichkeit vor den Stadtmauern einen Garten zur Versorgung dieses Hauses an, einen Nutzgarten natürlich, einen Gemüse, Kräuter- oder Obstgarten, der teilweise auch mit Sonderkulturen wie Hopfen bestellt war.167 Die Archäologie hat die mächtigen Humushorizonte dieser Nutzungsbereiche, ihre reichliche Düngung mit Fäkalien, aufgedeckt.168 Es ging nicht, wie Albertus Magnus vorschlug, um schattenspendende Bäume, um lebensfroh stimmende Blumen, es ging ums Gemüse.
Den Nutzgarten gibt es vor der Stadt, aber auch vor der Burg. Wir fragen deshalb: Wie gesund ist die Luft auf den Burgen? Von den Gedanken eines Albertus Magnus ist der normale Adelige ebensoweit entfernt wie der einfache Bauer. Eine Burg ist, was heute weitgehend vergessen ist, Mittelpunkt eines Wirtschaftsbetriebs. Das Holz der Ställe,169 Scheunen und Nutzbauten im Burgareal ist längst vermodert. Erhalten blieben Phantasie erzeugende Relikte, also Steine. Aber als Mittelpunkt einer adeligen Eigenwirtschaft beschreibt 1518 Ulrich von Hutten nicht nur die Belästigung der Burgbewohner durch blökendes Vieh und bellende Hunde,170 sondern auch die Gerüche.171 Es stinkt aus den Ställen auf der Burg. Nachdem der Minnesänger sein Tagelied hat verklingen lassen, schnuppert er Rinderdung und Hundekacke.
Schlechte Luft auf den Burgen, schlechte Luft aber auch am Hofe. Gibt es eine höfische Kultur ohne Gestank? Übergangen seien die ungelüfteten Schlafkammern, in denen auf engstem Raum die Ritter übernachten mußten, übergangen seien die abgeschlossenen, bis in die letzten Winkel hinein belegten Räume, in denen die Hoffräulein schliefen. Der früheste hofkritische Traktat des deutschen Kulturraums, der „Palpanista“ des Münsteraner Klerikers Bernhard von der Geist, beschreibt um 1250 das Streitgespräch zwischen dem Autor und einem Ritter. Der Autor preist sich glücklich, endlich den Hof hinter sich gelassen zu haben und auf dem Lande, in gesunder Luft, im eigenen, bescheidenen Heim für sich und als sein eigener Herr leben zu können.172 Die gesunde Luft ist hier nicht mit der Nase, sondern mit der Seele gespürt, ist Ausdruck der Freiheit, hat doch der Autor den Hofdienst als System von Fesseln der Knechtschaft charakterisiert; aber für jeden zeitgenössischen Leser war eben diese Parallelisierung von gesunder Luft abseits des Hofes und von Freiheit – jenseits aller Topoiforschung – aus eigener Erfahrung nachvollziehbar. Mag Bernhard von der Geist im übertragenen Sinne die Nase rümpfen, so konnten das welterfahrene Adelige im realen Sinne verstehen.
Die Luft im Mittelalter war sicherlich besser als heute. Die schlimmsten Geruchsbelästigungen werden – auch wenn wir keine historischen Luftmessungen vornehmen können – doch nicht den Verschmutzungsgrad unserer Fußgängerzonen erreicht haben. Conrad Celtis konnte die Düfte noch riechen, die in Nürnbergs Straßen die Kräuter und Blumen auf den Fensterbänken verströmten.173 Aber nur vordergründig ist mit diesem Hinweis das Grundsatzproblem relativiert. Die Sorge des Mittelalters um die gute Luft ist keineswegs dadurch zu entkräften, daß der Mensch eine viel größere Schadstoffbelastung ertragen kann. Dem Großversuch über die Belastbarkeit der Menschen sei die stille Weisheit alter Zeiten entgegengehalten: Die Luft beeinflußt den Charakter. Daß „daz land frischer wurd“, ist ein überzeitliches Reformprogramm.