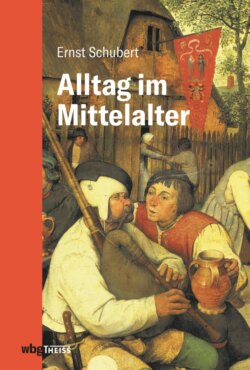Читать книгу Alltag im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die ersten Maßnahmen zum Schutz des Waldes
ОглавлениеDie spätmittelalterlichen Stadträte wußten, wie sehr ihr Gemeinwesen vom Wald abhing. Sie erkannten die Gefahr der Übernutzung. Nürnberg hatte seit seiner ältesten Waldordnung von 1294 konsequent die Reichswälder vor den Toren der Stadt gegen Raubbau geschützt.191 Mit dem 14. Jahrhundert mehren sich entsprechende Nachrichten auch aus anderen Städten. 1359 wird erstmals für den Erfurter Stadtwald von einer geregelten Schlageinteilung berichtet.192 Von solchen Maßnahmen, oft schon verbunden mit natürlicher und künstlicher Verjüngung der Bestände, ist in der Folgezeit an vielen Orten zu hören.193 Sogar dörfliche Gemeinden müssen sich, wovon Weistümer künden, um den Erhalt der für die bäuerliche Wirtschaft so wichtigen Wälder bemühen.194
Die Mittelwaldwirtschaft reicht als Waldschutzmaßnahme bis in das späte Mittelalter zurück.195 Der heute weit verbreitete Altersklassenwald geht zwar auf den „Försterwald“ zurück, wie er seit dem Entstehen einer Forstwissenschaft um 1800 (auch den Gedanken der „Nachhaltigkeit“ enthaltend) zur wirtschaftlichen Optimierung der Erträge entworfen wurde, aber er hat seine spätmittelalterlichen Vorläufer – von der Haubergswirtschaft im Siegerland abgesehen196 – in Gestalt der Mittelwaldwirtschaft. Diese Form des Waldbaus erzeugte bei festgelegten Umtriebszeiten Bau- und Brennholz auf derselben Fläche. (Auch die im 18. Jahrhundert entstehende Forstwissenschaft teilte die Unart so vieler neu entwickelter Fachdisziplinen, ihre weitgehend empirisch arbeitenden Vorgänger nicht zu kennen oder nicht zu nennen.)
Die Städte und nicht erst die territorialstaatlichen Forstordnungen entwickelten eine forstliche Verjüngungstechnik.197 So schreibt etwa der Hildesheimer Rat vor, „dat wie twe dele hegede und den dridden hauwede“.198 Die jungen Schläge, die „jungen haue“ werden geschützt, „gebannt“, um in der Sprache der Zeit zu bleiben.199 Durch strenge, auf kleine Flächen bezogene Hiebregelungen gehörte seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts der Zürcher Sihlwald zu den bestgepflegten Forsten in Europa.200 Als Faustregel mag gelten: Je größer und damit holzabhängiger eine Stadt war, um so früher entwickelt sie Waldschutzmaßnahmen; Nürnberg und das durch Waidhandel bedeutsame Erfurt erließen schon im 14. Jahrhundert Ordnungen, für die sich manche Mittelstädte wie Memmingen201 noch bis ins 16. Jahrhundert hinein Zeit lassen konnten.
Bei den städtischen Maßnahmen zum Schutze des Waldes wird sichtbar, in welchem Ausmaß die Stadt Teil einer agrarischen Welt ist. Die Schweinemast wird einschränkenden Regelungen unterworfen, die Waldweide von Ziegen und Schafen wegen der großen Verbißschäden verboten. Danach erst werden Konsequenzen aus der Entwicklung zur Urbanität gezogen. Die Kohlenmeiler müssen sich in stadtferne Areale zurückziehen, der Holzbedarf der städtischen Kalköfen und Ziegelhöfe wird geregelt. Die weiteren, von Stadt zu Stadt verschiedenen, in ihrer Vielfältigkeit gar nicht aufzuzählenden Maßnahmen lassen sich auf ein Prinzip zurückführen: auf die Einschränkung der Allmendnutzung. Denn ursprünglich stand auch der Wald als Teil der städtischen Allmende, des Gemeinbesitzes, allen Einwohnern als Nutzungsreserve offen. Zunächst wird der Kreis der Berechtigten eingeschränkt, die Knechte und Mägde sowie alle ohne Bürgerrecht Ansässigen werden ausgeschlossen. Sodann wird auch den Bürgern die Nutzung nur noch zu bestimmten Zeiten und schließlich – bei dem wertvollen Bauholz – allein noch gegen Zahlung eines „Stammgeldes“ gestattet.202
Von verfassungsgeschichtlichen Wandlungen berichtet das „stumme Erzählen“ des städtischen Waldes. Aus dem Gemeinbesitz der Bürger wird „des Rates Wald“. Der Obrigkeit verpflichtete Forstknechte, Bannwarte, haben den Bürgern die Holznutzungen anzuweisen.203 Sie sollen etwa darauf sehen, daß „niemand langes Holz haue, wo ihm kürzeres wohl täte“. Genauestens wird zum Beispiel in Freiburg darauf geachtet, daß kein kostbares Bauholz verwertet wird, wo schon einfaches genüge, daß für Fensterrahmen als erstes „liegendes Holz“ verbraucht werden müsse.204 Bis ins Pedantische gehen bisweilen die Vorschriften für die Anweisung des Werkholzes. Den Badern in Erfurt werden eigens die Bäume bezeichnet, von denen sie Quästen, die Reiser, mit denen die Badenden ihre Durchblutung fördern, schneiden dürfen.205 Besondere Fürsorge galt den Eichengehölzen in der Stadtmark. Sie werden beispielsweise durch Gräben vor den Karren und Wagen geschützt, die, immer die günstigste Fahrspur suchend, eine mittelalterliche Landstraße mit einem Gewirr von Nebenwegen umrandeten. All diese Schutzmaßnahmen sollten durch regelmäßige Waldbesichtigungen erfahrener Ratsherren überprüft werden; denn diese Maßnahmen waren ein Teil dessen, was als „gute Polizei“ zum Wohle der Stadt galt, waren Teil der vom Gedanken des „Gemeinen Nutzens“ legitimierten Gesetzgebung.206
Daß die städtischen Waldschutzmaßnahmen in einer Vielzahl von Einzelverordnungen zersplittert überliefert sind, hat dazu verführt, allein in den bequemer zu ermittelnden territorialstaatlichen Forstordnungen seit dem 16. Jahrhundert die Grundlagen der modernen Forstwirtschaft zu suchen.207 Aber der frühneuzeitliche Fürstenstaat hat von den Städten des Mittelalters erst gelernt, hat die hier erprobten Maßnahmen in seinen Forstgesetzen gebündelt, hat, nach dem Vorbild der spätmittelalterlichen Städte, die Nutzungsberechtigung der Bauern an den Forsten weitgehend eingeschränkt.208
Wo das Holz immer knapper wird, liegt der Gedanke der Aufforstungen nahe. Im ausgehenden 14. Jahrhundert begegnet häufiger eine obrigkeitliche Anordnung, wie sie – möglicherweise erstmals – 1343 für Dortmund bezeugt ist: Haus- und Hofbesitzer werden zum Anbau von Laubbäumen verpflichtet, wobei die Wildlinge ausgegraben und an die gewünschten Stellen verpflanzt werden.209 Diese scheinbar nur lokalgeschichtlich interessante Maßnahme steht in einem größeren Zusammenhang, dem im 14. Jahrhundert beginnenden Prozeß der Aufforstung, der Wertsteigerung des Waldes.210 Der Wald sei für den Bischof wichtiger als Menschen, wurde um 1365 im Bamberger Hochstift als Begründung dafür angegeben, daß im Frankenwald drei Wüstungen nicht wieder aufgesiedelt wurden.211
Aus den zähen Bemühungen um Aufforstung und Verjüngung der Bestände entsteht „Kunst“ in dem Sinne, daß der Mensch in die Natur eingreift und sie nach seinen Bedürfnissen zu formen versucht. Ausnahmsweise ist dieser im Prinzip universalgeschichtliche Vorgang bei der künstlichen Verjüngung der mitteleuropäischen Waldbestände mit einem genauen Datum zu erfassen. 1369 erprobte Peter Stromer erstmals erfolgreich im Nürnberger Reichswald die künstliche Tannensaat.212 Der Samen wurde im Winter durch langsames Dörren oder Darren in der Wärme vorbereitet und im April bei abnehmendem Mond ausgesät.213 (Ein Erfahrungswert offenbar, denn in Analogie zum üblichen Saat-Aberglauben hätte der zunehmende Mond bevorzugt werden müssen.) Auch bei Laubbäumen gelangen alsbald Versuche künstlicher Nachzucht.214 Die älteste Nachricht über die Eichelsaat stammt aus dem Jahre 1398,215 und schon im 15. Jahrhundert steht die Eiche, zumindest in Norddeutschland, noch vor der Buche an der Spitze bei der künstlichen Nachzucht. Nadelhölzer wurden nur auf schlechteren, für den Laubholzanbau ungeeigneten Böden angesät.216
Auch wenn die Nachzucht von Bäumen bei großen regionalen Unterschieden im wesentlichen erst seit dem 16. Jahrhundert allgemeinere Verbreitung fand,217 auch wenn noch lange Eichenheisterpflanzungen neben der künstlichen Verjüngung bezeugt sind,218 so war letztere doch bereits im Spätmittelalter in ihrer Bedeutung erkannt und genutzt worden.219 Schon um 1400 bestand in Nürnberg eine Waldsamenhandlung.220 Die Reichsstadt blieb der bedeutendste Waldsamenlieferant in Europa. Als Experten wurden in ganz Mitteleuropa Nürnberger Waldsäer herangezogen, und Johannes Cochlaeus rühmt 1512 in seiner „Brevis Germaniae Descriptio“ die Nürnberger, weil sie die Kunst des Säens von Bäumen ersonnen hätten.221
Folgen der Waldsaat. Als 1516 der Kartograph Erhard Etzlaub und sein Zeichner Ulrich Graf in Deckfarbenmalerei eine Darstellung Nürnbergs inmitten der Reichswälder entwerfen, geben sie die einzelnen Waldareale in dunkleren und helleren Tönen wieder: die durch die Waldsaat herbeigeführten Altersklassen-Bestände.222
Trotz allem, was an Raubbau im Umkreis spätmittelalterlicher Städte zu beobachten und durch Waldschutzmaßnahmen vielfach nur noch zu begrenzen war, hat doch letztlich nicht die Entwicklung des spätmittelalterlichen Städtewesens das Ausmaß der frühneuzeitlichen Waldverwüstung bewirkt. Zu einer Forstordnung wie der Tiroler von 1541, die den Wald nur als Annex der Bergwerke betrachtete und die Waldverwüstung in den Hochtälern bis zur Schneegrenze ermöglichte,223 hätten sich die spätmittelalterlichen Stadtväter nicht verstanden. Ihnen war bewußt, wie sehr das Gedeihen ihrer Stadt vom Walde abhing (bezeichnenderweise geht die frühneuzeitliche Devastierung der Nürnberger Reichswälder224 mit dem Niedergang der Reichsstadt einher), sie wußten, wie es eine eidgenössische Ordnung von 1480 formuliert: daß der Wald geschont werden müsse, weil auch „die Nachkommen des Holtzes deheinst nottürftig“ sein würden.225
Die frühneuzeitliche Verwahrlosung der Wälder, die im 18. Jahrhundert von der entstehenden Forstwissenschaft zwar übertrieben, aber im Kern zutreffend dargestellt wurde, ist ein verwickelter Vorgang, der bisher nur unzulänglich erforscht worden ist. So wird zum Beispiel bei dem nicht gerade selten behandelten Thema der Folgen des Dreißigjährigen Krieges kaum einmal des Umstands gedacht, in welchem Maße Wälder abgeholzt oder einfach abgebrannt wurden. Eine Ursache aber heben wir hervor: Die territorialstaatlichen Forstordnungen wirken – nur auf den ersten Blick verblüffend – waldschädigend; sie formulieren obrigkeitliche Ansprüche, ohne diese mit der entsprechenden Kompetenz füllen zu können (verdiente abgedankte Offiziere wurden oft mit Oberförsterstellen abgefunden). Von der legislatorischen Technik her scheinen die Paragraphenbündel der Forstordnungen den Einzelmaßnahmen der Städte überlegen. Aber deren Einzelmaßnahmen waren erstens praxisnäher und zweitens konsensgebunden. Sie wirkten. Die fiskalische Absicht der Forstordnungen jedoch war unübersehbar und stellte – Stichwort „Waldfrevel“ – geradezu herausfordernd in Frage, was selbst während der Entwicklung zum Obrigkeitsstaat konsensfähig gewesen wäre, stellte in Frage, daß die Wälder dem „gemeinen Nutzen“ zu dienen hätten und ihre Nutzung deshalb in einer ständischen, in einer frühparlamentarischen Verantwortung, nicht aber in einem fürstlichen Gesetz zu regeln wäre. Auf spätmittelalterlichen Erfahrungen beruht die Feststellung, welche die bergischen Stände 1515 formulierten und 1554 wiederholten, daß „busch und welde alzeit für ein schatz des lantz gehalten“ würden.226
Zurück zum Spätmittelalter, zurück zu den notwendigerweise langfristig angelegten Bemühungen um den Schutz des Waldes. Diese reagierten auf eine ihnen bewußt gewordene Gefahr. (Es gab um 1500 viel weniger Wald als heute.) Ein Sprichwort ging um, das auch Luther zitiert: Noch vor Anbruch des Jüngsten Tages werde es in Deutschland an drei Dingen mangeln, an „wahren Freunden, gerechter Münze und grünem Holz“.227
Die Geschichte des Waldes im Mittelalter lädt zu vereinfachenden Interpretationen geradezu ein. Raubbau ist vielfach nachzuweisen, verantwortungsloser Umgang mit der Ressource Natur. Waldschutzmaßnahmen werden erst erwogen, als die Begrenzung der Ressourcen erkennbar wird. Können wir die Neuzeit feiern, in der endlich solche Verhältnisse überwunden werden? Wenn wir, was selten geschieht, in das Ökosystem den Menschen einschließen, wird die Gefahr anachronistischer Bewertung offenbar; dann erweist sich, daß die moderne Forstwissenschaft, die jahrhundertelangen Erfahrungen von der Kraft des Waldes zur Selbstverjüngung erst in der Gegenwart überhaupt wieder erwägend, doch immer noch im Banne einer frühneuzeitlichen staatlichen Regelungshoheit steht. Und weiterhin sei am Beispiel des Försters die weit über historische Bildung hinausreichende Befangenheit des Menschen in seiner Geschichtlichkeit kurz angesprochen. Von allen Beamten ist der Förster vom Gegenstand seiner Verantwortung her der geschichtsbewußteste. (Wenn der Baum hochgewachsen ist, ist der Pflanzer tot.) Und sein historischer Erfahrungsraum reicht bestenfalls zweihundert Jahre zurück, immerhin weit länger als bei den meisten Menschen (Historiker eingeschlossen). Und dennoch arbeitet er in einer geschichtlichen Befangenheit, in der Nachfolge der frühneuzeitlichen Forstordnungen. Diese Forstordnungen aber wiesen in ihrer Betonung der obrigkeitlichen Regelungshoheit ins Frühmittelalter zurück. In der unmittelbaren frühneuzeitlichen Tradition stehend, wiederholt der Förster einen frühmittelalterlichen Prozeß. Hatte sein Vorfahr einst, die Vorbereitung durch den Missionar nutzend, die Waldgötter vertrieben und kein anderes Gebot neben dem seinen im Wald geduldet, so nutzte der Förster um 1800 die romantische Faszination von der Waldeinsamkeit, um „im Wald allein zu bestimmen und dort nicht durch Gewohnheitsrechte der Köhler, Glasmacher oder Pechbrenner behelligt zu werden.“228
Nur unzureichend kann das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt aus der Perspektive des ausschließlichen Nutzungs, ja Ausbeutungsgedankens beschrieben werden. Zur Darstellung der Komplexität dieses Verhältnisses sei die Geschichte des Waldes verlassen. Es ist aber kein ganz neues Thema, das wir anschlagen. Denn es war bereits angeklungen, wie eng Wald- und Wassernutzung zusammenhingen. Bereits im Mittelalter ahnte man, daß der Waldbestand auch etwas mit dem Wasserhaushalt des Bodens zu tun hat.229