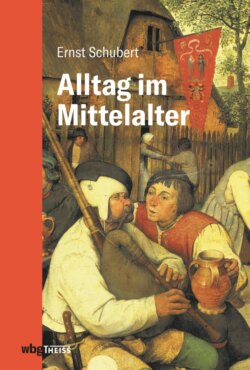Читать книгу Alltag im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Wald in Gefahr: Holznutzung als Grundlage spätmittelalterlicher Urbanität und Wirtschaft
ОглавлениеEin Bettler, der um 1400 auf eine Stadt zuwanderte, war durch waldarme Gebiete geschritten. Zu groß war die Nachfrage nach Holz als Energieträger, nach Holz als Baumaterial. Im unmittelbaren Umland der Stadt hatten nur wenige Gehölze überlebt.96 Die Stadt war ein Wanderziel armer Leute, weil hier an bestimmten Festtagen reichlich Almosen gespendet wurden, in Göttingen zum Beispiel in der Fastenzeit am Sonntag Laetare vor Ostern. Ein armer Mann mochte vielleicht auch hoffen, von der gerade erst entwickelten urbanen Zivilisation zu profitieren, etwa ein „Seelbad“ zu genießen, eine vor allem in norddeutschen Städten verbreitete milde Stiftung:97 An festgesetzten Tagen erhielten die Armen kostenlos in das saunaähnliche Bad Einlaß und beteten als Gegenleistung für das Seelenheil des Stifters. Die Wärme dieses Bades aber spendete der Energieträger Holz.
Vielleicht hatte unser Bettler auf seiner beschwerlichen Wanderung – festes Schuhwerk besaß er nicht – Glück gehabt, daß ihn ein mitleidiger Fuhrmann um Gottes Lohn mitnahm, ein Fuhrmann, der jetzt nicht mehr wie im Hochmittelalter einen zweirädrigen Karren lenkte, auf dem nur ein Faß, das Fuder, das immer noch die grundlegende Maßeinheit bildete, geladen werden konnte, sondern einen vierrädrigen Wagen, oft einen Planwagen, der viel mehr Platz bot. Geladen hatte ein solcher Fuhrmann, wenn er etwa auf Braunschweig, auf Hannover oder auf Lüneburg zufuhr, vielfach Fässer mit Wein aus Frankfurt. Frankfurt war die große Drehscheibe des Weinhandels nach Norddeutschland, vor allem was den Elsässer Wein anging, während der Rheinwein meistens von Köln aus in den Norden transportiert wurde. Jeder Fuhrmann hatte aber auch Sorge, was er als Rückfracht würde befördern können. Als Rückfracht aus Norddeutschland bot sich der Hering an.98 Die großen Heringstonnen waren mit dem Gütesiegel des Lübecker Rats (ein ganzer Zirkel für den Vollhering, ein halber Zirkel für den Halbhering, den minderwertigeren Hering) gekennzeichnet: Hering, der Massenartikel der Hanse, der bis tief nach Oberdeutschland hinein Absatz fand und zu den Grundnahrungsmitteln gezählt wurde. Die Fässer, die Container des Mittelalters, waren natürlich aus Holz. Und darauf wollen wir hinaus: Die Waldarmut im Umkreis der spätmittelalterlichen Städte, die unser Bettler erfuhr, hängt auf das engste mit dem Aufblühen dieser Städte zusammen, Holz bildet die Grundlage der Urbanität – nicht nur zum Kochen und Backen, sondern auch zum Beheizen der saunaähnlichen Bäder unerläßlich –, Holz bildet auch die Grundlage der Wirtschaft – ohne Holz keine Fässer und kein Fernhandel.
Der Beruf des Böttchers, Küfers oder Büttners ist in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzen. Ohne die Verarbeitung des Taugenholzes, wie das meist von Eichen stammende Faßholz genannt wurde, wäre die Ausweitung des Transportwesens im Spätmittelalter gar nicht möglich gewesen, hätte weder Rheinwein ins preußische Deutschordensland noch Einbecker Bier als „Bockbier“ nach München exportiert werden können, hätte der hansische Hering nicht die oberdeutschen Märkte erreicht. Die wirtschaftliche Expansion forderte ein schweigendes Opfer, den Wald. Wir erinnern an den Siegeszug des Bieres. In Hamburg, dem sprichwörtlichen Brauhaus der Hanse, wurden 1375 neben 457 Brauereien 104 Böttcherbetriebe gezählt.99 Die vom Holz abhängigen Böttcher stellen, weil sie ebenso abhängig sind von der Qualität des Bieres, das den Met abgelöst hat, eine bescheidene Frage an die moderne Wissenschaft: Ist Wirtschaftsgeschichte ohne Umweltgeschichte überhaupt darstellbar?
Viel ist über das Aufblühen der Städte seit dem hohen Mittelalter, über Differenzierung und Ausweitung der gewerblichen Produktion gesagt worden. Nicht selten wurde dabei die Grundlage dieser Entwicklung vergessen. Holz nämlich hatte als Energieträger und als Grundstoff für handwerkliche Produktion eine noch höhere Bedeutung als heutzutage das Öl. Wie wichtig der Wald für die urbane Entwicklung war, wußten die Stadträte, als sie im Spätmittelalter durch Privilegienerwerb die Nutzungsrechte erweiterten100 und – konsequenter als der Adel – konkurrierende bäuerliche Waldrechte, wo es nur anging, beschnitten101 und gegebenenfalls auch durch umfangreiche Waldkäufe die wirtschaftliche Grundlage ihrer Gemeinde sicherten.102 Deshalb konnte bereits 1220 eine urbariale Notiz festhalten: „Zwei Wälder bei der Stadt Pfullendorf, ohne welche die Stadt nicht bestehen kann.“103 Noch Anfang des 17. Jahrhunderts konnte der Nürnberger Chronist Johannes Müllner über die mit beharrlicher Zähigkeit von der Stadt erworbenen Reichswälder104 bemerken, jedermann sei „bekannt, daß ohne diese Wäld die Stadt Nürnberg nit hätte können aufkommen, daher in alten Briefen gemeldet wird, daß die Stadt Nürnberg auf diese Wäld gestiftet sei“.105
Den Zusammenhang von Waldnutzung, früher industrieller Entwicklung und aufblühender städtischer Wirtschaft erweist ein Vergleich zwischen Nürnberg und Hagenau. In staufischer Zeit waren beide Städte in etwa gleichbedeutend, waren bevorzugte königliche Pfalzorte, Mittelpunkte auch der Reichsgutsverwaltung, beide umgeben von großen königlichen Wäldern: den Reichswäldern um die fränkische, dem Heiligen Forst um die elsässische Stadt. Während aber Hagenau im Spätmittelalter stagnierte, erlebte Nürnberg einen wirtschaftlichen Aufstieg, der schon die Zeitgenossen staunen ließ; die Bürger der Stadt am Heiligen Forst konnten angestammte, rein agrarwirtschaftliche Nutzungsrechte wie die Schweinemast nicht weiter ausbauen, Nürnberg dagegen gelang es in einem zähen Ringen, mit Politik und Geld, die Reichswälder der eigenen Herrschaft zu unterstellen und sie als Energieträger für die entstehende eisenverarbeitende Industrie in dem von ihr beherrschten oder überherrschten Umland einzusetzen.106
Was wir gemäß einer früher beliebten Terminologie der Historiker als „zähes Ringen“ bezeichneten, ist bei näherem Hinsehen eine umweltgeschichtlich aufschlußreiche Variante des Themas Geld und Politik. Der Leser sei in diesem Zusammenhang um Nachsicht gebeten, daß der Autor neben manchem Spott über modische wissenschaftliche Konventionen auch das Bedürfnis hat, an grundsätzliche Fortschritte zu erinnern, die seine Zunft erreicht hat. Als in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein einflußreiches Sammelwerk über „Meister der Politik“ konzipiert wurde, dachten die Herausgeber nicht im entferntesten daran, auch Gemeinschaften, Genossenschaften in ihrem kollektiven Handeln zu berücksichtigen. Der Nürnberger Rat zum Beispiel erwies sich über den von früheren Historikern gefeierten individualistischen Aktionismus hinaus als Meister der Politik, wie es von der finanzpolitischen Seite her Wolfgang von Stromer erschlossen hat.107 Über mehrere Generationen hinweg schließlich das Ziel der alleinigen Gebotsgewalt über die Reichswälder erreicht zu haben, war eine Meisterleistung in der Verantwortung für das Gemeinwohl der Stadt.
Waldbesitz, Waldnutzung. Auch wenn bis heute die Nürnberger Lebkuchen an den spätmittelalterlichen Nürnberger Rat als Meister der Politik erinnern, so war doch diese Meisterschaft im späten Mittelalter nicht mehr wie in staufischer Zeit allein auf die Zeidlerei, die Waldbienenzucht, bezogen, sie zielte auf die neue industrielle Produktion: Neben Sägemühlen entstanden Hammerwerke und Schmelzhütten, die Erze aus dem nahegelegenen Oberpfälzer Montanrevier verarbeiteten. Schon die Standortwahl in den Reichswäldern zeigt die Abhängigkeit dieser Zulieferbetriebe für das aufblühende, weit berühmte Nürnberger Handwerk vom Energieträger Holz. Auch die Gegenprobe stimmt: Nürnbergs wirtschaftlicher Niedergang seit dem 17. Jahrhundert geht Hand in Hand mit dem Niedergang der Forstwirtschaft in den Reichswäldern. Die Nachfahren der spätmittelalterlichen „Meister der Politik“ hatten sich, inzwischen mit dem Freiherrntitel vom Kaiser ausgezeichnet, auf ihre Herrensitze im Umland zurückgezogen und betrachteten Stadtpolitik als Standesattribut.108
Das Handwerk der Böttcher (Miniatur aus dem Codex des Balthasar Behaim, Krakau, 1505).
Der Wald veränderte die größere Siedlung zur Stadt. Diese war bis in das Spätmittelalter hinein integraler Bestandteil einer agrarisch geprägten Welt, bevor sich (von Stadt zu Stadt verschieden) eine spezifische Urbanität herausbilden sollte. Bereits im 13. Jahrhundert hatten im Umland größerer Städte – sofern nicht Steilhänge in den Bergforsten und Versumpfungen in den Auewäldern Einhalt geboten – Viehweide und Holznutzungen in einem stetig erweiterten Umkreis die Wälder verlichtet. In Frankfurt verschwand der Baumbestand in der Stadtgemarkung, ohne daß der Rat eingegriffen hatte,109 weil der nahegelegene Dreieichenhain die Ressourcen sicherte. Innerhalb der Bannmeile blieben oft nur vereinsamte Gehölze inmitten von Wiesen und Feldern stehen; keineswegs im Verständnis von Überhalterbäumen für eine natürliche Verjüngung zu deutende, sondern allein durch ihre Nutzlosigkeit geschützte Bestände. In diesen Gehölzen suchten arme Leute Beeren und Wildobst, fingen mit Leimruten oder Garnnetzen Vögel zum Verzehr.
Die Waldarmut im Umland spätmittelalterlicher Städte ist Folge der langen Übernutzung; denn ohne Holz hätte sich keine Stadt entwickeln können. Die Wortgeschichte von „Wand“, von dem gewundenen Flechtwerk stammend, belegt die Bedeutung des Waldes für den Hausbau bereits im frühen Mittelalter. Diese Bedeutung verlor der Wald auch nach dem Auslaufen der Rodungsphase nicht;110 denn selbst im Spätmittelalter waren Steinhäuser selten – bildeten deshalb auch die Familiennamen ihrer Besitzer: Steinhauser. Noch im ausgehenden 15. Jahrhundert fiel italienischen Reisenden auf, daß in Deutschland die Häuser aus Holz und nicht aus Stein gebaut waren, daß Öfen die in Italien gewöhnlichen Kamine ersetzten.111
Mächtige Eichen- oder Tannenstämme wurden oft von weit her geholt,112 um ein Bohlenständerhaus, dessen Statik von den vier Außenwänden getragen wurde, oder um einen Firstsäulenbau zu errichten, wo in der Mittelachse wuchtige Holzsäulen die Firstpfette und damit das Dach stützten.113 Ziegel und oft lediglich ein lehmverkleistertes Weidengeflecht füllten beim Fachwerkbau den vom Holzrahmen gesteckten Raum aus. Aus Holz bestand auch meist das Dach, aus Schindeln, die wegen der Brandgefahr erst im Verlauf des Spätmittelalters, bisweilen mit finanzieller Unterstützung der Obrigkeit, durch die etwa ein Drittel teureren Ziegel ersetzt wurden.114 (Selbst das kaiserliche Schloß in Linz war 1492 noch mit Holzschindeln gedeckt.)115 Holz war ebenfalls dort verbraucht worden, wo Häuser als Wohlstandszeichen in Butzenscheiben gefaßte Glasfenster aufwiesen;116 denn vor der Einführung von Soda im ausgehenden 18. Jahrhundert hatten die waldfressenden Glashütten einen enormen Bedarf an Pottasche.117
Evident ist der Holzbedarf für die Fachwerkhäuser.118 Aber ohne Holz hätte es auch keine Steinbauten gegeben. Obwohl Backsteine ein Speyerer Exportartikel waren, wurde ihre Produktion in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nur noch für den unmittelbaren städtischen Bedarf gestattet, denn der Brennholzbedarf für ihre Herstellung war zu groß.119 Außerdem: Steinbauten brauchten Kalk; dieser aber wurde im Wald gebrannt, was nicht nur dem Hildesheimer Rat Sorgen bereitete.120 Und schließlich: In den Steinhäusern, in den Kirchen wurden große Mengen wertvollen Nutzholzes verbaut. Wenn der Dachstuhl eines Kirchturms brennt, schmelzen die Glocken.121 Für den Dachstuhl der Hamburger Petrikirche brauchte man ohne die Sparren mehr als 400 alte Eichen.122 Gerüste und Verschalungen hatten weiterhin viel Holz verschlungen: Ein großer Wald ist für den Bau einer solchen Kirche nötig.
Die städtischen Siedlungen hatten die Nähe zum Fluß suchen müssen. Schwierig war es infolgedessen, im Spätmittelalter massive Steinbauten im Stadtareal zu errichten. Vielfach war nur mit Bäumen ein sicheres Fundament im feuchten Untergrund zu erreichen. So mußten zwischen 1468 und 1488 auf der Isar rund 20 000 Stämme für den Bau der Münchener Frauenkirche angeflößt werden.123 Ein unterirdischer Wald bildete oft das Fundament von wassernahen Großbauten.124 Erfahrene Baumeister empfahlen dafür Eichen-, Erlen- und Ulmenstämme.125
Eine Stadt konnte ohne Holz gar nicht erbaut werden, eine Stadt konnte ohne Holz auch gar nicht überleben.126 Die Nürnberger, so Johannes Cochlaeus 1512, fürchten am meisten, daß es ihnen schließlich an Holz mangeln würde.127 Der kluge Schulmeister (wegen seiner altkirchlichen Einstellung von Reformationshistorikern arg zerzaust) formulierte eine kollektive Erfahrung im städtischen Gemeinwesen. Neben dem Bauholz brauchte eine Stadt das Werkholz. Die meisten Handwerke sind direkt oder indirekt vom Wald abhängig. Wir können sie gar nicht alle aufzählen, denn die Vielfalt der Waldnutzung ermöglicht erst handwerkliche Vielfalt, vom Wagner, der bestes astfreies Eichenholz verarbeitet, über den Drechsler, der aus Buchsbaum die Büchsen herstellt, bis hin zu dem meist armen Seiler, der, argwöhnisch von der Obrigkeit überwacht,128 den Bast abgeschälter Baumrinden verwertet. Weil Nägel zumeist aus Holz sind, versuchen Zimmermannsgesellen während der Winterruhe auf dem Bau, Eichennägel zu verfertigen, um ihr Leben zu fristen.129 Die Möbelherstellung steht keineswegs im Vordergrund, wie es von heutigen Verhältnissen ausgehend anzunehmen wäre. Tischler und Schreiner sind keine dominierenden Zünfte; denn sogar in den Wohnungen der Wohlhabenden stehen nur wenige Möbel, zumeist Erbstücke, die keinem raschen Modewandel unterworfen waren.
Selbst Handwerke, die auf den ersten Blick nichts mit dem Wald zu tun haben, sind doch indirekt von ihm abhängig. Zum Beispiel der Schuhmacher: Sein Arbeitsgerät, der sprichwörtliche Leisten, ist aus Holz. Seine Schusterzwecken stammen von der Hainbuche, deren Hartholz für viele technische Zwecke gesucht wird, von Schrauben bis zu den Radzähnen, Triebhämmern und Spulen der frühen Montanindustrie.130 Das Schusterpech wird aus dem Harz der Nadelwälder gewonnen und von den „Pechern“ sowohl zum mittelalterlichen Alleskleber als auch zum Universalschmiermittel weiterverarbeitet.131 (Wie im Falle der Wachstafeln haben wir auch jetzt Anlaß, auf die Bedeutung des Waldes für die Schriftkultur hinzuweisen: Harz wird, Terpentin ersetzend, für die Druckerschwärze benötigt.) Vor allem aber ist das Leder, das nicht nur die Schuhmacher, sondern die ebenfalls bedeutenden Gewerbe der Sattler, Beutler und Riemenschneider verarbeiten, ohne Holzprodukte nicht herstellbar. Die rötlichbraune Färbung des von den Rotgerbern hergestellten Leders stammt von der Eichenrinde, die als Gerbrinde von jungen Stockausschlägen im Niederwaldbetrieb gewonnen und in eigenen sogenannten Lohmühlen für die Gerberlohe zermahlen wird.132
Der Bedarf an Bau- und Werkholz ließ im Spätmittelalter eine frühe Industrie entstehen: die Sägemühlen. Sie seien hier stellvertretend als Beispiel dafür erwähnt, „daß der Großteil der Maschinen und Geräte, die am Vorabend der Industriellen Revolution in Gebrauch waren, dem Hoch- und Spätmittelalter entstammte“.133 Die Säge, beim Stand der hochmittelalterlichen Schmiedetechnik nur schwer herzustellen, blieb bis ins ausgehende 18. Jahrhundert ein der Waldarbeit fremdes Gerät: Bäume wurden mit der Axt geschlagen und bearbeitet.134 Die Axt galt deswegen über die Zeiten hinweg als Symbol der Nutzungsberechtigung am Wald.135 Das läßt die Bedeutung des frühen Industriezweiges abschätzen, der nur wegen des gestiegenen Bedarfs sich entwickelt, jedoch die hergebrachten Formen der Waldnutzung nicht grundlegend verändert hatte. Die Sägemühlen, die seit dem 14. Jahrhundert an Wasserläufen in der Nähe von Nadelwäldern entstanden – am frühesten auf deutschem Boden in Kirchheim/Teck und Pfaffenweiler bei Villingen, 1310 und 1314 erwähnt136 – stellten „Knarholz“, dünne Bretter her, ersetzten die Arbeit der noch mit Axt und Keil hantierenden „breder speltere“. Durch die Sägemühlen konnte das Bauholz, das zuvor nur mit dem Beil abgeschlichtet wurde,137 genau vierkantig zugeschnitten werden.138 Wo sich diese Betriebe ausbreiteten, wurden sie dem Wald so gefährlich, daß der Nürnberger Rat sie 1458, sofern sie nicht von alters her bestünden, verbieten wollte – und damit scheiterte: Zu groß war der Bedarf an zugeschnittenem Bau- und Werkholz.139
Bei allen sich gewerblich differenzierenden Formen des Rohstoffs- und Energieträgers Holz darf die Basis nicht übersehen werden. Die Brennholzversorgung war ein drängendes Problem, mit dem sich Stadtordnungen wie etwa die Heidelberger von 1471 einläßlich befassen mußten.140 Schon für das ausgehende Mittelalter galt vielerorts, was Ende des 16. Jahrhunderts bemerkt wurde, daß der arme Mann sich mehr um Brennholz als um das tägliche Brot sorgen müsse.141 Brennholz war so wichtig, daß die Frage der Energieeinsparung zum Thema wurde. Ein Chronist hält als bemerkenswertes Ereignis fest, daß es einem Erfurter Bürger 1447 gelang, beim Brauen die Hälfte des Heizmaterials einzusparen.142 Wo das Brennholz knapp und relativ teuer war, ist die spätmittelalterliche Badekultur in Stadt und Land nicht nur eine Frage der Hygiene.143 Diese saunaähnlichen Badestuben mit ihrem hohen Holzverbrauch dienten in kalten Zeiten auch dem Durchwärmen, waren Lebensbedürfnis für Knechte und Gesellen, denen damals kein Trinkgeld, sondern ein Badegeld gewährt wurde. In den Haushalten ihrer Meister nämlich konnte, wie allgemein üblich, nur eine Stube erwärmt werden. Selbst in Patrizierhäusern waren nur ein bis zwei Stuben beheizbar,144 aber dennoch verbrauchte ein solcher Haushalt für Ofen und Herd jährlich etwa 4 bis 6 Festmeter Holz.145
Regelmäßige Zufuhr von Brennholz oder Holzkohle war für viele Handwerke, für Schmiede, Brauer, Bäcker, Kerzengießer usw., existenznotwendig. Der Brennholzbedarf wird allenthalben seit dem 15. Jahrhundert kontingentiert,146 er sollte unter möglichster Schonung des Nutzholzes gedeckt werden, durch „liegendes Holz“ etwa, das Wind- und Schneebrüche hinterlassen hatten, durch „Schwachholz“, das im Wald verkauft wurde, durch „Leseholz“, dürre abgefallene Äste, die zumeist von Kindern und armen Frauen gesammelt wurden. Brennholz war allgemein von minderer Qualität, selbst dort, wo im wiederkehrenden Aushieb des stockschlägigen Unterholzes oder durch Köpfung von Hainbuchen und Weiden die Nachfrage befriedigt wurde.147 Kein anheimelndes Feuer wie in heutigen Kaminen brannte in mittelalterlichen Öfen, es stank in den geheizten Stuben. Die „besseren Leute“ versuchten mit Gewürzen, besonders beliebt war Thymian, die Gerüche zu mildern.
Ohne Holz kein Essen und kein Trinken. Holzschüsseln, Holzbecher. Und wo diese bei den Bessergestellten durch Irdenware ersetzt wurden, war erst recht der Wald vonnöten. Temperaturen von 880 – 930 ° C mußten die Brennöfen der Töpfer erreichen. Vor allem Eiche wurde gebraucht. Schon kündigt sich die Ressourcenproblematik an, wenn seit der Mitte des 12. Jahrhunderts immer häufiger Haselstatt des teurer werdenden Eichenholzes verwendet wird.148 Die Großtöpfereien im Rheinischen Vorgebirge waren ausgesprochene Waldfresser.149
Wo der Wald immer weiter durchlichtet wurde, wurde zugleich der Holzhandel immer wichtiger.150 Die waldarmen nördlichen Niederlande mußten den größten Teil ihres Werk- und Brennholzes importieren.151 (Selbst Holzschuhe kamen damals noch als westfälischer Exportartikel nach Holland.) Maastricht wurde ein Zentrum dieses Handels.152 Aus den Ardennen, die Petrarca als ein „Meer von Holz“ beschrieben hatte,153 und aus Westfalen, in kleineren Quantitäten selbst aus dem Schwarzwald (dem späterhin großen Reservoir an „Holländerbäumen“), wurde im 15. Jahrhundert Holz rheinabwärts geführt. Beträchtliche Mengen an Brettern, Balken und Stämmen passierten die Zollstätte Lobith.154 Eigene „Flotschiffe“ wurden für diesen Handel gebaut, relativ groß, weil ein „doirganck holts“, das übliche Maß für eine Partie, 24 m lang war. 155
Die einzige Möglichkeit zur Körperpflege in den Städten boten Badestuben: Hier die Illustration eines beheizten Bades (aus: Konrad Kyeser, Bellifortis, Büchsenmeisterbuch, Wenzelwerkstatt, Prag, 1405, Göttingen, Universitätsbibliothek).
Holz und Hering bilden die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufstieg einer spätmittelalterlichen Wirtschaftsmacht: Der Seehandel der Hanse war auch ein Handel mit Waldprodukten bis hin zu Asche und Teer, die – ohne Furcht vor weiten Entfernungen – selbst aus russischen Wäldern über Riga nach Westen verschifft wurden.156 So wichtig der rheinische Handel auch war, so konnte er doch nicht den immensen Holzbedarf Flanderns, der entwickeltsten europäischen Städtelandschaft neben der Lombardei, decken. Hansische Kaufleute nutzten die Marktchancen. Nachdem schon mit dem ausgehenden 13. Jahrhundert Export aus Wolgast, Anklam und Stettin mit ihrem waldreichen Hinterland bezeugt ist,157 werden riesige Holzmengen aus dem Düna- und Weichselgebiet, ja selbst aus Litauen von preußischen Städten, vor allem von Danzig,158 nach Flandern verschifft.159 Aber das reicht nicht. Hamburg wird zum Stapelplatz für alles elbabwärts angelandete Holz, das in großen Mengen für den Bau von Schiffen, Kähnen und Rudern („koggenbretter, kanenblocke, remenholz“) oder als Bauholz, wie die im ausgehenden 15. Jahrhundert berühmten Magdeburger Dielen, in den Niederlanden gebraucht wird.160 Der hansische Holzhandel kannte ein breites Sortiment von Qualitäten, von den überaus teuren Bäumen für die Schiffsmasten161 über das hochwertige „Wagenschoß“, das, für den Schiffsbau bestimmt, keine Risse aufweisen durfte, bis hin zum „Wrak-Holz“, das um die Hälfte billiger war als gute Ware.162 Am teuersten aber waren die aus preußischen Häfen verschifften Eiben, das beste Material für die Bogenmacher. So wichtig war der Handel mit diesem aus polnischen Wäldern stammenden Holz, daß 1404 der Deutsche Orden durch ein Ausfuhrverbot die englische Krone zu treffen trachtete;163 denn die weitberühmten englischen Bogenschützen, die „archers“, führten den Eibenbogen. Internationalität also: Eiben aus polnischen Wäldern, verfrachtet auf preußischen Schiffen, verkauft durch den hansischen Kaufmann, begründeten 1415 bei Azincourt den Sieg englischer Bogenschützen über die französische Reiterei.
Ohne den Wald hätte im sonnenarmen Mitteleuropa gar nicht das lebensnotwendige Salz gewonnen werden können. Um die im Spätmittelalter oft über 200 m2 großen eisernen Sudpfannen befeuern zu können, war eine enorme Energiezufuhr notwendig. (Erst Ende des 16. Jahrhunderts kamen die Gradierwerke auf, die den Bedarf an Brennmaterial milderten.) Durch Zuweisung ganzer Sudwälder, die im Niederwaldbetrieb bei möglichst geringen Umtriebszeiten bewirtschaftet wurden,164 konnte der Energiebedarf alpenländischer Salinen jahrhundertelang weitgehend – wenngleich temporäre Engpässe nicht ausschließend – gedeckt werden.165 Für jene Salinen hingegen, die nicht in der Nähe scheinbar unerschöpflicher Bergwälder lagen, war die Brennholzversorgung ein existentielles Problem. Raubbau zugunsten der Lüneburger Sudpfannen vernichtete schon im Spätmittelalter den Wald des Umlandes, gab der Lüneburger Heide ihr Gesicht.166 Nunmehr mußte das Holz selbst aus mecklenburgischen Wäldern in schwierigster Treidelflößerei elbaufwärts durch eigene Floßkanäle herangeführt werden.167
In enger Abhängigkeit vom Wald steht die seit dem 13. Jahrhundert unaufhaltsame, umweltverändernde Ausweitung von Technik und Industrie. Diese spätmittelalterliche „industrielle Revolution“168 war ohne die Ressourcen, ohne die Energiezufuhr aus dem Wald nicht denkbar.169 Und dabei zeigt sich ein Zusammenhang von Wald- und Wasserwirtschaft. Schwer genug war es vielerorts, vor allem in den bergbauintensiven Regionen, die Wasserräder, die Motoren früherer Zeiten, zum Laufen zu bringen. Teiche mußten aufgestaut, Gräben gezogen, unterirdische Wasserläufe genutzt oder hölzerne „Gefluder“ (Gerinne in Holzleitungen) an steilen Abhängen angelegt werden, um die Radstuben zu speisen. Bergbau und Montanindustrie erzwangen ein ausgeklügeltes System der Wasserwirtschaft.170
Das Innere einer Badestube in einer Illumination zu Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium (um 1470, Berlin, Staatsbibliothek).
Mit dem 14. Jahrhundert kündeten immer zahlreicher werdende Rauchsäulen der Kohlenmeiler von steigendem Energiebedarf.171 Außer dem Familiennamen Köhler erinnert heute fast nichts mehr an den einst so wichtigen Beruf, der so viele Kenntnisse, schon allein um die Luftzufuhr in den Meilern zu regulieren und Waldbrände zu verhüten, verlangte, und der dennoch schlecht entlohnt wurde. Obwohl großer Bedarf an Holzkohle bestand, war der Köhler sprichwörtlich arm.172 Das lag nicht zuletzt an den Arbeitsbedingungen. Im Winter war das Buchenholz aus möglichst dünnen Stämmen zu schlagen, und erst im Mai konnte nach dem Abtrocknen des Holzes mit der Errichtung des kegelförmig aus Scheiten aufgetürmten Meilers begonnen werden. Mit Rasenplaggen wird dieser abgedeckt; unter dauernder Bewachung muß er während der rund zehntägigen Brenndauer stehen. An der Blaufärbung des Rauches erkennt der Köhler, stets die Luftzufuhr regelnd, wie weit der Verkohlungsprozeß fortgeschritten ist. Nach etwa zehn Tagen hat der Meiler nur noch die Hälfte seiner ursprünglichen Größe. Jetzt beginnt der schmutzigste Teil der Arbeit. Mit einem Reißhaken wird die Holzkohle rund um den Meiler zum Abkühlen ausgelegt, ein etwa noch glühendes Stück mit Wasser gelöscht.173
Der Händler profitiert von der Knochenarbeit des armen Köhlers. Holzkohle wurde ein Massenartikel, transportiert auf langen hohen Wagen, die selten mehr als 330 kg fassen konnten und an deren Ende ein kippbarer Korb aus dichtem Weidengeflecht angebracht war.174 Dieser Korb stellte zugleich die Maßeinheit beim Verkauf dar. Der arme Köhler hatte am wenigsten davon, daß im Laufe des 15. Jahrhunderts die Preise für Holzkohle kräftig anstiegen.175
Bekannt war zwar die Steinkohle176 (schon um 1200 hatte im Lütticher Raum ihr Abbau begonnen), aber eine nennenswerte Rolle bei der Energieversorgung spielte sie nicht.177 Immerhin stellt es einen Indikator für die vielerorts sichtbar werdende Holzknappheit dar, wenn die im Tagebau gewonnene Steinkohle seit dem Spätmittelalter steigende, wenngleich nicht entscheidende Marktanteile gewinnt.
Holz und industrielle Revolution des Spätmittelalters: Bei der Verhüttung von Eisenerz war es schon Mitte des 13. Jahrhunderts zur entscheidenden Verbesserung gekommen, als die Rennfeuer mit offener Herdgrube durch die Stücköfen ersetzt wurden.178 Im Verlauf der nächsten Generationen sollte dann in Hochöfen die Menge der ausgeheizten Eisenluppen verdoppelt werden.179 Der Holzbedarf stieg gewaltig, bedurfte es doch etwa acht Tonnen Holzkohle (also ca. 30 Tonnen Holz), um eine Tonne Roheisen zu gewinnen.180 Mit der Intensivierung der Eisenverarbeitung wurden, von Flüssen oder aufgestauten Bächen getrieben, Mühlen zu Hammerwerken umgebaut. Auch sie hatten einen immensen Holzbedarf.
Die hochmittelalterliche Eisenverarbeitung war noch kein „Holzfresser“ gewesen.181 Ganz anders steht es mit der spätmittelalterlichen Montanindustrie. Holzknappheit hatte sie im Gefolge,182 was schon die Bildquellen des 16. Jahrhunderts sichtbar werden lassen.183 Bis zum Raubbau selbst in entlegenen Revieren reicht der Einfluß eines neuen Großabnehmers von Holz: die mit dem 15. Jahrhundert sprunghaft sich entwickelnde, in ihrer „städtebildenden Kraft“ aber zumeist überschätzte Montanindustrie.184 Für diese waren Wälder ein Standortfaktor.185 Anders als bei der weitgehend verrechtlichten Holznutzung, zu der die spätmittelalterlichen Städte gelangt waren, anders auch als bei den althergebrachten Privilegien und Nutzungsrechten der Salinen griff nunmehr das Großkapital der Montanherren in die durch keine vorangegangene Verrechtlichung geschützten abgelegenen Bergwälder ein. Diese wurden ungehemmt in einem bisher unbekannten Ausmaß abgeholzt. Überall dort, wo alte Rechte der Ausbeutung entgegenstanden, wurde nicht der Jurist, sondern der Münzmeister bemüht. Nur ein Beispiel: Bei dem sogenannten Abtrieb auf Stockraum186 pachteten Montanunternehmer für bestimmte Zeit ganze Reviere, lockten den in zersplitterten, kaum monetär rationalisierten Grundrenten kalkulierenden Adel mit plötzlichem Bargeldsegen und unterließen, allein am Holzertrag interessiert, die nur langfristig Nutzen bringenden Maßnahmen der Waldpflege.
Die sogenannte „industrielle Revolution des Mittelalters“ war genau besehen eine Evolution zu Lasten des Waldes.187 Obwohl dieser noch um 1400 zu zwei Dritteln aus Laubbäumen und nur zu einem Drittel aus Nadelholz bestand (heute hat sich das Verhältnis umgekehrt),188 obwohl er noch nicht von Monokulturen beherrscht war, so geriet er doch in höchste Gefahr. Ein Dauerproblem seit dem Spätmittelalter. (Die heutige Diskussion um den „Försterwald“ sollte dies nicht verkennen.) Einer zufällig überlieferten Nachricht des Jahres 1387 zufolge wurden in der Oberpfalz 175 000 Festmeter Holz im Jahr allein für die Hammerwerke verbraucht. 1348 standen die Hämmer im Forst Vilseck still, weil der Wald total ausgehauen worden war.189
Das frühmittelalterliche Waldesdickicht war im Laufe der Jahrhunderte weitgehend verschwunden. Wo es noch bestand, erregte es Erstaunen. Als 1415 Leonardo Bruni vom Reschenpaß ins Inntal hinabstieg, faszinierte ihn weniger die „Schrecken einflößende“ Bergwelt als der Holzreichtum, die „unglaubliche Menge an Tannen; ferner gibt es Kiefern, Zypressen, Eschen, Buchen und jegliche Art von Bauholz.“190 Bauholz. In dem Maße, in dem die Bevölkerung wuchs, verringerte sich der Wald.