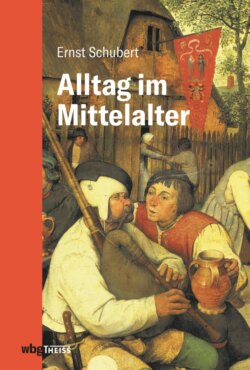Читать книгу Alltag im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеNatur und Geschichte: Die Sorge um die Zukunft, sei es um die von lokalen Ökosystemen oder gar die der Erde, beherrscht die ökologische Diskussion der Gegenwart; die historische Dimension jedoch kommt in dieser Diskussion zu kurz. Und oft wird die Vergangenheit schlichtweg entweder als Kronzeuge für eine frühere heile Welt in den Zeugenstand berufen oder aber wegen früheren Raubbaus auf die Anklagebank gesetzt. Und selbst der Hinweis auf die Klimageschichte kann an dieser Aussage nichts ändern. Witterungsdaten werden in der Öffentlichkeit nicht in ihren historischen Voraussetzungen, sondern in ihren Auswirkungen auf die Gegenwartsprobleme diskutiert, die widersprüchlichen, Sorgen erregenden oder Sorgen beschwichtigenden Daten werden stets auf die Gegenwart und die ihr zugeordnete Zukunftserwartung projiziert.
Die Geschichte war nie dazu nutze, Rezepte für die Gegenwart zu liefern, ihre Aufgabe liegt in der Präzisierung der zentralen gegenwärtigen Fragen, indem sie diesen Fragen nicht nur in ihrem Werden, sondern auch in ihren gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen nachgeht. Das kann nie zu einer direkten Ableitung der Gegenwart aus der Vergangenheit führen, sondern zu einer Art Dialog mit den nunmehr toten Menschen, die in ihrer Gegenwart ebenfalls Antworten auf die gleichen Grundsatzfragen finden mußten. Weltgeschichtlich ist, aus der Perspektive von Natur und Geschichte gesehen, Europa ein begünstigter Kontinent,1 weit weniger von Witterungs- und Naturkatastrophen gefährdet als etwa der südasiatische Raum, in dem im 15. Jahrhundert etwa 80% der Weltbevölkerung lebten.2 Erdbeben beispielsweise hatten im spätmittelalterlichen Europa schlimme, die Menschen zutiefst erschreckende Folgen, und doch wirkten sie bei weitem nicht so verheerend wie etwa in Ostasien.3
Selbst wenn die Natur den von ihr eher begünstigten europäischen Kontinent nicht so heimsuchte wie andere Regionen der Erde, bleibt uns auch hier die Aufgabe, nach dem Verhältnis von Natur und Geschichte zu fragen. Mit Recht warnte Arno Borst davor, die historischen Erfahrungen auszublenden: „Natur ist immer auch die erschütterte Welt, Geschichte immer auch das Unvorhersehbare und Unbewältigte.“4
Grundsatzfragen sind – und hier greifen wir das Stichwort der gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge wieder auf – allen Eiferern zum Trotz in ihrer Komplexität stets historisch fundiert und dabei noch nicht einmal in historischem Spartendenken, etwa sozialgeschichtlich, isolierbar. Was in der Gegenwart im Nebel der Nebensächlichkeiten, den jede erregte Diskussion aufsteigen läßt, schwer zu erkennen ist, klärt der Rückblick in die Vergangenheit. Wenn wir zuspitzend und damit übertreibend formulieren, daß das, was sich heute als Kampf um die Natur darstellt, in früheren Zeiten ein Kampf mit der Natur war, so ist mit dieser Überspitzung nicht etwa ein simples Konstrukt von der Eigenständigkeit der Moderne gegenüber einer abgelebten Geschichte benannt, sondern das genaue Gegenteil: Die Fragen mögen neu anmuten (was die wirklich wichtigen Fragen allerdings niemals sind), aber der Fragende ist selbst bis in seine Wahrnehmungsmuster hinein abhängig von der Geschichte. Das gilt unter anderem auch für die sozialgeschichtlichen Abhängigkeiten. Ein Beispiel unter vielen: Selbst der in Umweltfragen engagierteste Lehrer muß anerkennen, daß die Freiheit seiner Argumentation nicht nur ihm selbst, sondern auch der Entwicklung des Lehrerstandes vom Gemeindediener des 18. zum Staatsbeamten des 19. Jahrhunderts geschuldet ist. Abhängigkeiten der individuellen Urteile von der Geschichte: Der Atheist, der die Natur mit einem emotionalen Wert ausstattet, fragt nicht anders als viele gläubige Philosophen und Theologen des Mittelalters und noch der frühen Neuzeit. Und schließlich: Ist der Naturwissenschaftler, der die Entstehungsbedingungen des Lebens enträtselt, in seinen Fragen (natürlich nicht in seinen Ergebnissen) so weit entfernt von den wahrhaften Alchemisten, die nach dem Stein der Weisen suchten, nach jenem Stein, der nicht in der Natur gefunden, sondern nur aus seinem von der Natur erbauten Gefängnis erlöst werden muß?
Bei allen im Laufe der Geschichte hervortretenden Unterschieden in der Auseinandersetzung mit der Natur ist doch eines, gewissermaßen das überzeitliche Moment, gleich geblieben: Es geht immer um eine Relation, um den Menschen im Verhältnis zu seiner Umwelt. So unterschiedliche Fragen der Fragende stellt, so unterschiedlich auch im Verlauf der Zeiten seine Antworten ausfallen mögen, er bleibt stets derjenige, der die Umwelt als ‚Gegenstand‘ wahrnimmt. In Anführungsstriche haben wir ‚Gegenstand‘ gesetzt, um auch, auf den unmittelbaren Wortsinn zurückgreifend, diejenigen einzuschließen, die, wie etwa Prinz Charles, mit den ihnen anvertrauten Pflanzen sprechen. Ob mit der Natur, ob über die Natur, ob für die Natur gesprochen wird, ist der grundsätzlichen Frage untergeordnet, ob der Mensch tatsächlich der Herr über die Geschichte ist oder ob diese nicht als emergentes Phänomen einen Seitentrieb der Evolution darstellt.
Das Alter der Erde ist sicherlich die umfassende, jede andere Erscheinungsform von Geschichte umschließende Größe, sie umgreift, vom Menschen allenfalls berechenbar, aber nicht erfaßbar, ganz andere zeitliche Dimensionen als die kurze Historie des Menschen. Dessen Geschichte ist zwar auch in Vergesellschaftung zum Beispiel mit Insekten als Populationsgeschichte eines Planeten denkbar, aber wo im Weltall will man den archimedischen Punkt finden, von dem aus sie beschreibbar wäre? Wir wollen uns nicht zur Geschichtsphilosophie aufschwingen, sondern nur die Gründe dafür andeuten, daß das Thema Natur und Geschichte nicht von einer absoluten Setzung des Begriffs ‚Natur‘ her behandelt werden kann. Indem wir von einem Beziehungsverhältnis ausgehen, das wir bisweilen sogar als dialogisch charakterisieren können, sehen wir ‚Natur‘ nicht als eine mit modernen wissenschaftlichen Methoden objektivierbare, sondern als geschichtlich wandelbare Größe an. Denn – nur ein Hinweis – auch ohne Eingriffe des Menschen kann sich die Naturlandschaft verändern,5 und „anthropogene und natürliche Faktoren beeinflussen sich gegenseitig.“6 Was aber die anthropogenen Veränderungen der Oberflächengestalt der Erde angeht, ist vor einfachen Deutungsmustern zu warnen. Obwohl auch das Mittelalter bis zum Raubbau führende Übernutzung der naturgebundenen Ressourcen kennt, würde es eine Erkenntnis hindernde Verkürzung bedeuten, eine durchgängige Linie des Umweltfrevels bis zur Gegenwart ziehen zu wollen.
Was ist ein Naturzustand?7 Natur ist trotz der mit ihr verbundenen Assoziationen an Ursprünglichkeit, an Unverfälschtheit zu keiner Zeit der Gegensatz zu Kultur und Geschichte, Natur ist Teil von Kultur und Geschichte. Die Gefahr für den Historiker liegt darin, daß er nicht wie etwa ein Geologe Natur als absoluten Faktor setzen kann.8 Ebensowenig wie ‚Natur‘ ist ‚der Mensch‘ eine konstante historische Größe (und das gilt auch wortwörtlich).9 Daß die Anthropologie nicht nur ein naturwissenschaftlicher, sondern auch ein geisteswissenschaftlicher Gegenstand ist, daß der Mensch nicht nur von seinen Genen, sondern auch von seiner Geschichte ‚programmiert‘ ist, wird in der modernen Geschichtswissenschaft immer wieder hervorgehoben.10 Die Zeitschrift „Historische Anthropologie“ hat sich inzwischen als unverzichtbares Periodikum erwiesen. Wir haben nur deshalb Anlaß, an Selbstverständliches zu erinnern, weil hier die Rechtfertigung dafür liegt, daß wir zwei äußerlich verschiedene Themen in einem Buch zusammenbinden: die Formen und den Gestaltwandel des Umgangs von Menschen mit der Natur und die Formen und den Gestaltwandel des Umgangs von Menschen miteinander.
Die heutige Umwelterfahrung ist selbst ein historisches Produkt, das aus geschichtlichen Zusammenhängen von Kulturentwicklung und Naturwahrnehmung ebenso hergestellt worden ist wie von Erinnerung prägenden topischen Bildern, von Einstellungsmustern, also etwa von der Wildnis als Topos und Realität oder von der Künstlichkeit des Kanalbaus als eines Eingriffes in die Natur. Viele beunruhigende Diskussionsflächen bietet die übereinandergeschichtete Tektonik der verschiedenen, im Verlauf der Jahrhunderte abgelagerten Wahrnehmungen. Wenn wir diese für das Mittelalter zu beschreiben versuchen, so gilt es stets, die Terminologie zu überprüfen; denn diese steckt voller historisch begründeter Tücken. Das gilt nicht nur für die Wortwahl im konkreten – was ist eigentlich „Wald“? –, das gilt selbst für die zumeist leichthin gebrauchten Grundbegriffe. „Ökologie“ zum Beispiel hatte in der Antike noch ein nahe an der „Ökonomie“ angesiedeltes Wortfeld: Kunde vom Haushalten.11 Die Antike kannte zwar von der Wasserverschmutzung bis zur Müllabfuhr Probleme und Lösungen, die modern anmuten, aber sie hatte keinen Begriff für „Umwelt“,12 den sie künftigen Epochen hätte vererben können. Diesen Begriff können wir auch nicht sorglos für das Mittelalter anwenden, weil er eine eigentümliche Karriere hinter sich hat: Um 1800 als poetische Wortschöpfung entstanden,13 sodann zumeist als Synonym für ‚Milieu‘ verwendet, gewann er seinen heutigen Sinn erst in der jüngsten Vergangenheit, und zwar auffallenderweise nicht über seine Grundform, sondern über seine Komposita wie Umweltverschmutzung und Umweltschutz.14 Diese Begriffsgeschichte erklärt, warum es bis heute keine einhellig akzeptierte Begrifflichkeit von „Umwelt“ und „Umweltgeschichte“ gibt15 und warum im heutigen Verständnis der Mensch nicht mehr Teil seiner Umwelt ist, die nicht einmal mehr als sein Milieu begriffen wird.16 Nachdem ‚Umwelt‘ zum Synonym für eine anthropozentrisch definierte ‚Natur‘ verflacht ist,17 kann die Feststellung nicht überraschen: „Die Umweltgeschichte ist sich nicht einmal ihres Gegenstandes sicher. Umwelt hatte für die Menschen verschiedene Gesichter, quer durch die Zeiten, Räume und sozialen Schichten.“18 Mit ihr waren einst – anders als im Zeitalter der bemannten Raumfahrt – Sonne, Mond und Sterne eng verknüpft.
Wie auch in anderen Fällen, etwa bei dem im Mittelalter begrifflich noch gar nicht vorhandenen ‚Staat‘, gilt es im Falle einer Geschichte der ‚Umwelt‘ abzuschätzen, was anachronistische Setzung ist und was von der Sache her vorhanden sein kann, wenngleich vielleicht nur in Ansätzen und terminologisch nicht fixiert. Obwohl frühere Zeiten den Begriff ‚Umwelt‘ im heutigen Sinne gar nicht kennen, so kennen sie doch selbstverständlich die gedankliche Objektivierbarkeit des eigenen Lebensraumes, und genaue Beobachter können bereits den Wandel dieses Lebensraumes wahrnehmen. Um 1300 notiert ein Colmarer Dominikaner die großen Veränderungen, die das Elsaß in den letzten einhundert Jahren durchgemacht habe.19 Diese früheste Beschreibung eines Kulturlandschaftswandels in deutschen Landen enthält bereits Ansätze dessen, was später ökologisches Bewußtsein genannt werden wird. Diese erstaunliche Quelle zeugt von naturwissenschaftlicher Schulung und damit auch von dem Nachwirken des Albertus Magnus als Lehrerpersönlichkeit.20 Das genaue Beobachten, das er seinen Naturstudien zugrunde legte, wird er, der so häufig in den Studienhäusern seines Ordens unterrichtete, auch seinem Colmarer Ordensbruder vermittelt haben.
Eine Umweltgeschichte im modernen, im engeren Sinn des Begriffs liegt ebensowenig in unserer Absicht wie der Versuch einer historischen Geographie.21 So unverzichtbar die Einbeziehung naturwissenschaftlicher Ergebnisse ist, so besteht dabei immer die Gefahr der Perspektivenverkürzung; denn es geht dem Historiker nicht um die Umwelt im Sinne einer dem Menschen gegenüberstehenden Gegebenheit, sondern – wie wir es hilfsweise nennen – um den historischen Dialog des Menschen mit der Natur.
Kehren wir zu unserer einleitenden Feststellung zurück, daß in der heutigen ökologischen Diskussion die historische Erfahrung ‚Umwelt‘ kaum berücksichtigt wird,22 so hat dies auch mit den eingangs erwähnten gesamtgesellschaftlichen Ursachen zu tun. Diese sind normalerweise nur mit umständlich langatmigen Ausführungen zu belegen. Unglücklicherweise aber gibt es ein schlagendes Beispiel, das uns – wir bedauern es – dieser Notwendigkeit enthebt, weil die Wolken und Nebelschwaden der Diskussion um die gesamtgesellschaftlichen Ursachen bei der anhaltenden Trockenheit bürokratischer Verordnungen und administrativer Verfügungen in den entsprechenden Problemfeldern sich gar nicht erst bilden können: Skandalös wird die Geschichte des Mittelalters im Unterricht deutscher Schulen verkürzt. Die Schüler erfahren nicht mehr, daß vor der trennenden Entwicklung von Nationalstaaten dauerhaftere Grundlagen einer gemeinsamen europäischen Kultur gelegt worden waren. Baukunst, Recht, Philosophie des Mittelalters sind nur aus europäischer Perspektive zu erfassen. Bei allen Nuancen sind sich die Lehrpläne der deutschen Bundesländer doch darin einig: Die Stadt ist zu behandeln; in den meisten Lehrplänen stellt sie den einzigen Unterrichtsstoff für die Zeit zwischen 800 und 1500 dar.23 Ein aufschlußreiches Zeugnis für die Arroganz im Umgang mit der Vergangenheit.
Die Stadt ist zwar für den Menschen der neuesten Zeit zum wichtigsten Erfahrungsraum geworden, für das Mittelalter jedoch, in einer Zeit, in der über 85 Prozent der Bevölkerung auf dem Lande lebten, bildet sie eine Ausnahme. Was die Schüler lernen sollen, ist nicht nur in der Auswahl problematisch, sondern auch in der Art, wie nach den Vorstellungen von Ministerialbürokraten der Gegenstand behandelt werden soll: ein dröges Gemisch aus Verfassungs- und Sozialgeschichte. Selbst die Chance wird vertan, den Sonderfall der Stadt, in der sich auf engstem Raum allgemeine, und damit aktuelle Probleme im Verhältnis des Menschen zur Natur, zu Wasser und Wald konkretisieren, didaktisch zu nutzen.
Wir haben nicht die Absicht, die Lehrpläne zu ergänzen – diese sind so grottenschlecht, daß eine Verbesserung aussichtslos ist. (Es ist schließlich eine systembedingte Art von administrativer Weisheit, sicherheitshalber die vom Steuerzahler besoldeten Professoren nicht zur Beratung solcher Pläne heranzuziehen.) Aber es sind nicht nur die Lehrpläne, die den Blick auf die Vergangenheit verstellen, es sind auch unsere sauberen Museen und die um sorgfältige Restaurierung etwa des Fachwerkhaus-Bestandes besorgten Denkmalpfleger, die eine Stadt herausputzen und damit nicht nur vergessen lassen, daß der Fachwerkbau in der frühen Neuzeit als Billigbau galt. Verschleiert wird – allerdings notwendigerweise – das Alltagsproblem einer mittelalterlichen Stadt, der Dreck. Anders als im Fall der Lehrpläne kritisieren wir natürlich nicht Denkmalschutz und Museen. Es wäre eine auf die Spitze getriebene Historisierung, wollten wir verlangen, daß in sauberen Museen der Dreck sinnlich erfahrbar wäre, daß ein Marktplatz nicht in dem Glanz stabiler Häuser erstrahlen, sondern immer ein baufälliges Haus und einen abschreckenden Gefangenenblock aufweisen müsse. Die künstliche Inszenierung der Vergangenheit ist unvermeidbar; sie bedarf aber des Wissens von den im Interesse der Gegenwart diktierten Bedingungen dieser Inszenierung.
Naturgemäß hat es die junge Umweltgeschichte schwer, sich im Kreis der älteren historischen Spezialwissenschaften zu etablieren. Weiterhin ist sie sich ihrer Methoden noch keineswegs sicher,24 was angesichts des universalgeschichtlichen Gegenstands auch keineswegs verwundert. Beides bietet aber auch Chancen. Die Umweltgeschichte darf sich als junger Wissenschaftszweig noch ungebärdig geben, darf Ansätze verfolgen, die in älteren Wissenschaftszweigen, die sich zur ‚Disziplin‘ verfestigt haben, verpönt sind. Joachim Radkaus unter modischem Titel verborgene Weltgeschichte der Ökologie, welche alle historischen Epochen und alle fünf Kontinente behandelt,25 ist das wohl gelungenste Beispiel für das Nutzen dieser Chancen. Zugleich zeigt Radkau die Gefahren für den jungen Wissenschaftszweig auf. Von der Zeitgebundenheit zahlreicher Fragestellungen in der heutigen Diskussion ganz abgesehen,26 ist die Umweltgeschichte auf das engste mit Zweigen anderer Wissenschaften verflochten, mit denen der Naturwissenschaft von der Biologie bis zur Historischen Geographie, mit denen der Geschichtswissenschaft von der Alltags- bis zur Religionsgeschichte.27 Überfordert wäre jeder, der sich anheischig machen wollte, als einzelner Umweltgeschichte in all ihren methodischen Anforderungen schreiben zu wollen. Unverzichtbar ist also neben dem intellektuellen Vagantentum Joachim Radkaus28 auch das intellektuelle, seßhafte Kleinbauerntum des Spezialisten, und gerade deshalb braucht eine historisch fundierte Ökologie auch denjenigen, der wie ein städtischer Bote des Mittelalters die Verbindungen zwischen den verschiedenen Kommunen, aber auch zwischen Städten und Fürsten herstellt. Als ein solcher Bote versteht sich der Verfasser dieses Buches; er versucht zwischen den verschiedenen Disziplinen zu vermitteln.
Vermittlung zwischen Disziplinen. Läßt sich die Geschichte, von den notwendigerweise unterschiedlichen Forschungsstrategien einmal abgesehen, in verschiedene Erkenntnisziele etwa zwischen Agrar- und Mentalitätsgeschichte aufspalten? Nüchtern stellte Arno Borst den Zusammenhang zwischen diesen beiden Disziplinen her: „Die Böden mußten schon kultiviert sein, wo man die Köpfe kultivieren wollte.“29 Ein weiteres einfaches Beispiel: Die Umweltgeschichte hat eine große Schnittmenge mit der Sozialgeschichte.30 Schließlich sind es einfache Menschen, die Wälder roden, die Sümpfe entwässern, Angehörige des Volkes, das den Herren gleichgültig ist, „des volkes, des man nicht enaht.“31
Das ambitionierte Bemühen um Vermittlung zwischen wissenschaftlichen Disziplinen verlangt, um nicht an der eigenen Ambitioniertheit zu scheitern, Beschränkungen. Deshalb haben wir unsere Untersuchungen auf den deutschen Sprachraum begrenzt. Diese Begrenzung hat auch den Sinn, der Gefahr der Beliebigkeit in der Faktenauswahl und damit der Gefahr der Manipulation zu begegnen. Obwohl wir ein Thema der europäischen Geschichte anschlagen, würde doch eine Berücksichtigung des gesamten Kulturraums den Verdacht nähren, eine subjektive Problemauswahl vorgenommen zu haben, ein Verdacht, den wir nicht einmal bei der Untersuchung der deutschen Lande selbst bei möglichst detaillierter Darstellung völlig ausräumen können.
Den Dialog mit der Natur in historischer Perspektive darzustellen, haben wir als unsere Aufgabe beschrieben. Hinter dieser Formulierung verbergen sich folgende Probleme: Was ist in einer nichtschriftlichen Gesellschaft, genauer: in einer Welt des alltäglichen Lebens vor der Schrift ein Dialog, und wer sind die Partner dieses Dialogs? Anthropologisch verstanden ist diese Frage zuerst die nach der Raumerfahrung, die wir in Hinsicht auf den historischen Raum zunächst für das frühe Mittelalter verfolgen werden. Dabei sind wir durch die Quellen gezwungen, im Widerspruch zu unseren Vorsätzen ‚den Menschen‘ als kollektiv handelndes Subjekt zu fingieren. Es wäre aber unredlich zu verschweigen, daß es auch einen gewissermaßen individualistischen Forschungsansatz gibt. Von der Körpergeschichte ausgehend, konnte August Nitschke die mittelalterlichen Wahrnehmungsweisen von Umwelt herausarbeiten, wobei von grundsätzlicher Wichtigkeit ist, daß diese Wahrnehmungsweisen nach sozialem Status unterschiedlich ausfallen.32 Die Rekonstruktion der Gebärdensprache stellt ein stummes Erzählen dessen dar, was die Quellen ansonsten verschweigen.
So faszinierend die von August Nitschke eröffneten Perspektiven sind, so können wir diese doch mit unserem Ansatz nicht weiterverfolgen; denn es geht uns weniger um die individuelle Erfahrung, sondern um jene Gestaltungen, die aus natürlichen Gegebenheiten historische Räume entstehen lassen,33 also nicht um Zeremonien oder Tänze, sondern um Bäume oder Gewässer. Der Hinweis auf einen anderen möglichen Forschungsansatz sollte auch eine Begrenzung unserer Untersuchung benennen. Die von uns gefällten Aussagen vertragen im einzelnen durchaus jene Differenzierungen, welche zum Beispiel die hier stellvertretend für andere moderne Ansätze benannte Körpergeschichte eröffnet.
‚Stummes Erzählen‘ rekonstruiert die Körpergeschichte, ein stummes Erzählen aber bildet zum Beispiel auch die Geschichte des Waldes, wobei der Mensch nicht als Individuum, sondern als kollektiver Sammelbegriff verstanden wird. Die Setzung eines Kollektivums ‚Mensch‘ kann – wir nehmen Zuflucht zu einer Grunderkenntnis der mittelalterlichen Philosophie – nicht ohne die Definition der Essenz dieses Kollektivbegriffes auskommen, also nicht ohne Berücksichtigung dessen, was ‚Menschheit‘ ausmacht: die Sprachfähigkeit. Noch Luther sah ganz in mittelalterlicher Tradition allein in der Sprache das Geschenk, mit dem Gott den Menschen vor anderen Kreaturen bevorzugte.34 Aber: Wir dürfen gar nicht darum herumreden, daß wir gar nicht mehr wissen können, was Menschen im Alltag früherer Zeiten so herumredeten. Nur indirekte Aufschlüsse über die Rahmenbedingungen sind möglich. Ein direktes, ein sogar wortreiches Erzählen liegt dem gewissermaßen klassisch zu nennenden Ansatz zugrunde, mit dem die hochmittelalterlichen Naturerfahrungen des Adels am Beispiel der höfischen Dichtung dargestellt werden können.35 In der Ausgestaltung der „curialitas“, der höfischen, als vorbildlich gesetzten Lebensnormen, begegnet erstmals ein zivilisatorisches Spannungsverhältnis zur Ursprünglichkeit, zur Natur. Aber auch hier beschleicht uns ein Unbehagen. Wieweit können literarische Aussagen repräsentativ für eine Welt vor der Schrift sein? Mit theoretischen Vorentscheidungen allgemeiner Art wird man der bewundernswerten, ja staunenswerten Flexibilität mittelalterlichen Erfahrungshungers nicht gerecht. Immer wieder werden wir im Einzelfall Beweise dafür finden, daß literarische Fiktionen durchaus kollektive Bewußtseinslagen wiedergeben können; aber Handreichungen im Sinne einer strikt anzuwendenden Methode bei der alltagsgeschichtlichen Auswertung literarischer Quellen getrauen wir uns nicht zu geben.
Während für das frühe und selbst noch für das hohe Mittelalter nur auf indirekten Wegen Aufschlüsse über Naturerfahrungen möglich sind, liegen für das spätere Mittelalter direkte Zeugnisse vor. Quellen gibt es jetzt, die, da um Welten von dem intellektuellen Niveau der Gelehrten entfernt, gerade deshalb alltagsgeschichtlich interpretierbar sind. Reiseschilderungen gehören zu solchen direkten Zeugnissen, Quellen, die aber nicht einfach als Abbildungen einer vergangenen Wirklichkeit verstanden werden können.36 Sie belegen allerdings realitätsnah, welche Umwelterfahrungen sich mit der Mobilität, dem „Fahren“, ohne das die mittelalterliche Gesellschaft nicht überlebensfähig gewesen wäre,37 verbinden. Auch wenn das Goethe-Wort schon für die frühen Reisewahrnehmungen Gültigkeit hat, wonach der Mensch nur das sieht, was er weiß, wenn also die Wahrnehmung der Landschaft von Bildung und Interessen und damit von kulturellen Traditionen abhängig ist, so zeigt sich doch – nicht zuletzt wegen des spätmittelalterlichen Urbanisierungsvorgangs, der Verstädterung von Kultur –, daß Natur in ihrem Eigenwert nicht nur theoretisch erkannt, nicht nur in ihren Gefahren gefürchtet, nicht nur in ihren Chancen für den Menschen ausgenutzt, sondern in ihrem Eigenwert im wörtlichen Sinne „erfahren“ wird, denn „wandern“ heißt im Mittelalter „fahren“.38
Nur andeuten können wir die immer nur im Einzelfall zu lösende grundsätzliche Schwierigkeit, daß viele Quellen, die wir auf einen Wandel des Umweltbewußtseins hin befragen, selbst bereits Produkte eines solchen Wandels sind. Die Scylla eines anachronistischen Durchgriffs nach Maßgabe heutiger Fragestellungen droht ebenso wie die Charybdis selbstgenügsamer Historisierung. Die Untersuchung des Rechts, welches – wenngleich oft verspätet – auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert, ist wohl am geeignetsten, sowohl einer anachronistischen als auch einer historisierenden Betrachtungsweise vorzubeugen. Die im Werden begriffene Umweltgeschichte39 sollte nicht den Fehler der Geschlechtergeschichte wiederholen, die Rechtsgeschichte auszuklammern, jenen Fehler, den wir auch bei der Forschungsrichtung zur sogenannten „kulturwissenschaftlichen Wende“ befürchten. (Die Übernahme einer Terminologie des modernen Schwimmsports sollte nicht dazu führen, die bereits seit über zweihundert Jahren durchmessenen Bahnen der Rechtsgeschichte zu übersehen; denn auch der Schwimmer interessiert sich im nachhinein für die Zeit, für die Ergebnisse auf der ersten Bahn, bevor er die Wende vollzog. Daß auch Historiker neuen Zeiten entgegenschwimmen, ist nur natürlich; aber Bestmarken werden nur erreicht, wenn man die Wende als integralen Bestandteil der zurückgelegten Bahnen versteht.) Sowohl die Geschichte der Umwelt als auch die des Umgangs von Menschen weisen auf das große überzeitliche Thema der Willkürbegrenzung als Grundlage allen zivilisatorischen Fortschritts zurück. Deshalb mag hier ein Hinweis ausreichen, um die Bedeutung zu begründen, die wir der Rechtsgeschichte für unsere Untersuchung einräumen. Sie zeigt unter anderem, daß das Thema Mensch und Umwelt nicht von der Frage des Herrenrechts am Menschen abzutrennen ist. Mit Spott, in dem Zorn erkaltet war, hatte Mitte des 13. Jahrhunderts der berühmte Spruchdichter Freidank die Ausdehnung hochadeliger Herrschaftsansprüche auf die natürliche Umwelt der Menschen gescholten: Gewaltsam ziehen die Fürsten Felder, Berge, Gewässer und Wälder an sich. Sowohl die wilden als auch die Nutztiere wollen sie ihrer Herrschaft unterwerfen. Am liebsten würden sie selbst die Luft, die doch ebenfalls allen Menschen gehört, beanspruchen. Könnten sie uns den Sonnenschein, Wind und Regen vorenthalten, müßte man ihnen den Nutzungszins in Geld aufwiegen. „die fürsten twingent mit gewalt / velt, stein, wazzer unde walt, / dar zuo beidiu wilt unde zam; / si taeten lufte gerne alsam, / der muoz uns doch gemeine sîn. / möhten s’uns der sunnen schin / verbieten, ouch wint unde regen, / man müeste in zins mit golde wegen.“40
Die Geschichte des Rechts bildet unter anderem die methodische Klammer, mit der diescheinbar so disparaten Sachverhalte vom Umgang der Menschen mit der Natur und vom Umgang der Menschen miteinander zusammengehalten wird. Das Recht ist im Verständnis des Mittelalters noch nicht aufgespalten in die verschiedenen Disziplinen vom Straf- bis hin zum Urheberrecht. Das Recht ist ein Wert an sich; ein Wert, der zwischen Gott und den Menschen steht. Statt ausufernder Diskussionen: eine Welt, in der das Sprichwort entstehen konnte, „das Recht ist barmherziger als wir sind“,41 eine solche Welt, in der „ê“, also Ehe, sowohl das Alte und Neue Testament als auch die Lebensgemeinschaft zwischen zwei Menschen bezeichnen konnte, eine solche Welt ordnet das Recht nicht den „Juristen“ zu – eine bezeichnenderweise erst im 15. Jahrhundert als Selbstbezeichnung der einschlägigen Experten sich durchsetzende Bezeichnung.42 Das Recht gestaltet den Alltag. Dies ist die Klammer unserer beiden Ansätze. Das Recht gestaltet die Waldnutzung, den Umgang mit der Natur, das Recht gestaltet den Umgang der Menschen miteinander.
Es ist keineswegs hergeholt und nur sprachlicher Zufälligkeit zu verdanken, wenn wir den Umgang mit der Umwelt gemeinsam mit dem Umgang von Menschen untereinander in das Gedächtnis zurückrufen. Zum Beispiel kann das, was die Individualität eines Menschen ausmacht, durch sein persönliches Verhalten ebenso bestimmt sein wie durch seinen Lebens- und Erfahrungsraum. Familiennamen erinnern daran: Der „Steinacker“ hat es schwerer, seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, als der „Dinckelacker“, auf dessen Feldern die feine Weizenart gedeiht. Und weiterhin: „Persönliche“ Namen tragen nicht nur Menschen, sondern zum Beispiel auch Brunnen. Den Tieren werden menschliche und das meint: naturgegebene Eigenschaften zugesprochen, der störrische Esel kann dem störrischen Nachbarn entsprechen. Erst der moderne Ordnungssinn trennt Zusammenhänge einer Welt, in der selbstverständlich der Mitmensch zu dem gehörte, was wir heute als „Umwelt“ bezeichnen.
Unser wichtigstes Argument für das Zusammenfassen zweier scheinbar nicht zusammengehöriger Themen. Eine Geschichte der Umwelt ist nie von der Geschichte menschlicher Arbeit abzutrennen.43 Im Mittelalter ist der Zusammenhang von Arbeit, Überleben und Umwelt zu eng, als daß kollektives Handeln von Menschen in ihrer Umwelt unabhängig von der Frage ihres Umgangs miteinander behandelt werden könnte. Umwelt und Umgang. Wer zum Beispiel ein Kunstwerk bewundert, möchte auch wissen, wer es geschaffen hat, wie er fühlte, dachte, lebte. Nichts anderes tun wir. In Bewunderung von Leistungen, die mit nur geringen technischen Hilfsmitteln im wesentlichen mit der Hände Arbeit erschaffen wurden (der teure Kran ist eine Sehenswürdigkeit,44 und auch er ist technisierte menschliche Hand), in dieser Bewunderung der Leute, die Bäume – ohne Säge – entästeten und ausrodeten, die Deiche errichteten, Flüsse eindämmten, Holzbohlen in sumpfigen Untergrund rammten, in dieser Bewunderung alltäglicher Qual, die Steine von den Äckern zu entfernen – die Steinlesehaufen, die der Kundige am Rande heute überwaldeter mittelalterlicher Wölbäcker noch finden kann,45 mahnen ihn, nicht nur an die Qualen beim Bau der Pyramiden zu denken, wenn es um Menschheitsleistungen geht –, in dieser Bewunderung schließlich – wir wollen die Baedeker-Geschichte nicht ausschließen – für die Steinmetzen, die Kirchen bauten, die Hilfsarbeiter, die Wände flochten – wie widerspenstig kann der Zweig einer Weide sein –, in dieser Bewunderung wollen wir nicht bei dem am Schreibtisch leicht auszustoßenden Seufzer stehenbleiben, wonach das Mängelwesen Mensch doch zu erstaunlichen Leistungen fähig ist. Das, was allen zivilisatorischen Rückschlägen zum Trotz als Fortschritt in der Geschichte bezeichnet werden kann, ist nur zu einem geringen Teil Verdienst großer Persönlichkeiten, ist in der Hauptsache kollektive Leistung von Leuten, die um ihr Überleben kämpften. Nur dank der Arbeit dieser Menschen kann ich achtlos an steinbereinigten Ackerfluren vorbeigehen, kann ich mein ästhetisches Bedürfnis bei der Raumwirkung von Hallenkirchen ausleben (wie viele Unfälle in schwindelnder Höhe mag es wohl auf den Gerüsten gegeben haben?), kann ich Straßen befahren, die mehrheitlich erstmals im Spätmittelalter angelegt worden waren. Und schließlich lebe ich nur deshalb, weil unter den Gefahren von Armut und Not der Überlebenswille unzerstörbar war.46 Es ist – zugegebenermaßen unwissenschaftlich – einfach ein Stück aus Dankbarkeit gebotener Achtung, daß ich frage: Wie seid ihr, meine Vorfahren, angesichts kaum noch vorstellbarer Härten des Lebens miteinander umgegangen?