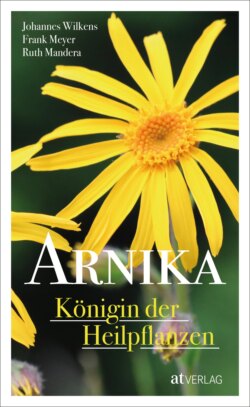Читать книгу Arnika - Königin der Heilpflanzen - eBook - Frank Nicholas Meyer - Страница 15
ОглавлениеGestalt und Entwicklung der einzelnen Pflanzenteile
Das wichtigste Organ der Arnika ist das unterirdische Rhizom, ein annähernd horizontal wachsender »Erdspross«, rhythmisch gegliedert in Knoten und Internodien und nur maximal sechs Millimeter dick. Dieses Rhizom verbindet sich wenig mit dem Untergrund, sondern bleibt dicht unter der Erdoberfläche im Bereich der oben geschilderten Rohhumusdecke oder in Moornähe unter den Moospolstern. Es wird mehrere Zentimeter lang und spiegelt die Aktivitäten der Arnika im Jahresgang wieder: dickere, gestauchtere Abschnitte mit eng beieinanderliegenden Knoten und Blattnarben verweisen auf das Sommerwachstum; schmalere, weiter auseinanderliegende Knoten und Blattnarben entsprechen dem Frühjahrswachstum. Die Rhizome verzweigen sich zu einem Netzwerk, sodass die verschiedenen Erdsprosse benachbarter Pflanzen neben- und übereinander verlaufen. Nach einigen Jahren sterben die ältesten Teile ab.
Blattrosette von Arnica montana mit dunkelbraunem Rhizom und kräftigen hellbraunen Wurzeln.
Aus dem Rhizom entspringen viele Wurzeln. Sie sind – im Vergleich zum schmalen Rhizom – mit einem Durchmesser von etwa zwei Millimetern verhältnismäßig dick, erstaunlich fleischig und zunächst unverzweigt. Die bekannte Klagenfurter Wurzelforscherin Lore Kutschera (1917–2008) nennt sie »schnurförmig«. Sie grub Arnikapflanzen an verschiedenen Standorten aus und gibt Wurzeltiefen von 25 bis 90 Zentimetern an, je nach Bodenerwärmung und Untergrund. Die Wurzeln leben in Symbiose mit Mykorrhizapilzen.
Im Herbst sind an den Rhizomspitzen Knospen zu sehen, aus denen im Frühsommer (im Mai oder Juni, abhängig vom Standort) die jungen Blätter treiben. Diese ersten Blätter bleiben noch ganz dicht am Boden, bilden also eine sogenannte Rosette. Bei vielen Rosettenpflanzen sieht man wunderschöne Blattspiralen auf der Erde, vor allem wenn sie grün durch den Winter getragen wurden, wie beispielsweise bei der Nachtkerze, den Königskerzen oder der Wegwarte. Bei der Arnika gibt es niemals Blattspiralen, da alle ihre Blätter strikt gegenständig angelegt sind. Das entspricht der Blattstellung von jungem Feldsalat, dessen gekreuzt gegenständige Rosetten wir im Winter so gern essen. Am hellen Naturstandort im Gebirge legt die Arnika die Blätter der noch nicht blühenden Rosetten jedoch nach dem Sprießen flach auf den Boden und dabei so übereinander, dass das charakteristische »Arnikakreuz« entsteht. Inmitten der feingliedrigen Vegetation einer Magerwiese fällt es durch seine Größe und Robustheit sofort auf – auch wenn es nicht ganz exakt gebildet ist.
Das auffällige »Arnikakreuz« der Rosettenblätter.
Klas Diederich und Urte Riggers, die die Arnica montana ausführlich beobachteten, beschreiben, dass unter der Blattdecke ein eigenes Kleinklima entsteht, das auch bei starker Sonnenbestrahlung kühl und feucht bleibt: »Jede einzelne Arnikapflanze wird an ihrem Standort dominant. Sie selbst prägt das Klima am Boden« (DIEDERICH und RIGGERS 2003, S. 66). Die Blätter sind fest, übersät mit Drüsenhaaren und weißen Borstenhaaren, breit lanzettlich und »sitzend«, sie haben also keinen Blattstiel. Trotz der geometrischen Anordnung ist ein einzelnes Blatt bei genauer Betrachtung in sich nicht vollkommen symmetrisch, sondern oft leicht verzerrt beziehungsweise verbogen.
Viele Rhizomabschnitte bilden über mehrere Jahre diese der Erde verhafteten Blattkreuze, mal größer, mal kleiner. Hat sich jedoch der Vegetationspunkt der Achse für den Blütenimpuls geöffnet, dann erhebt sich rasch und kraftvoll aus der Mitte eines Kreuzes der Stängel, der die Dreiergruppe der Knospen hoch ins Licht trägt. Alle Blätter, auch die untersten, richten sich nun auf. Zunächst sind die drei Knospen vom untersten Blattpaar des Stängels noch wie von zwei großen grünen Händen umfasst. Der Stängel ist rundlich, fest, oft rötlich gefärbt. Neben den Borstenhaaren trägt er auch Drüsenhaare. Ganz im Inneren befindet sich ein weißes Mark, das sich im Laufe des Sommers auflösen kann, sodass dann die Stängel hohl werden.
Vor dem Aufblühen neigen sich die Blütenkörbchen noch einmal zur Erde zurück, ehe sie sich dezidiert in dieVertikale aufrichten. Die langen Zungenblüten drängen als Erste hervor. Ihre sonnengelbe Farbe ergibt einen warmen Farbklang mit den oft rot überlaufenen, ansonsten leuchtend grünen Hüllkelchblättern. Obwohl die Zungenblüten parallelnervig sind und in drei ordentlichen kleinen Spitzen enden, biegen sie sich von Anfang an in verschiedene Richtungen. Die sprichwörtliche wirbelnde »Strubbeligkeit« von Arnikaköpfchen, an denen man die Pflanzen in der Natur unfehlbar erkennen kann, rührt nicht vom Wind her, sondern ist tief mit dem Wesen dieser besonderen Pflanze verbunden. Mehr dazu später.
Die Zungenblüten der Arnika haben die Fähigkeit verloren, Früchte hervorzubringen – im Gegensatz zur Calendula (Seite 54). Sie bilden keine Staubblätter, und trotz eines vorhandenen Fruchtknotens mit langem Griffel kann keine Befruchtung stattfinden. Die dunkleren gelben Röhrenblüten verharren zunächst im Knospenstadium, ehe sie sich allmählich von außen nach innen öffnen. Kleine leuchtende Fünfsterne werden nun sichtbar, aus deren Mitte sich die rotgoldene Staubblattröhre herausschiebt (die Staubbeutel sind seitlich miteinander verklebt), durch die sich schließlich auch der zweiteilige Griffel ans Licht streckt (siehe Seite 18/19). Am natürlichen Standort entstehen in der Regel in einem Arnikakorb 15 bis 19 Zungenblüten, die eine Gruppe von 80 bis 90 Röhrenblüten einschließen. Arnika blüht zur Johannizeit bis in den Juli hinein. Helmut und Margrit Hintermeier beschreiben in ihrem Buch von 2012, dass bis zu 18 verschiedene Insektenarten – Bienen, Hummeln, Schwebfliegen, Falter und Käfer – die Arnika besuchen und Nektar und/oder Pollen aufnehmen.
Zu einer echten Blüte gehören typischerweise auch Kelchblätter. Bei vielen Korbblütlern sind die Kelchblätter der Röhren- und Zungenblüten gar nicht ausgebildet oder zu kleinen Zähnchen reduziert. Beim Löwenzahn dagegen kann man sie bereits im Blütenkorb als feine Haare oberhalb der Fruchtknoten bemerken. Die so verwandelte Kelchhülle wird »Pappus« genannt. Während der Frucht- und Samenreife strecken sich beim Löwenzahn sowohl alle Pappushaare als auch das Stielchen zwischen Frucht und Pappusschirmchen. Schließlich bilden alle Haare gemeinsam die lichte, eindrucksvolle Kugel der Pusteblume in ihrer kristallinen Vollkommenheit. Obwohl eine Arnika kaum Ähnlichkeit mit einem Löwenzahn hat, sind ihre Zungen- und Röhrenblüten auch von Pappushaaren umgeben. Sie machen einen beträchtlichen Teil der Droge »Arnikablüten« aus. Lässt man abgeschnittene Blütenköpfe der Arnika zum Trocknen liegen, dann strecken sich diese Haare und es entsteht auch eine kugelige Pusteblume. Im Vergleich mit einer Löwenzahnkugel ist die Arnikakugel kleiner, dichter und struppiger. Das liegt daran, dass Arnikafrüchtchen viel länger als Löwenzahnfrüchtchen sind und die 30 bis 40 Pappushaare direkt an ihrem oberen Ende entspringen: ein Stielchen fehlt. Außerdem sind die Haare borstig-rau, kürzer und schimmern nicht so rein weiß. Wenn man sie verbrennt, bleibt von jedem Pappushaar ein feinster, verkrümmter, aber zusammenhängender, reinweißer Strang übrig. Inwieweit es sich dabei um reine Kieselsäure handelt oder welche anderen Substanzen mit hineingewoben sind, müsste geprüft werden.
Längsschnitt durch ein junges Blütenköpfchen, die weißen Pappushaare bedecken die noch knospigen Röhrenblüten.
Kugelige »Pusteblume« der Arnika.
Leicht werden die Früchte ab Ende August mithilfe der Flugschirme vom Wind über die Landschaft getragen. Dort, wo die Grasnarbe durch Erosion, Trittspuren von Rindern oder auf Skipisten aufgerissen ist, können die Arnikafrüchtchen keimen und im Laufe der Zeit zu verzweigten Rhizomen und gekreuzten Rosetten heranwachsen. Die oberirdischen Triebe der Pflanze verdorren allmählich im Herbst und verharren braun, steif und rau bis zum Wintereinbruch. Unterirdisch bleiben die Rhizome aktiv und können noch im September neue kleine Rosetten bilden.
Bemerkenswert ist, dass die spitzen, durchsichtigen Borstenhaare zum Blütenstand hin zunehmen und auch im Inneren der Köpfchen vorhanden sind: Mit einer Lupe ist zu erkennen, dass die unteren Abschnitte der Röhrenblüten und die ausgereiften Früchte dicht borstig besetzt sind.