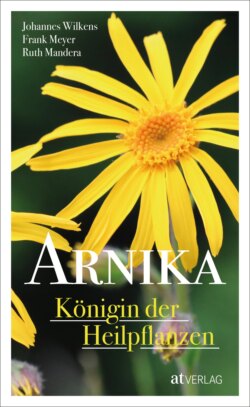Читать книгу Arnika - Königin der Heilpflanzen - eBook - Frank Nicholas Meyer - Страница 18
ОглавлениеPflege und Anbau
»Seit einigen Jahren verschwinden Pflanzen aus der Gegend, wo ich wohne, die sonst häufig da waren, zum Beispiel Gentiana ciliata, Verbena europaea, Pinguicula vulgaris. (…) Ich sehe doch nicht, dass die Arnika fehlt, von der man jährlich einen Pferdekarren voll sammelt und in Apotheken bringt« (Goethe, zitiert in MAYER/CZYGAN 2000, S. 31).
Wie sieht es seither aus? In den letzten zwei Jahrhunderten wurde die Arnika durch intensives Sammeln und den schleichenden Verlust geeigneter Lebensräume so rar, dass sie in verschiedenen Ländern Europas vom Aussterben bedroht ist und seit Langem unter Naturschutz steht. In Deutschland zählt sie zu den besonders geschützten Arten, das heißt, dass das Ausgraben und Sammeln von unter- und oberirdischen Teilen wild wachsender Pflanzen überall verboten ist; man kann aber eine offizielle Sammelgenehmigung beantragen. Die Firma WALA erntet mit Sammelgenehmigung Frischpflanzen auf gepachteten Wildstandorten, unter anderem im Schwarzwald, auf Wiesen, die durch Beweidung gepflegt werden. In Österreich und in der Schweiz sind die Einschränkungen je nach Region unterschiedlich. In Österreich dürfen Blütenköpfe in einigen Bundesländern gepflückt werden, in anderen ist die Arnika vor dem erwerbsmäßigen Handel geschützt. In der Schweiz ist sie in einigen Kantonen vollständig oder teilweise geschützt, in anderen gilt sie als nicht gefährdet (Rote Liste der gefährdeten Arten in der Schweiz 2002).
Naturschutz darf sich jedoch nicht auf ein Sammelverbot beschränken. Bedroht ist die Arnika zum einen durch eine düngungsintensive Landwirtschaft, zum anderen aber gerade durch das Fehlen einer Bewirtschaftung. Wird weder gemäht noch beweidet, verändert sich die Artenzusammensetzung der Wiesen oft so sehr, dass die Arnika verdrängt wird. Die wild wachsende Arnica montana benötigt heutzutage also die sorgsame Pflege durch verantwortungsvolle Menschen. Eine Zusammenstellung von Handlungsempfehlungen gibt das deutsche Bundesamt für Naturschutz unter https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/Pfl_Arnimont.pdf. Sie braucht aufmerksame Bauern, die die geschützten Standorte zu den richtigen Zeiten mähen, indem sie die Fruchtreife der Arnika beachten und die Zwergsträucher in Schach halten. (Dies wird auch in unserem Arnikafilm deutlich, siehe https://tinyurl.com/arnika-heilt.) Andererseits unterstützt eine sachgemäße Beweidung auch die Ausbreitung der Arnika, da die Tiere ihr durch das Kurzhalten der übrigen Kräuter Raum und Licht verschaffen. Kühe fressen zwar die Blütenstände des giftigen weißen Germers (Veratrum album), nicht aber die bittere Arnika! Ebenso regt das achtsame Ernten von Blütenkörben oder auch der ganzen oberirdischen Pflanzen inklusive eines kurzen Rhizomstücks die Rhizome zu einer verstärkten Vermehrung an.
Um sich die benötigten Mengen vorstellen zu können, sei auf ein Zitat von Michael Straub verwiesen: »In Europa werden pro Jahr 50 bis 60 Tonnen Arnikablüten aus Wildsammlung verarbeitet«. (MEYER und STRAUB 2011, S.55). Hinzu kommen angebaute Pflanzen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, fehlte es nicht an Züchtungsforschung. So berichtete Ulrich Bomme, emeritierter Professor an der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau in Freising-Weihenstephan, im Jahr 2000 von den Erfolgen einer neuen Arnica-montana-Sorte mit dem Namen ‘Arbo’ (Sortenschutz seit 1998): Sie zeige einen guten und gesunden Wuchs und einen hohen Ertrag an Blütenkörben. Bei der Sorte ‘Arbo’ bildet jede einzelne Arnikapflanze zahlreiche Rosetten, die ganz eng beieinanderbleiben, wodurch ein dichter Tuff entsteht. Die Arnikakreuze überlagern sich dadurch. Die oberirdischen Triebe entfalten sich nahezu gleichzeitig, und jeder endet mit drei oder mehr Blütenköpfen; die Zungenblüten sind dynamisch verwirbelt. Samen der Sorte ‘Arbo’ gehen im Anbau besser auf als Samen aus Wildherkünften, sie sind auch nicht so anspruchsvoll in Bezug auf die Bodenverhältnisse. Die erfolgreiche Einführung dieser Sorte führte dazu, dass seit 2000 die amerikanische Arnica chamissonis nicht mehr als Bestandteil von »Arnikablüten« gestattet ist (European Pharmacopeia 9, 2016, siehe auch Seite 30). Saatgut der Sorte ‘Arbo’ kann man beim Templiner Kräutergarten oder über Jelitto Staudensamen erhalten.
Wieder zum Blühen gebracht: Arnika in Fichtelgebirge und Frankenwald
Goethe wird auf seinen Reisen nach Marienbad im nördlichen Fichtelgebirge und Frankenwald noch üppige Arnikabestände gesehen haben. Selbst bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren noch zahlreiche Wiesen mit großen Arnikavorkommen vorhanden. Überdüngung und Aufforstung führten dann zum Verschwinden der letzten Bestände.
Dank der Förderung durch das Bundesamt für Naturschutz, den Aktivitäten der Landräte Bernd Hering und Dr. Oliver Bär sowie des Landschaftspflegeverbands Landkreis und Stadt Hof konnte in den letzten Jahren ein für Deutschland einmaliges Projekt initiiert werden. Durch gezielte Maßnahmen wurde an vielen Flecken die Arnika wieder zum Blühen gebracht, sodass nun hier die wohl deutschlandweit größten Arnikabestände zu finden sind.
Arnika-Rad- und -Wanderwege weisen dem interessierten Laien den Weg und lassen ihn staunen über die Kraft und die Schönheit der Arnika. (Weitere Informationen unter http://arnikaprojekt-hof.de)
Ähnlich ist das Erlebnis auf den Arnikawiesen in der Arnika-Stadt Teuschnitz im nördlichen Frankenwald. Hier gibt es sogar regelmäßig im Sommer ein Arnikafest und eine Arnikaakademie. (Weitere Informationen unter http://teuschnitz.de/arnika-akademie)
Diese Arnikawiese am »Alten Pfarrhaus« bei Schönwald ist Teil des Arnikaprojekts Hof.
Auch in den Niederlanden, in deren Sandböden die Arnika relativ gut gedeiht, wird Arnika angebaut. (SCHÜPBACH 1997). Arncken und Ortin untersuchten in den 1990er-Jahren zwei verschiedene Höfe, auf denen Arnica montana in biologischer Qualität feldmäßig angebaut wurde. Während auf dem einen Hof die Pflanzen klein und wohlgeformt blieben und den arnikatypischen Geruch und Geschmack zeigten, wurden sie auf dem anderen zu üppig und verzweigten sich stark. Für unsere Betrachtung ergab sich dabei etwas Bedeutsames: Durch die Massebildung im Vegetativen ging einerseits das Arnikakreuz am Boden verloren, andererseits wuchsen die Zungenblüten geordneter. Außerdem rochen die verdickten Rhizome rüben-/möhrenartig. Man kann sagen: Eine zu triebig wachsende Arnica montana verliert sowohl ihre arteigene Gestalt als auch ihre typische Substanz.
Schutz der Arnica montana durch nachhaltige Wildsammlung in Rumänien
Interview mit Michael Straub, Heilpflanzenexperte
Das Apuseni-Gebirge liegt im Westen Rumäniens. Es ist Teil der Westrumänischen Karpaten und bietet ein äußerst vielfältiges Landschaftsbild mit wunderschönen Mischwäldern, grünen, noch traditionell bewirtschafteten Wiesen und Weiden sowie Ausblicken auf alpine Gipfel bis in eine Höhe von über 1800 Metern. Im Zentrum dieses Naturparadieses, in dem etwa 500 Wildpflanzenarten, darunter rund 250 Heilpflanzen, gedeihen, entstand seit der Jahrtausendwende ein zukunftsträchtiges Projekt, das nicht nur wegweisend für die Heilpflanzenkultivierung ist. Es ist auch bedeutsam für den Erhalt des natürlichen Umfelds und der über Jahrhunderte gewachsenen sozialen Strukturen in einer ländlichen Umgebung, wo noch weitgehend mit der Hand und mit Pferden gearbeitet wird – ohne großen Einsatz von Maschinen, ohne Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln oder synthetischem Dünger. Unter dem Motto »Schutz durch Pflege und Nutzung« wird hier die Wildsammlung der im Apuseni weitverbreiteten Arnika vorangetrieben, mit den Zielen, hochwertigste Arnika als Rohstoff für Naturarzneimittel und Naturkosmetik zu nutzen, den Fortbestand der Arnikabestände nachhaltig zu sichern und damit auch neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für die ansässigen Kleinbauern zu schaffen. Diese betreiben Subsistenzwirtschaft, sind also weitgehend Selbstversorger. Es geht hier nicht um billige Arbeitskräfte und Rohstoffe, sondern um nachhaltige Nutzung, faire Arbeitsbedingungen und Qualität.
Wir sprachen über dieses großartige Projekt mit Michael Straub aus Mutlangen, einem der weltweit führenden Experten für die Sammlung, den Anbau und die Verarbeitung von Heilpflanzen. Der 1959 geborene Diplom-Agraringenieur hat als Anbauberater für Rohstoffprojekte bei Demeter und Weleda international Erfahrungen gesammelt und Heilpflanzenprojekte auf der ganzen Welt eingerichtet und betreut. Er ist Leiter des Heilpflanzengartens bei der Weleda AG in Schwäbisch Gmünd. Er ist verantwortlich für die pflanzlichen Ausgangsstoffe der dort produzierten Naturkosmetika und anthroposophischen Arzneimittel, darunter viele Arnikapräparate. Zusammen mit dem Agrarwissenschaftler der Universität Klausenburg Dr. Florin Pacurar und dem WWF hat Michael Straub im Apuseni-Gebirge ein Konzept zur nachhaltigen Arnikawildsammlung entwickelt, durch das die Population der Arnika trotz der Sammlung nicht gefährdet wird und auf einigen Wiesen sogar zugenommen hat.
Seit 2005 betreut Weleda ein Projekt zur nachhaltigen Nutzung von Arnica montana aus Wildsammlung in Rumänien. Wie kam es dazu? Im Jahr 2000 entdeckten Wissenschaftler der Universität Freiburg den enormen Artenreichtum des Apuseni-Gebirges in den Westkarpaten Rumäniens. Von 2004 bis 2007 unterstützte der WWF mit dem Programm der Darwin-Initiative »Konservierung osteuropäischer Heilpflanzen: Arnika in Rumänien« die Region. Im Frühling des Jahres 2005 fand Weleda das Projekt und fördert seitdem die Initiative finanziell und mit Wissenstransfer zum Anbau von Arnika am Wildstandort.
Aufgrund welcher geologischen und klimatischen Bedingungen gedeiht die Arnika in dieser Region so prächtig? Die geologischen Bedingungen mit den hohen Eisen- und Quarzgehalten, der Höhenlage von 700 bis 1800 Metern, den Bodenverhältnissen mit den niedrigen pH-Werten, dem Klima mit intensivster Sonneneinstrahlung im Sommer und extremer Kälte mit viel Schnee in den harten Wintern bieten ideale Bedingungen für die Ausprägung des arttypischen Charakters der Wildpflanze.
Warum sind Quarz und Eisen so wichtig für die Arnika? Die Arnika ist eine Pflanze mit einem hohen Bedarf an Kieselsäure und Eisen. Der Kieselsäureprozess ist ein elementarer Gestaltungsprozess, der für robuste Gewebestrukturen sowohl bei der Pflanze als auch beim Menschen verantwortlich ist. Stabile Strukturen braucht die Arnika, um unter den harten Bedingungen des Gebirges überleben zu können. Kiesel festigt, erhält aber gleichzeitig die Biegsamkeit, die vor mechanischen Einwirkungen – zum Beispiel durch Tritte von Tieren oder hohen Schneedruck – schützt. Granit, das Urgestein des Apuseni-Gebirges, enthält sehr viel Kiesel.
Eisen ist für alle Pflanzen ein lebensnotwendiges Spurenelement und hat einen entscheidenden Einfluss auf ihr Wachstum und die Photosynthese. Bei alkalischen Böden ist die Verfügbarkeit von Eisen deutlich geringer und es kann zu Eisenmangel kommen. Böden auf der Basis von Granit, wie in bestimmten Regionen im Apuseni, sind eher sauer und halten das Eisen für die Arnika verfügbar, sodass keine Mangelerscheinungen auftreten.
Was hast du am Standort selbst erlebt, als du ihn das erste Mal aufgesucht hast? Die besonderen Gestaltungskräfte dieses Gebirges, die sich aus dem Zusammenwirken von Boden, Klima und Astralität ergeben, können an der Pflanze erfühlt und an der Morphologie erkannt werden.
Arnikasammlerin im Apuseni-Gebirge.
Welche Bedeutung für die Arnika haben die im Apuseni-Gebirge ansässigen Kleinbauern und die von ihnen, quasi in Handarbeit, betriebene traditionelle Landwirtschaft? Das Überleben der Pflanze hängt direkt an der extensiven Wiesennutzung der Kleinbauern, welche die Wiesen nach der Arnikablütenernte traditionell zur Gewinnung von Heu abmähen. Werden die Wiesen nicht mehr gemäht, tritt die natürliche Sukzession ein und es wachsen Sträucher wie zum Beispiel Heidelbeere (Vaccinium myrtillus L.), andere Stauden und später auch diverse Laub- und Nadelbäume, sodass die Landschaft für die Arnika verlorengeht, da sie die Konkurrenz um Nähstoffe und Licht nicht verträgt. Die Arnika ist ein eindeutiger Kulturfolger des Menschen. Um sie zu schützen, ist es deshalb erforderlich, den Kleinbauern vor Ort eine langfristige Existenzgrundlage zu sichern.
Die Kleinbauern im Apuseni sind in einem hohen Grad Selbstversorger auf Grundlage der Haltung weniger Tiere, die sie von den kargen Wiesen ernähren können, und des Anbaus von Gemüse und Salat auf den wenigen ebenen Flächen. Das Gras wird immer noch vorwiegend mit der Sense oder kleinen Balkenmähgeräten geerntet. Die Arnika ist eine sehr sensible Pflanze, deren Rhizom von schweren Traktoren zerstört würde. Der Einsatz von stickstoffhaltigen Kunstdüngern wiederum würde das Wachstum der Gräser so anheizen, dass die Arnika überwachsen würde, die Rosette am Boden nicht mehr ausreichend Licht bekäme und sich nicht mehr mit den notwendigen Nährstoffen versorgen könnte. So erhält diese spezifische, traditionelle und schonende Bewirtschaftung der Wiesen die Arnika am Leben.
Und die Menschen vor Ort – welchen Nutzen haben sie von dem Arnikaprojekt? Im Apuseni-Gebirge helfen sich Arnika und Menschen gegenseitig. Die Ernte und der Verkauf der Arnika bieten eine zusätzliche Einnahmequelle, wodurch die Bauern einen Anreiz haben, diese Art der extensiven Bewirtschaftung weiter zu erhalten und in den Bergen zu bleiben. Ob die nächste Generation noch dazu bereit sein wird, ist die Frage, die sich unweigerlich stellt.
Wer sammelt die Arnika – und wie erfolgt dieser Arbeitsgang? Die Arnika wird von den Bauernfamilien gesammelt. Wenn die Erntezeit beginnt, kommen oft auch die älteren Kinder, die mittlerweile in den Städten leben, wieder zurück, um bei der Ernte zu helfen und sich ein paar Euro dazuzuverdienen.
Wenn es eines Tages kaum noch Kleinbauern und Heilpflanzensammler geben sollte – wie könnte es dann mit der Arnika in den Westrumänischen Karpaten weitergehen? Seit 2010 werden mit Unterstützung von Weleda Anbauversuche durchgeführt, die zu ermutigenden Ergebnissen geführt haben und es einigen Bauern mittlerweile ermöglichen, zusätzlich zur Wildsammlung auf ebenen Flächen Arnika zu kultivieren und zu ernten.
Wie kommt die Arnika von den Karpaten nach Deutschland? Um die frische Arnika zu konservieren und für den Transport nach Deutschland vorzubereiten, wird sie noch in den Bergen getrocknet. Dr. Florin Pacurar hat in den letzten Jahren durch viele Experimente die Trocknung in den Bergen verbessert. Beheizt wird die Trocknungsanlage mit dem Holz aus dem Apuseni, sodass hier eine zusätzliche Wertschöpfung in der Region bleibt. Um ein Kilogramm trockener Ware zu erhalten, benötigt man rund fünf Kilogramm frische Blüten. Die Lieferung nach Deutschland erfolgt mit Kleinlastern, die direkt aus den Bergen zur Weleda nach Schwäbisch Gmünd fahren.
Welche Besonderheiten weist die Arnika aus den Karpaten – im Vergleich zu Arnika von andern Standorten – auf? Ein wichtiger Vorteil der rumänischen Karpaten ist das Phänomen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Regionen, in denen die Arnika wild wächst, keine Arnikafliege (Tephritis arnicae) vorkommt. Weleda erhält aus diesem Projekt jährlich mehrere Tonnen getrockneter Arnikablüten, deren Qualität nicht mehr zu überbieten ist.